Einzelbesprechungen = Comptes Rendus
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
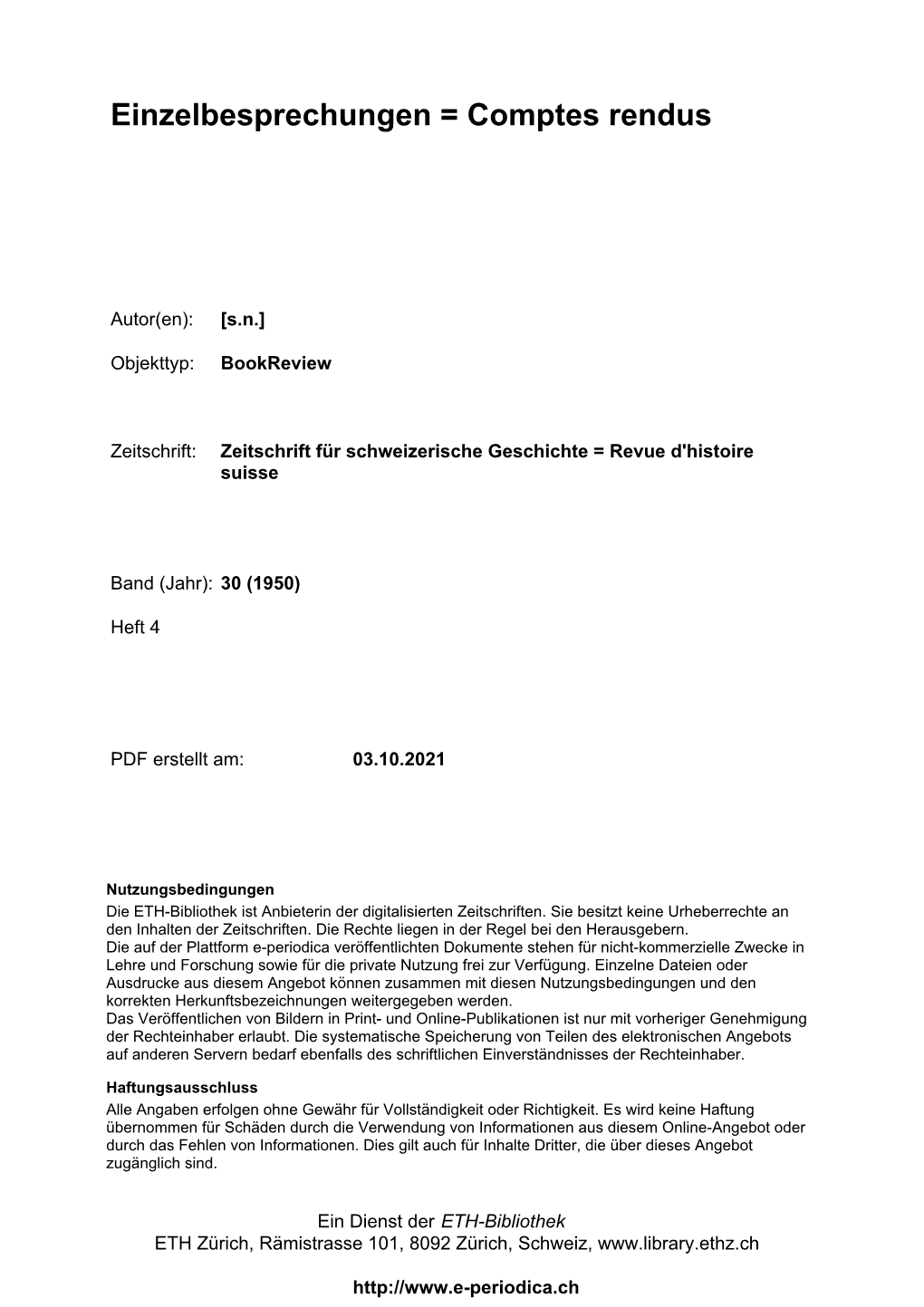
Load more
Recommended publications
-

Der Leopold-Sophien-Bibliothek Überlingen Von Dorothea Müller
Katalog der neuzeitlichen Handschriften (16. - 19. Jh.) der Leopold-Sophien-Bibliothek Überlingen Von Dorothea Müller Abkürzungen ADB Allgemeine Deutsche Biographie, Bd. 1-56, Berlin 1875- 1912. Alemannia Alemannia. Zeitschrift für alemannische und fränkische Geschichte, Volkskunde, Kunst und Sprache, Bd. 1-44, Freiburg i. Br. 1873-1917. Badische Biographien Badische Biographien. Hrsg. von Friedrich von Weech (u.a.), Bd. 1-6, Heidelberg 1875-1935. BBKL Biographisch-bibliographisches Kirchenlexikon. Hrsg. von Friedrich Wilhelm Bautz, fortgef. von Traugott Bautz, 2. Aufl., Bd. 1 ff., Hamm (u.a.) 1990 ff. DBE Deutsche Biographische Enzyklopädie, Bd. 1-12, München (u.a.) 1995-2003. FDA Freiburger Diözesanarchiv, Bd. 1 ff., Freiburg i.Br. 1865 ff. Germania Benedictina Germania Benedictina, Bd. 1 ff., St. Ottilien 1970 ff. GLA Karlsruhe Generallandesarchiv Karlsruhe. GV Gesamtverzeichnis des deutschsprachigen Schrifttums 1700-1910. Bearb. von Peter Geils u. Willi Gorzny, Bd. 1 ff., München (u.a.) 1979 ff. HBLS Historisch-Biographisches Lexikon der Schweiz, Bd. 1-7, Neuenburg 1921-1934. Helvetia Sacra Helvetia Sacra, Abt. 1 ff., Basel (u.a.) 1972 ff. Jöcher Christian Gottlieb Jöcher, fortgef. von Johann Christoph Adelung u. Heinrich Wilhelm Rotermund: Allgemeines Gelehrten-Lexicon …, Bd. 1-11, Leipzig (u.a.) 1750-1897. Kunzer 1894 Otto Kunzer: Die Handschriften der Leopold-Sophien- Bibliothek Überlingen, Autograph des Bearbeiters [1894] (ohne Seitenzahlen). LexMA Lexikon des Mittelalters. Hrsg. von Norbert Angermann (u.a.), Bd. 1-9, München (u.a.) 1980-1999. LSB Leopold-Sophien-Bibliothek. LThK Lexikon für Theologie und Kirche. Hrsg. von Walter Kasper, 3. Aufl., Bd. 1-11, 1993-2001. Mone Franz Joseph Mone: Quellensammlung der badischen Landesgeschichte, Bd. 1-4, Karlsruhe 1848-1867. -

Aufbruch Neue Soziale Bewegungen in Der Ostschweiz
156. Neujahrsblatt, 2016 Herausgegeben vom Historischen Verein des Kantons St. Gallen ANDREAS KNEUBÜHLER ARNE ENGELI BETTINA DYTTRICH CHRISTIAN HUBER ESTHER MEIER HARRY ROSENBAUM HEINRICH ZWICKY IRIS BLUM JOHANNES HUBER KASPAR SURBER MARCEL ELSENER MARINA WIDMER MAX LEMMENMEIER MICHAEL WALTHER PATRICK ZILTENER PIUS FREY RALPH HUG REA BRÄNDLE RENÉ HORNUNG RICHARD BUTZ RUEDI TOBLER WOLFI STEIGER 156. Neujahrsblatt Herausgegeben vom Historischen Verein des Kantons St. Gallen Aufbruch Neue Soziale Bewegungen in der Ostschweiz Rückblicke 2015 Archäologie – Denkmalpflege – Jahresberichte Vereine St. Gallen 2016 Folgende Institutionen haben die Herstellung des 156. Neujahrsblattes des Historischen Vereins des Kantons St. Gallen (2016) grosszügig unterstützt: Impressum © 2016, Historischer Verein des Kantons St. Gallen Konzept Hauptteil (Neue Soziale Bewegungen): Marina Widmer, Leiterin Archiv für Frauen-, Geschlechter- und Sozialgeschichte Ostschweiz, St. Gallen Lektorat/Redaktion Gesamtblatt: Prof. Dr. Johannes Huber, St. Gallen Lektorat/Redaktion Hauptteil (Neue Soziale Bewegungen): Marina Widmer, Jolanda Schärli Für den Inhalt der einzelnen Beiträge sind die Autorinnen und die Autoren verantwortlich. Auflage: 1 000 Exemplare Satz, Druck und Lithos: Toggenburger Verlag, CH-9103 Schwellbrunn Auslieferung, Bezugsstelle: Toggenburger Verlag, CH-9103 Schwellbrunn, www.toggenburgerverlag.ch ISBN: 978-3-908166-76-4 ISSN 0257-6198 Inhalt Neue Soziale Bewegungen 7 Marina Widmer: Einleitung 10 Johannes Huber: 68 bewegt die Welt, die Schweiz – und St. Gallen 14 Max Lemmenmeier: «Es ist unsere moralische Pflicht, für die Entrechteten und Unterdrückten einzustehen.» Zur Tätigkeit der Liga für Menschenrechte Sektion St. Gallen (Ostschweiz), 1963–2009 22 Ralph Hug: 68 in St. Gallen: Die «Aktion Rotes Herz» und ihre Folgen 27 Johannes Huber: «Aktion Rotes Herz» + 46 Jahre. Beteiligte, Quellen und Darstellungen im Diskurs 44 Richard Butz: Kaeser, Weil, «Kaktus», Comics, «Comedia», Druckerei Baumgardt (Schwalbenverlag). -

Nomination Form International Memory of the World Register
Nomination form International Memory of the World Register 1.0 Checklist Nominees may find the following checklist useful before sending the nomination form to the International Memory of the World Secretariat. The information provided in italics on the form is there for guidance only and should be deleted once the sections have been completed. x Summary completed (section 1) x Nomination and contact details completed (section 2) x Declaration of Authority signed and dated (section 2) If this is a joint nomination, section 2 appropriately modified, and all Declarations of x Authority obtained x Documentary heritage identified (sections 3.1 – 3.3) x History/provenance completed (section 3.4) x Bibliography completed (section 3.5) Names, qualifications and contact details of up to three independent people or x organizations recorded (section 3.6) x Details of owner completed (section 4.1) x Details of custodian – if different from owner – completed (section 4.2) x Details of legal status completed (section 4.3) x Details of accessibility completed (section 4.4) x Details of copyright status completed (section 4.5) x Evidence presented to support fulfilment of the criteria? (section 5) x Additional information provided (section 6) x Details of consultation with stakeholders completed (section 7) x Assessment of risk completed (section 8) Summary of Preservation and Access Management Plan completed. If there is no x formal Plan attach details about current and/or planned access, storage and custody arrangements (section 9) x Any other information provided – if applicable (section 10) Suitable reproduction quality photographs identified to illustrate the documentary x heritage. -

Jus Statutarium Veteris Territorii Principalis Monasterii Sancti Galli
Jus Statutarium veteris Territorii Principalis Monasterii Sancti Galli Ein Beitrag zur Rechtsgeschichte von Kloster und Kanton St. Gallen DISSERTATION der Hochschule St. Gallen für Wirtschafts- und Sozialwissenschaften zur Erlangung der Würde eines Doktor der Rechtswissenschaft vorgelegt von Stephan Staub von Gossau (St. Gallen) Genehmigt auf Antrag der Herren Prof. Dr. C. Soliva und Dr. E. Ziegler Dissertation Nr. 1043 ADAG Administration & Druck AG, Zürich 1988 Die Hochschule St. Gallen für Wirtschafts- und Sozialwissenschaften gestattet hiemit die Drucklegung der vorliegenden Dissertation. ohne damit zu den dartn ausgessprochenen Anschauungen Stellung zu nehmen. St. Gallen. 07. Dezember 1987 Der Rektor: Prof. Dr. Johannes Anderegg Jus Statutarium vetens fJ'erritorii Principa{is Monasterii Sancti (ja{{i Federzeichnung von August Hardegger "DAS FÜRSTLICHE KLOSTER ST. GALLEN CIRCA 1790" aus: August Hardegger, SaJomon Schlatter und Traugott Schiess: Die Baudenkmäler der Stadt St. Gallen, St. Gallen 1922, S. 201 Meinen El~ern Vorwort Meinem Doktorvater, Herrn Prof. Dr. Claudio Soliva, danke ich flir die grosse Freiheit, die er mir bei der Ausarbeitung der vorliegenden Dissertation gewährt hat. Seine Anteil- nahme und sein Interesse am Werden der Arbeit, vor allem auch sein kritischer, aber doch immer wohlmeinender Rat halfen mir sehr bei der Abfassung der Dissertation. Ebenso danke ich dem Stadtarchivar, Herrn Dr. Ernst Ziegler, ftir die bereitwillige Ueber- nahme des Korreferats. Seine philologischen Ratschläge waren mir eine grosse Hilfe. Der Stiftsarchivar, Herr Dr. Wemer Vogler, hat mich auf das Jus Statutarium als mögli- ches Dissertationsthema hingewiesen. DIrn und seinem Mitarbeiter, Herrn Lorenz Holen- stein, lic.phil. I, der mich bei der Quellensuche ausserordentlich unterstützt hat, sei mein spezieller Dank ausgesprochen. -

Franziskus Hertenstein (1610–1686) Konventuale Von St. Gallen
Franziskus Hertenstein (1610–1686) Abt OSB 1653–1686 in Ettenheimmünster Konventuale von St. Gallen Matthäus Hertenstein wird am 7. Dezember 1610 als Sohn des Georg und der Dorothea Schedler in Rorschach geboren.1 Er besucht die unteren Gymnasialklassen in Rorschach und geht für die oberen Klassen nach Ravensburg, tritt dann ins Kloster St. Gallen ein, von wo er 1629 wegen Pestausbruchs nach Murbach geschickt wird.2 Erst 1631 kann er in St. Gallen Profess unter dem Klosternamen Franziskus ablegen. Hier feiert er 1637 Primiz. Er ist guter Musiker und lässt sich auf diesem Gebiet in der Abtei Weingarten unterrichten. 1652 wird er zum Subprior des Fürststifts ernannt. Am 19. Juli 1653 erbittet sich das Kapitel von Ettenheimmünster den St. Galler Pater als neuen Abt. Ettenheimmünster im Dreissigjährigen Krieg und seine Beziehung zu St. Gallen Zusammen mit den Abteien Schuttern, Gengenbach, Schwarzach, Ebersmünster, Altdorf bei Molsheim und Maursmünster ist Ettenheimmünster Mitglied der von Österreich geschaffenen Strassburger Benediktinerkongregation. Als einziges dieser Benediktinerklöster des Bistums Strassburg liegt es auch in der Herrschaft des Strassburger Bischofs. In den Wirren um die Besetzung des Bischofstuhls werden die Mönche noch 1595 von den reformierten Strassburgern vertrieben. Erst nach dem Sieg der österreichischen Partei 1604 beginnt wieder klösterliches Leben. Im schnell folgenden Dreissigjährigen Krieg ist der Konvent wieder mehrheitlich auf der Flucht. Er hält sich in Muri, Einsiedeln und Engelberg auf. Abt Placidus Vogler3 stirbt 1646 im Exil in St. Gallen. Der nachfolgende Abt Amandus Rietmüller4 muss 1650 den fahrlässig ausgelösten Brand der Klosterkirche miterleben. Angefeindet wegen schlechter Verwaltung, resigniert er 1652. P. Arbogast Arnold5 übernimmt interimistisch die Regierung. -

Gib Rechenschaft Von Deiner Verwaltung»
«GIB RECHENSCHAFT VON DEINER VERWALTUNG» 1913 8. September 1963 In dankbarer Erinnerung an meinen Novizenmeister Dr. P. Fridolin Segmüller OSB (1859-1933) Privatdruck A. Gedruckte Arbeiten Zur Einsiedler Klostergeschichte Das vorliegende Verzeichnis wurde erst 1938 angelegt, und zwar 1. Profeßbuch der Fürstl. Benediktinerabtei U. L. Frau von Ein aus praktischen Gründen, um das Nachsuchen zu erleichtern. Es siedeln. Zug, Kalt-Zehnder. 1934. Gr. 4°. 676 S. mögen darum einzelne kleinere Arbeiten fehlen. Ebenfalls um 2. Einsiedeln. Ein Führer durch seine Geschichte, Kunst und Kul das Nachsuchen zu erleichtern wurden die Arbeiten nach Stoff tur. Verlag Gebr. Eberle, Einsiedeln. 12°. 96 S. Erschien auch französisch. gebieten geordnet, wobei freilich nicht immer eine saubere Tren nung möglich war. Wenn die bibliographischen Angaben nicht 3. Führer durch die Stiftskirche Maria Einsiedeln. Einsiedeln, Benziger. 1924. 2. Aufl. 1928. immer vollständig sind, erklärt sich dies daraus, daß in manchen Fällen kein Belegexemplar mehr vorlag. Diese Veröffentlichung 4. Einsiedeln. Führer durch die Kloster- und Wallfahrtskirche. Scheidegg i. Allgäu, Schnell und Steiner. 1951. ff. Viele Auf trägt zudem rein privaten Charakter. lagen. Auch französisch und englisch erschienen. 5. Einsiedeln. Kleiner Führer durch das Kloster. Einsiedeln, Gebr. Eberle. Erschien auch französisch, italienisch und eng lisch. 6. Heraldischer Führer durch Kirche und Kloster von Einsiedeln. Einsiedeln, Gebr. Eberle. 1955. 16 S. 7. Kleiner Führer durch die Stiftskirche Einsiedeln. Stiftsdruk. kerei. 4 S. Erschien in vielen Auflagen. 8. Das finanzielle Nachspiel zum Sonderbundskrieg im Kanton Schwyz. Mitteilungen des Historischen Vereins des Kantons Schwyz. 47. Heft. 1948. S. 5-52. 9. Abbatia nullius Einsidlensis. Meinradsraben 1948. S. 115 bis 121. 10. -

The Swiss Exile in London. Space of Experience and Political Imaginations, 1798-1815 1
Project description Stefanie Göttel The Swiss Exile in London. Space of Experience and Political Imaginations, 1798-1815 1. Topic and scientific research question The Swiss exile from 1798 to 1815 in national historiography is still an unknown. This politically motivated emigration was triggered by the Helvetic Revolution, which, with military support from the French Republic, led the political elite of the Swiss Confederation to flee the country and for the first time created a unitary state. What has so far gone unnoticed in research is the fact that in 1813 émigés returned from exile to the political elite of Switzerland and initiated the Restoration phase of their home cantons. The terms “old-minded” (Altgesinnte), “(ultra-)conservatives”, “counterrevolutionaries” or “reactionaries” that are used to describe the elite of the Restoration do neither take into account the broad political spectrum nor the social heterogeneity of the actors in exile. This research project therefore aims to capture the political spectrum in exile, whose representatives have long been seen as (ultra-)conservative reactionaries and been juxtaposed to the supposedly progressive, liberal revolutionaries. The dichotomous thinking in supporters and opponents of the revolution draws an artificial line that ignores overlapping political ideas. The objective of the dissertation is to show the diversity that was to be found in the émigrés' political plans for the future and what role the migration movement played in the construction and transformation processes of the Swiss state and national identity until 1815. The intention is to break away from preconceived ideas about counterrevolution, restoration and conservatism and instead to get an understanding of the reaction to the revolution in its plurality. -

Bulletin Mitteilungsblatt SSE-SEG Info 2.2005 – 1
Schweizerische Ethnologische Gesellschaft Société Suisse d’Ethnologie Bulletin Mitteilungsblatt SSE-SEG Info 2.2005 – 1. 2006 Inhaltsverzeichnis / Contenu Aus der Gesellschaft / Vie de la Société Wort des Präsidenten / mot du Président ................................................................................... 3 Call for Panels 2006 – Annual meeting of the SEG-SSE .......................................................... 4 Journée interdisciplinaire « De l’efficacité : entre technique et symbole » .............................. 5 MAS – Medical Anthropology Switzerland / Jahresbericht...................................................... 7 Wissenschaftskommission - Commission scientifique / Report ................................................ 8 Commission de rédaction / Rapport .......................................................................................... 9 Aus der Arbeit der Museen / Musées Basel ........................................................................................................................................ 11 Bern ......................................................................................................................................... 13 Burgdorf................................................................................................................................... 13 Genève ..................................................................................................................................... 14 Neuchâtel ................................................................................................................................ -

Bodensee-Bibliographie 1996
Bodensee-Bibliographie 1996 Zusammengestellt von GÜNTHER RAU Verein für Geschichte des Bodensees und seiner Umgebung Friedrichshafen Universität Konstanz 1998 Anschrift der Redaktion: Bibliothek der Universität Konstanz - Bodensee-Bibliographie - D-78457 Konstanz E-Mail: [email protected] Inhaltsverzeichnis Vorwort . 5 Sachliches Gliederungsschema der Bodensee-Bibliographie . 6 Hinweise zur Bodensee-Datenbank . 10 Bodensee-Bibliographie 1996 . 11 Verfasserverzeichnis . 203 ________________________ Zum Bodenseeraum zählen auf deutscher Seite der Landkreis Konstanz, der südlichste Teil des Landkreises Sigmaringen, der Bodenseekreis, der Südteil des Landkreises Ravensburg und der Landkreis Lindau; das Land Vorarlberg; das Fürstentum Liechtenstein; auf schweizerischer Seite das Rheintal bis Sargans, der Nordteil des Kantons St. Gallen, die beiden Halbkantone Appenzell, der Kanton Thurgau und der Kanton Schaffhausen. Vorwort Die Bodensee-Bibliographie 1996 verzeichnet 2387 Titel von Monographien, Aufsätzen und umfangreichen Zeitungsartikeln zu Themen, Personen und Orten des Bodenseeraumes. Das Zustandekommen der Bibliographie haben wie in den vergangenen Jahren folgende Institutionen mit ihren Titelmeldungen ermöglicht: Badische Landesbi- bliothek Karlsruhe, Hegau-Bibliothek Singen, Kreisarchiv des Bodenseekreises in Markdorf, Bodensee-Bibliothek/Stadtarchiv in Friedrichshafen, Kreisarchiv Ravensburg, Stadtarchiv Isny, Stadtarchiv Leutkirch, Stadtarchiv Ravensburg, Stadtarchiv Wangen im Allgäu, Stadtarchiv Weingarten, Stadtarchiv -

Bodensee-Bibliographie 1998
Bodensee-Bibliographie 1998 Zusammengestellt von GÜNTHER RAU Verein für Geschichte des Bodensees und seiner Umgebung Friedrichshafen Universität Konstanz 2000 Anschrift der Redaktion: Bibliothek der Universität Konstanz - Bodensee-Bibliographie - D-78457 Konstanz E-Mail: [email protected] Inhaltsverzeichnis Vorwort . 5 Sachliches Gliederungsschema der Bodensee-Bibliographie . 6 Hinweise zur Bodensee-Datenbank . 10 Bodensee-Bibliographie 1998 . 11 Verfasserverzeichnis . 179 ________________________ Zum Bodenseeraum zählen auf deutscher Seite der Landkreis Konstanz, der südlichste Teil des Landkreises Sigmaringen, der Bodenseekreis, der Südteil des Landkreises Ravensburg und der Landkreis Lindau; das Land Vorarlberg; das Fürstentum Liechtenstein; auf schweizerischer Seite das Rheintal bis Sargans, der Nordteil des Kantons St. Gallen, die beiden Halbkantone Appenzell, der Kanton Thurgau und der Kanton Schaffhausen. Vorwort Die Bodensee-Bibliographie 1998 verzeichnet 1975 Titel von Monographien, Aufsätzen und umfangreichen Zeitungsartikeln zu Themen, Personen und Orten des Bodenseeraumes. Das Zustandekommen der Bibliographie haben wie in den vergangenen Jahren folgende Institutionen mit ihren Titelmeldungen ermöglicht: Badische Landesbi- bliothek Karlsruhe, Hegau-Bibliothek Singen, Kreisarchiv des Bodenseekreises in Friedrichshafen, Bodensee-Bibliothek/Stadtarchiv in Friedrichshafen, Kreisarchiv Sigmaringen, Kreisarchiv Ravensburg, Stadtarchiv Isny, Stadtarchiv Leutkirch, Stadtarchiv Ravensburg, Stadtarchiv Wangen im Allgäu, Stadtarchiv -

Stiftsarchiv St.Gallen Habe Auf Dieser Doppelseite Die Seitenzahlen Gelöscht, Da Beim Inhaltsverzeichnis Nicht Üblich Inhaltsverzeichnis
Tätigkeitsbericht 2012 – 2019 Stiftsarchiv St.Gallen Habe auf dieser Doppelseite die Seitenzahlen gelöscht, da beim Inhaltsverzeichnis nicht üblich Inhaltsverzeichnis 5 Vorwort des Stiftsarchivars 6 Highlights des Stiftsarchivs St.Gallen 10 Personelles 13 Benutzerzahlen und Anfragen 15 Fleissigster Benutzer und ehemaliger Stiftsarchivar: ein Kurzporträt von Lorenz Hollenstein 17 Konservierung Neue Fluchtkisten für das Bucharchiv 18 Schenkungen, Deposita und Erwerbungen 21 Restaurierung 23 Erschliessung Das Weltdokumentenerbe sichtbar machen 24 Managementplan UNESCO-Weltkulturerbe Stiftsbezirk St.Gallen 25 Interview mit dem Fotografen des Stiftsarchivs, Urs Baumann 26 Forschung Publikationen von Peter Erhart 32 Publikationen von Jakob Kuratli Hüeblin 33 Publikationen von Rafael Wagner 35 Vertretung des Stiftsarchivs St.Gallen in Fachgremien 36 Vermittlung Vedi Napoli e poi muori – Grand Tour der Mönche 43 Autor und Gönner: ein Portrait von Hermann Hungerbühler 44 250 Jahre barocke Stiftskirche 45 Ausstellungssaal 46 Projektverlauf Ausstellungssaal 53 Otmar und Beata – Der erste Abt und die Welt 54 Führungen 58 Vermittlungsprogramm für Kinder und Jugendliche 59 Vorträge von Peter Erhart 61 Vorträge von Jakob Kuratli Hüeblin Vorträge von Rafael Wagner 62 Leihgaben 4 « Mit dem im April 2019 neu eröffneten Ausstellungssaal begann eine neue Ära für die Vermittlung der weltweit einzigartigen Bestände des Stiftsarchivs, die seit 2017 zum Weltdokumentenerbe der UNESCO gehören.» 5 Vorwort des Stiftsarchivars Das Team des Stiftsarchivs pflegt trotz der neuen Herausforderungen im Zeitalter der Digi- talisierung seinen Blick auf eine Vergangenheit zu richten, die aufgrund ihrer einzigartig frühen Überlieferung noch ferner liegt als in den allermeisten Archiven dieser Welt. Allzu selten gelingt uns ein Innehalten, um auch die jüngste Vergangenheit zu dokumen- tieren, obwohl dies für eine Rekonstruktion der Archivgeschichte in einigen Jahrhunderten hilfreich sein könnte. -

1956 Salzgeber Joachim Marienberger Psalm Maria Einsiedeln 61, 1956, 210-213
Bibliographie von Pater Joachim Salzgeber zusammengestellt von P. Othmar Lustenberger, Stand Januar 2006 1956 Salzgeber Marienberger Psalm Maria Einsiedeln 61, 1956, 210-213 OSB - Klöster - Joachim Marienberg 1961 Salzgeber Die Schweizerische Benediktiner-Kongregation im 19. Manuskript. Einsiedeln 1961 Kongregation Joachim Jahrhundert. 1961 Salzgeber Die Professbücher von Einsiedeln und St. Gallen 1526- Löwen 1961 P. Joachim - Joachim 1797. Historisch-soziologische Studie (Mémoire présenté Lizentiatsarbeit pour l'obtention du grade de licencié en science historique) 1962 Salzgeber Abt Bernard Capelle, Löwen. Maria Einsiedeln 67, 1962, 129-130 Nachruf - Abt Bernard, Joachim Löwen 1963 Salzgeber Der heilige Odilo - Abt von Cluny. Maria Einsiedeln 68, 1963, 55-59 OSB - Klöster - Cluny Joachim 1966 Salzgeber Das zweifache Jawort [der Gottesmutter Maria]. Maria Einsiedeln 71, 1966, 390-391 Gnadenkapelle - Bau Joachim 1966 Salzgeber Mitgliederbestand des Klosters Einsiedeln 1530-1960. Maria Einsiedeln 71, 1966, 468-471, Tabelle K - Geschichte / Joachim Mitgliederbestand 1966 Salzgeber Ein barockes Gedankenspiel [Concetto der Einsiedler Maria Einsiedeln 71, 1966, 338-339 Klosterkirche - Joachim Stiftskirche]. Ikonologie 1966 Salzgeber Br. Ignaz Kilchör OSB Einsiedler Anzeiger 1966.10.28 Nachruf - Br. Ignaz Joachim Kilchör 1966 Salzgeber Volksliturgische Notiz [Jean Mabillon - Volksliturgie im Maria Einsiedeln 71, 1966, 425 OSB - Klöster - St. Joachim St.Gallischen Fürstenland]. Gallen 1967 Salzgeber Einsiedeln feiert seinen Kardinal. Offizielle Empfang für Schweizerische Kirchenzeitung 135, 1967, 361- Äbte - Kardinal Benno Joachim Kardinal Benno Gut 362 Gut 1967 Salzgeber Sein Name war Kaspar [Moosbrugger]. Maria Einsiedeln 72, 1967, 80-82, Abb. Mitbrüder - Br. Kaspar Joachim Moosbrugger 1967 Salzgeber P. Theodor Schwegler OSB Einsiedler Anzeiger 1967.09.27 Nachruf - P. Theodor Joachim Schwegler 1967 Salzgeber Dr.