Landschaftsgeschichte Des Haarmoosesjohann Zweckl
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
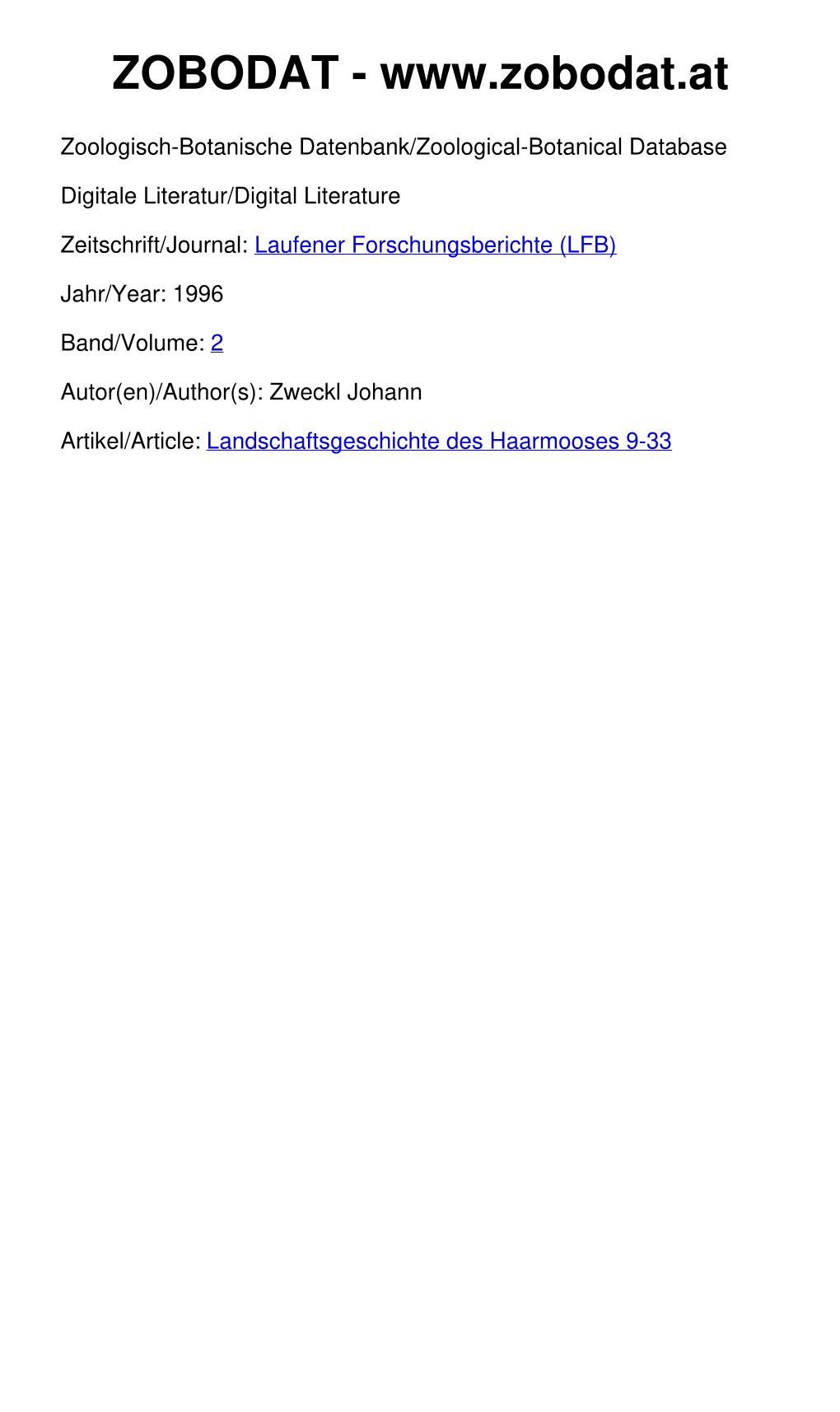
Load more
Recommended publications
-

Because Good Is Simply Better. for All of Us. Our Suppliers
BECAUSE GOOD IS SIMPLY BETTER. FOR ALL OF US. Eat, drink, be happy. It is not only important to us that there is something for every taste. We also invest in sustainable food and focus on meat from species-appropriate husbandry. Because you are worth it. And because we believe that with „cheap“ food, in the end it is a bad bargain for everyone. Humans, animals and the en- vironment. What our kitchen team uses comes mainly from the region, often even directly from the neighbouring farm. Meat and fish comes from regional farms, game from the National Park Berchtesgaden. The endangered black alpine pig is even specially breed for us by our partner farmer. And the mountain water we serve to you free of charge, is among the best drinking water in Germany. Over many years, we have created an extensive network of suppliers and producers with whom we maintain close rela- tionships and visit regularly. Our partners share our values and our commitment to the environment. We wish you a pleasant stay and a good appetite. Your Family Lichtmannegger & the Rehlegg Team OUR SUPPLIERS MEAT National Park Berchtesgaden The three professional hunters of the Berchtesgaden National Park provide venison, deer and chamois. Although 75% of the national park area is in a no hunting zone all year round, in the remaining quarter the stock has to be controlled because there are no natural enemies to the. Kederbachlehen - Ramsau Franz Kuchlbauer supplies the Rehlegg with beef and lamb. The mountain farmer also breeds black Alpine pigs for the Rehlegg, which are threatened with extinction. -

Auftraggeberin
Auftraggeberin: GEMEINDE PIDING Thomastraße 2 83451 Piding vertreten durch: Ersten Bürgermeister Hannes Holzner Auftragnehmer: DRAGOMIR STADTPLANUNG Kochelseestraße 11 81371 München Bearbeitung: Dipl.-Ing. Landschaftsplanerin Franziska Becker Dipl.-Ing. Raum- und Umweltplanerin Jennifer Spilsbury INHALTSVERZEICHNIS 1 Anlass und Zielsetzung der Ortsentwicklungsplanung.................................................................. 3 2 Methodik der Leitbildentwicklung..................................................................................................... 4 2.1 Beteiligte und Ablauf.........................................................................................................................4 2.2 Arbeitsschritte ..................................................................................................................................... 5 2.2.1 Impulsreferate.........................................................................................................................5 2.2.2 Entwicklungsszenarien........................................................................................................... 5 2.2.3 Arbeit im Plenum und in Gruppen ...................................................................................... 6 2.2.4 Erarbeitung eines Leitbildentwurfs ...................................................................................... 6 2.2.5 Diskussion im Fachforum ....................................................................................................... 7 2.2.6 Abgestimmtes -

Because Good Is Simply Better. for All of Us. Our
BECAUSE GOOD IS SIMPLY BETTER. FOR ALL OF US. Eat, drink, be happy. It is not only important to us that there is something for every taste. We also invest in sustainable food and focus on meat from species-appropriate husbandry. Because you are worth it. And because we believe that with „cheap“ food, in the end it is a bad bargain for everyone. Humans, animals and the en- vironment. What our kitchen team uses comes mainly from the region, often even directly from the neighbouring farm. Meat and fish comes from regional farms, game from the National Park Berchtesgaden, our Rehluga caviar from Königssee. The endangered black alpine pig is even specially breed for us by our partner farmer. And the mountain water we serve to you free of charge, is among the best drinking water in Germany. Over many years, we have created an extensive network of suppliers and producers with whom we maintain close rela- tionships and visit regularly. Our partners share our values and our commitment to the environment. We wish you a pleasant stay and a good appetite. Your Family Lichtmannegger & the Rehlegg Team OUR SUPPLIERS MEAT National Park Berchtesgaden The three professional hunters of the Berchtesgaden National Park provide venison, deer and chamois. Although 75% of the national park area is in a no hunting zone all year round, in the remaining quarter the stock has to be controlled because there are no natural enemies to the. Kederbachlehen - Ramsau Franz Kuchlbauer supplies the Rehlegg with beef and lamb. The mountain farmer also breeds black Alpine pigs for the Rehlegg, which are threatened with extinction. -

Rupertiwinkel Das Land Vor Den Bergen
Rupertiwinkel Das Land vor den Bergen Perle der Alpen Rupertiwinkel Bad Reichenhall Berchtesgaden Königssee www.bglt.de/rupertiwinkel Salzachschleife in Laufen mit Blick auf die Chiemgauer Alpen. Rupertiwinkel Inhaltsverzeichnis Im südöstlichsten Teil Bayerns, zwischen Chiemsee, Marktplätze, Kirchen, Klöster und Baudenkmäler zeugen von Königssee und der Mozartstadt Salzburg, liegt der der reichen Vergangenheit der Region, die schon von den 3 Vorwort Rupertiwinkel im Landkreis Berchtesgadener Land. Erst 1810 Römern besiedelt wurde. 4–5 Anger kam die Region zum Königreich Bayern, davor gehörte sie 6–7 Freilassing über ein Jahrtausend lang zu Salzburg. Sie erhielt ihren Der Rupertiwinkel bietet vor allem auf Bauernhöfen und 8–9 Laufen Namen vom Heiligen Rupertus, Salzburgs erstem Bischof. in Pensionen zahlreiche familiengerechte Unterkünfte 10–11 Piding Der Landstrich mit voralpinem Charakter ist bäuerlich an. Ein vielseitiges Radwegenetz führt durch die 12–13 Saaldorf-Surheim geprägt, hat alte Traditionen bewahrt und hält diese Landschaft, immer mit atemberaubendem Blick auf die 14–15 Teisendorf bei christlichen Festen und Brauchtumsveranstaltungen mächtigen Berchtesgadener Alpen. Liebliche Almen 16–17 Regionalität lebendig. Das Berchtesgadener Land mit dem Rupertiwinkel laden zu gemütlichen Wanderungen mit Einkehr ein, 18–19 Sanfte Bewegung bildet die einzige alpine UNESCO-Biosphärenregion in die familienfreundlichen Radwege sind gesäumt von 20–21 Bergerlebnis Berchtesgaden Deutschland. Diese weltweit geltende Auszeichnung nimmt Bauernhäusern -

Bad Reichenhall Zentral Im Berchtesgadener Land
Nachhaltigkeit Bad Reichenhall Zentral im Berchtesgadener Land Alpine Pearls Ausgabe 2020 Bad Reichenhall ist Gründungsmitglied des internationalen Netzwerks „Alpine Pearls“ für nachhaltigen Tourismus und sanfte Mobilität im Alpenraum. Wie eine Perlenkette spannen sich 21 Urlaubsorte über den gesamten Alpenbogen über Deutschland, Österreich, Italien, Slowenien und die Schweiz. Laufen Bad Reichenhall und Berchtesgaden sind die einzigen Vertreter aus Deutschland. Biosphärenregion Berchtesgadener Land Saaldorf-Surheim Die Biosphärenregion BGL ist das einzige alpine UNESCO Biosphärenreservat in Deutschland. München Teisendorf 110 km Freilassing Der Mensch steht dabei als wichtigster Landschaftsgestalter und –erhalter im Mittelpunkt. Die A8 einzigartige und artenreiche Landschaft soll als natürliches und kulturelles Erbe erhalten Chiemsee Anger B20 werden. So soll eine Modellregion für nachhaltiges Wirtschaften entstehen – zum Wohle 25 km A1 der jetzigen und kommenden Generationen und im vollen Bewusstsein der sozialen, Piding (A) Salzburg ökologischen und ökonomischen Verantwortung. A10 Bad Reichenhall Ö S TERREI C H Bayerisch Gmain Marktschellenberg B21 B305 Deutsche Alpenstraße Bischofswiesen B305 Rossfeld- Berchtesgaden Höhenring- Straße B20 Schönau a. Königssee Ramsau Nationalpark Berchtesgaden Deutschland Königssee München Salzburg Berchtesgadener Land Beste Infrastruktur Stadtmarketing Bad Reichenhall • Verlässliche kommunale Rahmenbedingungen Berchtesgadener Land Tourismus GmbH • Hohe Wohn- und Lebensqualität Ansprechpartnerin: Dr. -

Bad Reichenhall Zentral Im Berchtesgadener Land
Bad Reichenhall Zentral im Berchtesgadener Land Laufen Saaldorf-Surheim München Teisendorf 110 km Freilassing A8 Chiemsee Anger B20 25 km A1 Piding (A) Salzburg A10 Bad Reichenhall Ö S TERREI C H Bayerisch Gmain Marktschellenberg B21 B305 Deutsche Alpenstraße Bischofswiesen B305 Rossfeld- Berchtesgaden Höhenring- Straße B20 Schönau a. Königssee Ramsau Nationalpark Berchtesgaden Deutschland Königssee München Salzburg Berchtesgadener Land Beste Infrastruktur Stadtmarketing in Bad Reichenhall • Verlässliche kommunale Rahmenbedingungen Berchtesgadener Land Tourismus GmbH • Hohe Wohn- und Lebensqualität Ansprechpartnerin: Dr. Brigitte Schlögl • Günstige Verkehrsanbindung Wittelsbacherstraße 15 • Flächendeckende Versorgung mit Glasfaseranbindung 83435 Bad Reichenhall • Zahlreiche Bildungseinrichtungen Tel. +49 (0) 8651 71511-12 • Hochschule für Duales Studium [email protected] • Breit gefächertes Kulturangebot www.bad-reichenhall.de/stadtmarketing • Nähe zu München und Salzburg Quellen: spürbar erfrischend www.bad-reichenhall.de/stadtmarketing Stadt Bad Reichenhall, Bayerisches Landesamt für Statistik, Strukturdaten der IKH-Regionalausschüsse Berchtesgadener Land (2017), FOCUS MONEY 52/1 (19.12.2018) – Landkreis-Ranking, Deutscher Städtetag, Bayerisches Staatsbad Bad Reichenhall Kur-GmbH Bad Reichenhall/Bayerisch Gmain, Michael Bauer Research GmbH, Wikipedia, Agentur für Arbeit, Stadtwerke Bad Reichenhall Foto: Thumsee: Thomas Kujat; Titelbild: Tom Lamm Bad Reichenhall Wirtschaft Bad Reichenhall Tourismus Bad Reichenhall im Berchtesgadener -

Atemberaubende Aussichten Und Tiefblicke Klettersteige · Berge · Alpen
Atemberaubende Aussichten und Tiefblicke Klettersteige · Berge · Alpen Perle der Alpen Rupertiwinkel Bad Reichenhall Berchtesgaden Königssee www.bglt.de Inhaltsverzeichnis Der Berg ruft! Glossar................................................ .3 Wie.eine.Perlenkette.umrahmen.die.neun.Gebirgsgruppen. der.Berchtesgadener.Alpen.den.Berchtesgadener.und.Bad. Reichenhaller.Talkessel..Jedes.dieser.Bergmassive.bietet. Klettersteige..............................4–11 einen.anderen.Charakter.und.entsprechend.vielseitig.ist. das.Tourenangebot:.von.der.einfachen.Talwanderung,. Bergsteige..............................12–14 über.genüssliche.Alm-.und.Berghüttentouren.bis.hin.zu. alpinen.Bergtouren.und.Klettersteigen..Somit.bietet.sich. Alpinsteige.............................15–17 die.Region.als.idealer.Ausgangspunkt.für.eine.ausgefüllte. Berg-.und.Klettersteigwoche.an..Besonders.die.Steige. im.Süden.des.Landkreises.zeigen.durch.ihre.Lage.im. Verhaltensregeln.......................... .18 einzigen.Alpen.Nationalpark.Deutschlands.wie.mächtig,. wild.und.wunderschön.die.Natur.ist..In.dieser.einzigartigen.. Regionskarte...................................U3 Hochgebirgslandschaft.rund.um.Watzmann.und.Königssee. finden.zahlreiche.Tier-.und.Pflanzenarten.ein.Zuhause..Die. Sicherung.der.Steige.ermöglichen.in.Bereiche.vorzudringen,. die.gewöhnlich.nur.den.Gämsen.und.Steinböcken.vorbehalten. sind..Zum.Schutz.dieser.einmaligen.Landschaft.bitten.wir. Sie,.die.allgemeinen.Verhaltensregeln.einzuhalten.und.um. eine.erlebnisreiche.bzw..unfallfreie.Zeit.in.der.Bergwelt.des. -

Sparkasse Feiert Den Weltspartag Rund 15.000 Euro Wurden an Fußballvereine Und Schulen Übergeben
Pressemeldung Nr. 55/2019 vom: 31.10.2019 Die Spendenübergabe an die Vereine mit ihren Vertretern von links: Vorstandsvorsitzender der Sparkasse BGL Helmut Grundner, Reinhard Köck (JFG Teisenberg), Stefan Kern (SV Saaldorf), Stefan Fritzenwenger (Initiator der Sparkassen-Pokal-Turnierserie), Andreas Reichenberger (JFG Hochstaufen/ASV Piding), Werner Obermayer (SV Laufen), Daniel Burr (SV Leobendorf), Andreas Graßl (SG Scheffau-Schellenberg), Thomas Pfeilschifter (TSV Bad Reichenhall), Andreas Maltan (FC Bischofswiesen), Manfred Hajek (TSV Berchtesgaden), Richard Kühnhauser (SG Schönau) und Vorstandsmitglied Christian Maltan. Sparkasse feiert den Weltspartag Rund 15.000 Euro wurden an Fußballvereine und Schulen übergeben Welche Bedeutung hat ein Weltspartag in Zeiten ohne Zinsen? Eine große sogar, meint Dr. Ulrich Netzer, Präsident des Sparkassenverbands Bayern: „Tot gesagte leben bekanntlich länger! Und das mit Recht, denn beim Sparen geht es in erster Linie darum, Geld für später zurückzulegen. Nur wenn man etwas in den Beutel hineingelegt hat, kann man es auch wieder herausnehmen.“ Der Weltspartag hat eine lange Tradition. Ursprünglich war dieser Tag der Förderung des Spargedankens gewidmet. Heute spiegelt er das zunehmende Bewusstsein für finanzielle Bildung und Finanzerziehung wider. Die Sparkasse Berchtesgadener Land nimmt den Aktionstag jedes Jahr zum Anlass, zusätzlich gemeinnützige Einrichtungen im Landkreis zu unterstützen. Die Sparkasse Berchtesgadener Land hat im Herbst 2018 ihre Spendenplattform „Meine Sparkasse bewegt“ gestartet. Ziel der neuen Online-Plattform ist es, Kunden aktiv bei der Spendenvergabe mit einzubinden und mitbestimmen lassen, welche regionale Projekte gefördert werden. In diesem Jahr wurden alle Fußballvereine, die bei den 40. Sparkassen- Pokal-Turnieren teilgenommen haben, aufgerufen, ein Herzensprojekt ihres Vereins vorzuschlagen. Elf regionale Fußballvereine ließen sich die Gelegenheit nicht entgehen und haben sich über die Spendenplattform www.meine-sparkasse-bewegt.de beworben. -

ESPON CPS 07 Scientific Report Annex IV Salzburg
Cross-border Public Services (CPS) Targeted Analysis Final Report Scientific Report – Annex IV Case study report – EuRegio Salzburg- Berchtesgadener Land-Traunstein Version 16/11/2018 This targeted analysis is conducted within the framework of the ESPON 2020 Cooperation Programme, partly financed by the European Regional Development Fund. The ESPON EGTC is the Single Beneficiary of the ESPON 2020 Cooperation Programme. The Single Operation within the programme is implemented by the ESPON EGTC and co-financed by the European Regional Development Fund, the EU Member States and the Partner States, Iceland, Liechtenstein, Norway and Switzerland. This delivery does not necessarily reflect the opinions of members of the ESPON 2020 Monitoring Committee. Authors Stumm, Thomas (EureConsult) Advisory Group ESPON EGTC Nicolas, Rossignol Technical Support Schürmann, Carsten (TCP international) Acknowledgements Steffen Rubach, director of the EuRegio Salzburg-Berchtesgadener Land-Traunstein Information on ESPON and its projects can be found on www.espon.eu. The web site provides the possibility to download and examine the most recent documents produced by finalised and ongoing ESPON projects. This delivery exists only in an electronic version. © ESPON, 2018 Printing, reproduction or quotation is authorised provided the source is acknowledged and a copy is forwarded to the ESPON EGTC in Luxembourg. Contact: [email protected] Cross-border Public Services (CPS) Final Report Scientific Report – Annex IV Case study report – EuRegio Salzburg- Berchtesgadener -

Aktiv & Gesund
aktiv & gesund Spürbar erfrischend … herzlich willkommen Mit dem exklusiven zu „Gesund & Aktiv“ in Bad Reichenhall! Die Alpenstadt bietet zu allen Jahreszeiten Bad Reichenhall-Hand- erfrischende Ideen für drinnen und draußen, von Wandertipps und Radtouren bis tuch sind Sie stets ver- hin zur entspannten Auszeit mit AlpenSole. Einige der schönsten Erlebnisse für sorgt. Gut getrocknet zu das Wohlbefinden stellen wir in diesem Heft vor. neuen Abenteuern in der Alpenstadt! Genießen Sie Ihren sorgenfreien Urlaub in Bad Reichenhall und atmen Sie durch in frischer Alpenluft. Diese und weitere Ideen gibt es im Shop der Berch tesgadener Land Touris mus und in der Tou- in bewegung bleiben rist-Info Bad Reichenhall: Wandern in und um Bad Reichenhall 6 Kuscheldecken, Salzmüh- Abenteuer auf zwei Rädern 16 len „Bier & Salz, Stock- Laufen und Joggen inkl. Tourenvorschlägen 24 nägel, Regenschirme, Spazierengehen – die schönsten Strecken 28 Andenken und mehr … Online unter: bgl-shop.de/bad-reichenhall auf den spuren des wassers bad-reichenhall.de/shop Spürbar erfrischend 32 Der Thumsee 34 Tourist-Info Bad Reichenhall Freibad Marzoll 35 Wittelsbacherstr. 15 / 83435 Bad Reichenhall Spa & Familienresort RupertusTherme 36 T +49 8651 71511-0 / [email protected] Winterzauber Wintersport, Rodeln und Winterwandern 38 IMPRESSUM Der Predigtstuhl 40 Herausgeber Berchtesgadener Land Tourismus GmbH (BGLT) Konzeption: IDEENHAUS MARKEN.WERT.STIL München/Nürnberg gesund und sorgenfrei Layout und Satz: MIKADO Marketing Kommunikation GmbH Kartenmaterial: GL Werbestudio Entspannt durchatmen 44 Druck: Druckerei Plenk, Berchtesgaden AlpenSole 46 Fotos: Thomas Kujat, Dietmar Denger, Tom Lamm, Kur-GmbH Stand/Auflage: April 2020/25.000 Entspannte Auszeit 48 Titelbild: Thumsee Musik tut gut 50 Irrtum und Änderungen vorbehalten! Nachdruck, auch auszugsweise, nicht gestattet! Die Gesundheits-Concierges 52 Kontakt Berchtesgadener Land Tourismus GmbH / Wittelsbacher Str. -

Discover Großgmain
Discover Großgmain www.grossgmain.info 1 Welcome! List of contents 4 Discover Großgmain A charming rural village and the perfect holiday destination 6 Marienwallfahrtskirche “The Beautiful Madonna” · The Untersberg Pilgrim Path 7 Marienheilgarten Nature in its purest form - discover flora and fauna on the Untersberg 8 Plainburg One of the oldest castle ruins in Austria 9 Untersberg Nature Park Nature in its purest form - discover flora and fauna on the Untersberg 10 Map Großgmain and surrounding area at a glance 12 The Master of Großgmain Late Gothic panel paintings dating back to the 15th Century 13 Josef Meinrad & Cesar Bresgen Legendary actor & passionate composer 14 Traditions & customs Traditional costume parades, Corpus Christi procession & “Krampus Runs”. 16 Sport & Leisure Summer and winter sport · Großgmain outdoor swimming pool 18 Salzburg Open Air Museum Depicting rural life through the centuries 20 Places to visit in Salzburg and Berchtesgadener Land 2 3 Discover Großgmain Großgmain, situated near the state capital city of Salzburg and directly on the border with Bavaria, is a charming village in the heart of the countryside and is very proud of its agricultural roots. It is also the perfect holiday destination. The term „Auf der Gmain“ (on the Gmain), was formerly used to describe the farms and farmhouses spaciously scattered along the foothills of the spectacular Untersberg Mountain and also the 700-year-old settlements on either side of the Weißbach River - Großgmain in Austria and Gmain in Bavaria. Today, Großgmain provides the perfect starting point for visitors wishing to discover the area. Salzburg, Bad Reichenhall and Berchtesgaden can be easily reached in just 20 minutes. -

Wanderkarte Anger1.75 MB
www.anger.de [email protected] 22 9- 8 8 9 8656 49 + T Den wirtschaftlichen, kulturellen und geistig religiösen Mittelpunkt der wende, Almabtrieb um den Michaelitag, Weihnachts- und Silvesterschießen. Gasthaus Mayerhofen Ausflugsfahrten Anger 83454 4, Dorfplatz % lcx Gegend bildete vom frühen 12. Jahrhundert bis 1817 das Augustiner-Chor- Daneben gibt es die schönen alten Volkstänze, die kräftigen Schuhplatt- Salzstraße 60, Anger, (08656) 282 Wochenprogramm bei der Tourist-Info erhältlich, Anger Tourist-Information ANGER % herrenstift Höglwörth, das seine Grundherrschaft über die Jahrhunderte ler, die wundervolle, kleidsame Tracht, die angestammte bauweise der Häu- Gasthaus Klosterwirt (08656) 988922 GESCHICHTE ser, die Mundart und die große Liebe zur Musik. ! UN S AN JEDERZEIT FRAGEN ausbaute, und dessen Einkünfte in hohem Maße auf dem umfangreichen Höglwörther Straße 21, Anger, % (08656) 255 lcx Ausflüge MIT Waldbesitz beruhten, der sich bis zum Kamm des 1.300 m hohen Teisen- SICH SEI WENDEN Durch seine zentrale Lage im Berchtesgadener Land eignet sich Anger BITTE Die Gründung des Ortes reicht in die vorgeschichtliche Zeit zurück. Krepfei Bistro.Bar bergs erstreckte. besonders als Ausgangspunkt für Ausflüge. Von hier aus lassen sich Der Bergrücken des Högl, der sich am linken Ufer der Saalach bis in 827 Salzstraße 14, Anger, % (08656) 2086016 l x Seelsorgerisch betreute das Stift das Gebiet der Pfarrei Anger (Ölberg- bequeme Tagesausflüge mit Bus oder PKW sowohl zu den vielen Se- m Seehöhe erhebt, war seit der jüngsten Steinzeit besiedelt. Zahlreiche skirchen) mit den Filialen Steinhögl, St. Johannshögl, Aufham sowie das Vi- Landhotel Prinz henswürdigkeiten als auch in die Städte München, Salzburg, Wien usw. Funde wie Bronzeschwerter, Äxte und Urnen, aber auch Reste römischer ANGER kariat Piding.