Kriegsgeschädigte Auslandschweizer in Der Nachkriegszeit 1945-1961
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
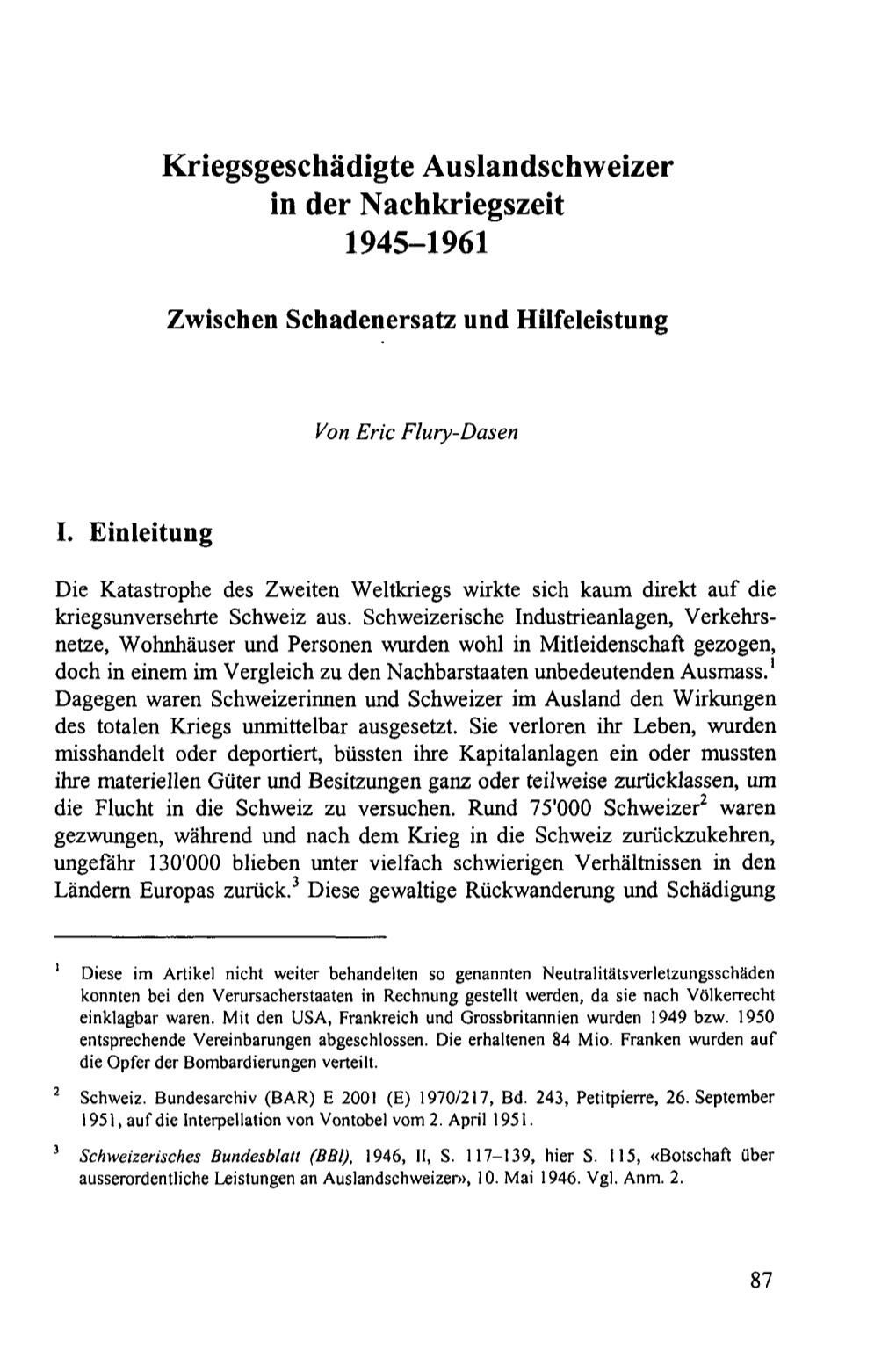
Load more
Recommended publications
-

Bundesräte Und Ihre Herkunft in Hundert Jahren
Das Schweizervolk und seine Magistraten : Bundesräte und ihre Herkunft in hundert Jahren Autor(en): H.B. Objekttyp: Article Zeitschrift: Die Schweiz = Suisse = Svizzera = Switzerland : offizielle Reisezeitschrift der Schweiz. Verkehrszentrale, der Schweizerischen Bundesbahnen, Privatbahnen ... [et al.] Band (Jahr): - (1948) Heft 6 PDF erstellt am: 02.10.2021 Persistenter Link: http://doi.org/10.5169/seals-776311 Nutzungsbedingungen Die ETH-Bibliothek ist Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Inhalten der Zeitschriften. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern. Die auf der Plattform e-periodica veröffentlichten Dokumente stehen für nicht-kommerzielle Zwecke in Lehre und Forschung sowie für die private Nutzung frei zur Verfügung. Einzelne Dateien oder Ausdrucke aus diesem Angebot können zusammen mit diesen Nutzungsbedingungen und den korrekten Herkunftsbezeichnungen weitergegeben werden. Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen ist nur mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. Die systematische Speicherung von Teilen des elektronischen Angebots auf anderen Servern bedarf ebenfalls des schriftlichen Einverständnisses der Rechteinhaber. Haftungsausschluss Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr für Vollständigkeit oder Richtigkeit. Es wird keine Haftung übernommen für Schäden durch die Verwendung von Informationen aus diesem Online-Angebot oder durch das Fehlen von Informationen. Dies gilt auch für Inhalte Dritter, die über dieses Angebot zugänglich sind. Ein Dienst der ETH-Bibliothek ETH Zürich, Rämistrasse 101, 8092 Zürich, Schweiz, www.library.ethz.ch http://www.e-periodica.ch Das Schweizervolk und seine Magistraten Bundesräte und ihre Herkunft in hundert Jahren Wer die Geschichte der Schweiz studiert, und sein Vater wurde zum Schullehrer Lehrer, Beamte, Kaufleute, Handwerker, Müller, stößt häufig auf die gleichen Namen und bestimmt. -

An Unfinished Debate on NATO's Cold War Stay-Behind Armies
The British Secret Service in Neutral Switzerland: An Unfinished Debate on NATO’s Cold War Stay-behind Armies DANIELE GANSER In 1990, the existence of a secret anti-Communist stay-behind army in Italy, codenamed ‘Gladio’ and linked to NATO, was revealed. Subsequently, similar stay-behind armies were discovered in all NATO countries in Western Europe. Based on parliamentary and governmental reports, oral history, and investigative journalism, the essay argues that neutral Switzerland also operated a stay-behind army. It explores the role of the British secret service and the reactions of the British and the Swiss governments to the discovery of the network and investigates whether the Swiss stay-behind army, despite Swiss neutrality, was integrated into the International NATO stay-behind network. INTRODUCTION During the Cold War, secret anti-Communist stay-behind armies existed in all countries in Western Europe. Set up after World War II by the US foreign intelligence service CIA and the British foreign intelligence service MI6, the stay-behind network was coordinated by two unorthodox warfare centres of the North Atlantic Treaty Organisation (NATO), the ‘Clandestine Planning Committee’ (CPC) and the ‘Allied Clandestine Committee’ (ACC). Hidden within the national military secret services, the stay-behind armies operated under numerous codenames such as ‘Gladio’ in Italy, ‘SDRA8’ in Belgium, ‘Counter-Guerrilla’ in Turkey, ‘Absalon’ in Denmark, and ‘P-26’ in Switzerland. These secret soldiers had orders to operate behind enemy lines in -

When Switzerland Recognised the New China
DIPLOMATIC HISTORY When Switzerland recognised the new China By Andrea Tognina JAN 17, 2020 - 12:20 Seventy years ago, Switzerland was one of the first Western nations to officially recognise the People’s Republic of China – a gesture that enabled Bern to maintain good relations with the Communist government in Beijing over the following decades. It also meant access to the opening of the Chinese economy at the end of the 1960s. A Chinese military delegation arrives in Geneva for the conference on Indochina, 1954. (Keystone / Jean-jacques Levy) “[The Swiss government] has today de jure recognised the central government of the People’s Republic of China, with whom it will soon establish diplomatic relations stop […]” That was a telegram sent by the Swiss president Max Petitpierre to his Chinese counterpart Mao Zedong on January 17, 1950. On October 1, 1949, a few days after the proclamation establishing the People’s Republic of China, the government in Beijing wrote to Bern with the aim of establishing diplomatic relations. The initial reaction of authorities in the Swiss capital was probably influenced by the tensions that had characterised relations with another major communist country, the Soviet Union. Diplomatic Documents of Switzerland EThis article is part of a series dedicated to the history of Swiss diplomacy, written in collaboration with the Diplomatic Documents of Switzerland (Dodis). The Dodis research centre, an institute of the Swiss Academy of Humanities and Social Sciences, is an independent pole specialising in the history of Swiss foreign policy and international relations since the foundation of the state in 1848. -

Swiss Intellectuals and the Cold War Anti-Communist Policies in a Neutral Country
Swiss Intellectuals and the Cold War Anti-Communist Policies in a Neutral Country ✣ Hadrien Buclin Nowadays many Swiss citizens would be surprised to learn that in the 1950s some Swiss journalists and lecturers were sentenced to prison or lost their jobs because of “thought crimes.” The 1950s are generally remembered as the time of the “Swiss economic miracle”—with the construction of high- ways and large hydroelectric dams—rather than of strong political con- frontation. The picture of a neutral country does not really mesh with the evocation of anti-Communist restrictions. What can explain the strength of Swiss Cold War policies in the 1950s—policies that left their mark on many aspects of political and cultural life in the country? Exactly what form did such official anti-Communism take in a neutral country like Switzerland, and how did it fit with other Western countries’ anti-Communist policies? Was Switzerland an exception, or can parallels be established with other neu- tral European states—in particular, Sweden, a small neutral country in many ways similar to Switzerland? These are just some of the questions this article addresses. The legal barriers facing Swiss Communist intellectuals during the early Cold War have been underexamined in the current historiography and are in need of reassessment. The legal proceedings were specifically motivated by the Swiss government’s determination to defend a slick image of neutrality against severe criticism from the Communist states, which accused Switzer- land of covertly allying with the Western camp. Two Swiss Communists were sentenced for slander, and their trials are emblematic of how a neutral coun- try coped with the Western anti-Communist battle. -

Inhaltsverzeichnis
Inhaltsverzeichnis 7 Vorwort und Dank Hinweise zur Benützung des Lexikons 17 Der schweizerische Bundesrat auf dem langen Weg zur Konkordanzdemokratie Einführung von Urs Altermatt Porträts der Bundesrätinnen und Bundesräte 30 1848-1874 Jonas Furrer 31 - Ulrich Ochsenbein 38 - Henri Druey 44 - Josef Munzinger 51 - Stefano Franscini 57 - Friedrich Frey-Herose 63 - Wilhelm Matthias Näff 69 - Jakob Stämpfli 74 - Constant Fornerod 81 - Josef Martin Knüsel 88 - Giovanni Battista Pioda 93 - Jakob Dubs 99 - Carl Schenk 105 - Jean-Jacques Challet-Venel 112 - Emil Welti 118 - Victor Ruffy 125 - Paul Ceresoie 130 - Johann Jakob Scherer 136 - Eugene Borei 142 147 1875-1918 Joachim Heer 147 - Friedrich Anderwert 152 - Bernhard Hammer 157 - Numa Droz 163 - Simeon Bavier 169 - Wilhelm Friedrich Hertenstein 173 - Louis Ruchonnet 177 - Adolf Deucher 183 - Walter Hauser 189 - Emil Frey 193 - Josef Zemp 200 - Adrien Lachenal 206 - Eugene Ruffy 211 - Eduard Müller 216 - Ernst Brenner 222 - Robert Comtesse 227 - Marc Ruchet 233 - Ludwig Forrer 240 - Josef Anton Schobinger 246 - Arthur Hoffmann 250 - Giuseppe Motta 257 - Louis Perrier 264 - Camille Decoppet 269 - Edmund Schulthess 275 - Felix Calonder 282 - Gustave Ador 289 - Robert Haab 296 301 1919-1958 Karl Scheurer 301 - Ernest Chuard 306 - Jean-Marie Musy 312 - Heinrich Häberlin 319 - Marcel Pilet-Golaz 325 - Rudolf Minger 331 - Albert Meyer 338 - Johannes Baumann 344 - Philipp Etter 349 - Hermann Obrecht 356 - Ernst Wetter 361 - Enrico Celio 366 - Walther Stampfli 371 - Edmund von Steiger 377 - Karl Kobelt 383 - Ernst Nobs 389 - Max Petitpierre 393 - Rodolphe Rubattel 400 - Josef Escher 407 - Markus Feldmann 412 - Max Weber 417 - Hans Streuli 423 - Thomas Holenstein 429 - Paul Chaudet 434 - Giuseppe Lepori 440 - Friedrich T. -

Gedenkblatt 43. Legislatur
DREIUNDVIERZIGSTE LEGISLATURPERIODE vom 30. November 1987 bis 25. November 1991 Namensverzeichnisse der Mitglieder der Eidgenössischen Räte, des Bundesrates und des Bundesgerichtes Zusammenfassende Listen Verschiedene Angaben über die Bundesbehörden QIJARANTE-TROISIEME LEGISLATURE du 30 novembre 1987 au 25 novembre 1991 Etat nominatif des membres des Chambres fd&ales, du Conseil fdral et du Tribunal fdral Listes röcapitufatives Donnöes diverses sur les autoritös födörales HERAUSGEGEBEN VON DEN PARLAMENTSDIENSTEN PUBLIE PAR LES SERVICES DU PARLEMENT 1992 3.23 NATIJNALRAT CCNSE1 L TiONA santerneerJng cm 7.‘8. Cur 987 nu :erge Erse:zj Fern 1nment ntra1 des ‘S cctote 87 an aceerts 7eicrenerk1ä‘rrg — Fx icacnn des signes = Fresinnigdemokratische Fraknion Era:ion ccs Landesrrgs der Groupe radica-drrocratiue nabhängigen und der Eange1ischen Uni Kspartei 5 = Sozialdemokratische Fraktion Gronpe ne 1 A1iiarce ccs InJpen- Groupe socialiste dants et du Parti vong1ique popul ai re C = CHrstiichdemokratische rrakticn Groupe dmccrate—chrtien G = GrLine Fraktion Groupe dcologiste V = Fraktion der Schweizerischen Voikspartei L = Liberale Fraktion Groupe de 1 Union dmocratique Groupe libral du Centre = ohre Fraktionszugehörigkeit non inscrit Frak- Mitglied seit - tion Kanton und Name — Canton et rom membre ds Groupe Z U E R 1 J‘ sarh Ha z, Cn‘e ‘j dir< • - . Tr Lss ‘3 . Cracer, ; hø r 7 r Dcfru ieot: or1ozoqtrae ‘4 ‘4 ____ _____ ____ -2 -r ——-—-- -i -— litgi4eJ seit :SrtrseC L::sz, 3ase‘, in roe dorf Zrcsgetrete :sssc r33. Ersetzt curLn: 8 LeeEa‘ rsia, z, ‘3re:ri izb, i-;ers, 8eegerte, ‚an ricn, n Zoll jfl R Cincera Errst, GrafKer, or und n Zürcb 1983, XI 0 ener Verena, riausfrau/Legasteietherapejtn, von Wintertrur, in Buch a. -

Umstrittene Reisediplomatie
Umstrittene Reisediplomatie Autor(en): Kreis, Georg Objekttyp: Article Zeitschrift: Schweizer Monatshefte : Zeitschrift für Politik, Wirtschaft, Kultur Band (Jahr): 59 (1979) Heft 3 PDF erstellt am: 11.10.2021 Persistenter Link: http://doi.org/10.5169/seals-163527 Nutzungsbedingungen Die ETH-Bibliothek ist Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Inhalten der Zeitschriften. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern. Die auf der Plattform e-periodica veröffentlichten Dokumente stehen für nicht-kommerzielle Zwecke in Lehre und Forschung sowie für die private Nutzung frei zur Verfügung. Einzelne Dateien oder Ausdrucke aus diesem Angebot können zusammen mit diesen Nutzungsbedingungen und den korrekten Herkunftsbezeichnungen weitergegeben werden. Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen ist nur mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. Die systematische Speicherung von Teilen des elektronischen Angebots auf anderen Servern bedarf ebenfalls des schriftlichen Einverständnisses der Rechteinhaber. Haftungsausschluss Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr für Vollständigkeit oder Richtigkeit. Es wird keine Haftung übernommen für Schäden durch die Verwendung von Informationen aus diesem Online-Angebot oder durch das Fehlen von Informationen. Dies gilt auch für Inhalte Dritter, die über dieses Angebot zugänglich sind. Ein Dienst der ETH-Bibliothek ETH Zürich, Rämistrasse 101, 8092 Zürich, Schweiz, www.library.ethz.ch http://www.e-periodica.ch Georg Kreis Umstrittene Reisediplomatie Die Aussenpolitik macht wieder von sich reden. Während innenpolitische Fragen dauernd Aufmerksamkeit beanspruchen können, wendet sich unser Interesse bloss sporadisch der kontinuierlich geführten Aussenpolitik zu. Ausgelöst wird diese plötzliche Aufmerksamkeit vor allem durch die Auslandreisen, die den Chef des Politischen Departementes jeweils aus der Stille seiner diskreten Tätigkeit in die laute Öffentlichkeit treten lassen. -

Max Huber and the Red Cross
The European Journal of International Law Vol. 18 no. 1 © EJIL 2007; all rights reserved .......................................................................................... Max Huber and the Red Cross Yves Sandoz * Abstract Max Huber’s exceptional academic, diplomatic and judicial career prepared him well for his role as president of the ICRC. Huber assumed the presidency in 1928, thereby taking on the heavy burden of piloting the institution during one of the worst periods of history, culminat- ing with the Second World War. In a time of great danger to the fundamental humanitarian values and the unity of the Red Cross, Max Huber played an outstanding role in better iden- tifying and defending the Red Cross principles, keeping the International Red Cross united and promoting humanitarian law. In spite of its important humanitarian activities, the ICRC was powerless to put a halt to the atrocities committed during the War and was subsequently criticized for having been too timid in denouncing them. This article traces Huber’s leader- ship of the ICRC and the important impact his ideas had on the direction of the organization. Max Huber will certainly remain as one of the greatest personalities in the entire history of the Red Cross. 1 Introduction If we were to judge by the number of years of his presidency, this article could easily have been entitled ‘ Max Huber as the Red Cross ’ , so close were the ties between the man and the institution for so many years. Huber had an intellect to be reckoned with; he not only produced a number of basic texts on international law but also numerous works on all aspects of the Red Cross, while serving at the same time as president of the International Committee of the Red Cross (ICRC) for many years, and hence playing a key role in the organization. -

International Review of the Red Cross, July 1961, First Year
INTERNATIONAL COMMITTEE OF THE RED CROSS Geneva LEOPOLD BOISSIER, Doctor of Laws, Honorary Professor at the University of Geneva, former Secretary-General to the Inter-Parliamentary Union, President (1946) 1 JACQUES CHENEVIERE, Hon. Doctor of Literature, Honorary Vice-President (1919) LUCIE ODIER, Former Director of the District Nursing Service, Geneva Branch of the Swiss Red Cross (1930) CARL J. BURCKHARDT, Doc~or of Philosophy, former Swiss Minister to France (1933) MARTIN BODMER, Hon. Doctor of Philosophy, Vice-President (1940) ERNEST GLOOR, Doctor of Medicine, Vice-President (1945) PAUL RUEGGER, former Swiss Minister to Italy and the United Kingdom, Member of the Permanent Court of Arbitration (1948), on leave RODOLFO OLGIATI, Hon. Doctor of Medicine, former Director of the Don Suisse (1949) MARGUERITE VAN BERCHEM, former Head of Section, Central Prisoners of War Agency (1951) FREDERIC SIORDET, Lawyer, Counsellor of the International Committee of the Red Cross from 1943 to 1951 (1951) GUILLAUME BORDIER, Certificated Engineer E.P.F., M.B.A. Harvard, Banker (1955) ADOLPHE FRANCESCHETTI, Doctor of Medicine, Professor of clinical ophthalmology at Geneva University (1958) HANS BACHMANN, Doctor of Laws, Assistant Secretary-General to the International Committee of the Red Cross from 1944 to 1946 (1958) JACQUES FREYMOND, Doctor of Literature, Director of the Graduate Institute of International Studies, Professor at the University of Geneva (1959) DIETRICH SCHINDLER, Doctor of Laws (1961) SAMUEL GONARD, Colonel Commandant of an Army Corps, former Professor at the Federal Polytechnical School (1961) HANS MEULI, Doctor of Medicine, Brigade Colonel, former Director of the Swiss Army Medical Service (1961) Direction: ROGER GALLOPIN, Doctor of Laws, Executive Director JEAN S. -

Switzerland – Second World War Schlussbericht Der Unabhängigen Expertenkommission Schweiz – Zweiter Weltkrieg
Final Report of the Independent Commission of Experts Switzerland – Second World War Schlussbericht der Unabhängigen Expertenkommission Schweiz – Zweiter Weltkrieg Rapport final de la Commission Indépendante d'Experts Suisse – Seconde Guerre Mondiale Rapporto finale della Commissione Indipendente d'Esperti Svizzera – Seconda Guerra Mondiale Final Report of the Independent Commission of Experts Switzerland – Second World War Members: Jean-François Bergier, Chairman Wladyslaw Bartoszewski Saul Friedländer Harold James Helen B. Junz (from February 2001) Georg Kreis Sybil Milton (passed away on 16 October 2000) Jacques Picard Jakob Tanner Daniel Thürer (from April 2000) Joseph Voyame (until April 2000) Independent Commission of Experts Switzerland – Second World War Switzerland, National Socialism and the Second World War Final Report PENDO Secretary General: Linus von Castelmur (until March 2001), Myrtha Welti (from March 2001) Scientific Project Management: Stefan Karlen, Martin Meier, Gregor Spuhler (until March 2001), Bettina Zeugin (from February 2001) Scientific-Research Adviser: Marc Perrenoud ICE Database: Development – Management: Martin Meier, Marc Perrenoud Final Report Editorial Team / Coordination: Mario König, Bettina Zeugin Production Assistants: Estelle Blanc, Regina Mathis Research Assistants: Barbara Bonhage, Lucas Chocomeli, Annette Ebell, Michèle Fleury, Gilles Forster, Marianne Fraefel, Stefan Frech, Thomas Gees, Frank Haldemann, Martina Huber, Peter Hug, Stefan Karlen, Blaise Kropf, Rodrigo López, Hanspeter Lussy, Sonja -

Max Huber 1874-1960
MAX HUBER 1874-1960 At the time of Max Huber's death, the Revue internationale paid a succession of moving tributes to someone who had given so much of himself to the Red Cross cause.1 His work as a thinker, jurist and man of action, first as a member, then as President and Honorary President of the ICRC, has been evoked. Reference will also shortly be made to this when we publish other contributions concerning personalities belonging to our movement. We have great pleasure in being able to publish this study on Max Huber's juridical activities outside the Red Cross. One can thus have a better picture of the whole man, his sweeping and productive intelli- gence, the continuous interest which he gave to problems of international conduct, and his struggle to ensure that human dignity was everywhere and at all times defended. And one can see even more clearly how his thought evolved, the deep forces to which it reacted and how he harmo- niously combined love of his own country with that of mankind. Professor Guggenheim, who was one of his friends, has kindly allowed us to publish this appraisal, for which we warmly thank him. (Editorial note). With the death on New Year's Day 1960 of Max Huber, who two days previously had reached the age of eighty-six, Switzerland lost one of her most outstanding exponents of international law since Emer de Vattel. He was given an impressive funeral in the Fraumiinster in Zurich at which, in accordance with his last wishes, the parish priest delivered the oration and this was followed by a tribute by Mr. -

Switzerland and the United States in World War II Matthew Chs Andler Louisiana State University and Agricultural and Mechanical College, [email protected]
Louisiana State University LSU Digital Commons LSU Master's Theses Graduate School 2005 The economics of neutrality: Switzerland and the United States in World War II Matthew chS andler Louisiana State University and Agricultural and Mechanical College, [email protected] Follow this and additional works at: https://digitalcommons.lsu.edu/gradschool_theses Part of the History Commons Recommended Citation Schandler, Matthew, "The ce onomics of neutrality: Switzerland and the United States in World War II" (2005). LSU Master's Theses. 815. https://digitalcommons.lsu.edu/gradschool_theses/815 This Thesis is brought to you for free and open access by the Graduate School at LSU Digital Commons. It has been accepted for inclusion in LSU Master's Theses by an authorized graduate school editor of LSU Digital Commons. For more information, please contact [email protected]. THE ECONOMICS OF NEUTRALITY: SWITZERLAND AND THE UNITED STATES IN WORLD WAR II A Thesis Submitted to the Graduate Faculty of the Louisiana State University and Agricultural and Mechanical College In partial fulfillment of the Requirements for the degree of Master of Arts in The Department of History by Matthew Schandler B.A., Union College, 2003 December 2005 TABLE OF CONTENTS ABSTRACT ……………………………………………………………………………..iii CHAPTER 1 THE UNIQUE FEATURES OF SWITZERLAND…………………………..…1 2 THE ECONOMIC WAR BEGINS ……………..………………………...…...40 3 THE SOURING OF SWISS-AMERICAN RELATIONS …..………..............89 4 SWITZERLAND IN THE POSTWAR ERA …………..…………………... 114 BIBLIOGRAPHY ……………………………………………………………………...135 VITA …………………………………………………………………………………...141 ii ABSTRACT The following study addresses the contentious issue of Swiss economic policy during the Second World War. In particular, it concentrates on the deterioration of Swiss-American relations that resulted from Switzerland’s economic ties to Nazi Germany.