I M N a M E N D E R R E P U B L I
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
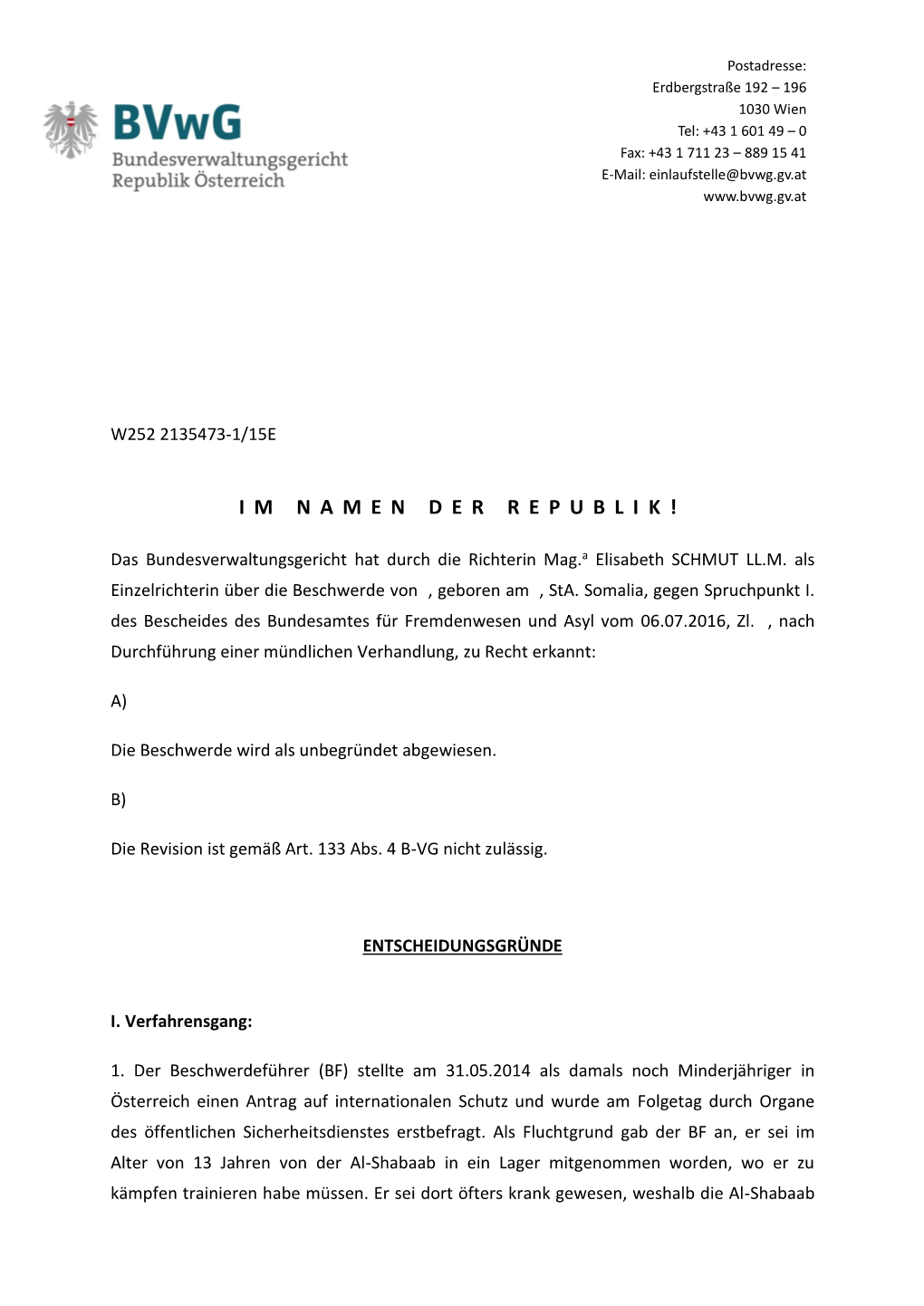
Load more
Recommended publications
-

AFRICA Somaliland: Peaceful Elections in an Unrecognized Country
AFRICA Somaliland: Peaceful Elections in an Unrecognized Country OE Watch Commentary: No country recognizes Somaliland’s claim to sovereignty. However, Source: Omar S. Mahmood, as the accompanying article notes, with yet another “presidential election” just completed (the “Somaliland’s New President Has Work third in 14 years), the self-declared country is hoping its peaceful transition of power will garner to Do,” Institute for Security Studies additional international respect and perhaps even the recognition it so desires. (South Africa), 10 January 2018. https:// For many this Somaliland election was particularly noteworthy. Besides a successful issafrica.org/iss-today/somalilands-new- voter registration effort that for the first time ever used an iris-scanner system in Africa, the president-has-work-to-do unrecognized nation also held its first ever presidential debate. This is not to say that Somaliland’s With the inauguration of Muse Bihi “democracy” is perfect. Its presidential election was postponed for two years, and personal Abdi on 13 December 2017, Somaliland’s tensions between the challengers, along with accusations of voter fraud, led to protests which oft-delayed presidential election led to three deaths. Despite these setbacks, the actual overall process was largely peaceful, and process officially ended. The Kulmiye international observers declared there were no significant election day voting irregularities. party retained power, but the president Clan loyalty, as has happened in previous elections, largely shaped the voting. Isaaq sub-clans changed for the third time in 14 years Habar Awal and Habar Jeclo came together to provide Muse Bihi Abdi from the Peace, Unity, and – impressive for an unrecognized Development Party, also known as the Kulmiye Party, with the presidency. -

A Week in the Horn 19.1.2018 News in Brief President Dr. Mulatu
A Week in the Horn 19.1.2018 News in brief President Dr. Mulatu Teshome’s State Visit to Cuba The Sixth High-level Ethiopian-Egyptian Joint Ministerial Commission meets in Cairo Foreign Minister Dr. Workneh’s visit to Khartoum The 30th African Union Summit starts next week IGAD Revitalization to continue despite concern over at ceasefire violations Al-Shabaab continues to recruit 8-year-old children as fighters… …and the President of Somaliland in Ethiopia for a three-day working visit A UN Security Council briefing on Darfur News in Brief Africa and the African Union The 30th Summit of the African Union (AU) starts on Monday next week (January 22) with the opening of the Permanent Representatives’ Committee. This will be followed by the Ordinary Session of the Executive Council of Foreign Ministers on Thursday and Friday (January 25-26), and the 30th Ordinary Session of the Assembly of the Heads of State and Government of the African Union will take place on Sunday and Monday (January 28-29). The theme of this year’s Summit is: “Winning the Fight against Corruption: A Sustainable Path to Africa’s Transformation”. (See article) Ambassadors and Representatives of Member States of IGAD held an informal consultation meeting on Thursday (January 18) at the Ethiopian Ministry of Foreign Affairs. Chaired by Ethiopia’s State Minister for Foreign Affairs, Mrs. Hirut Zemene, the emphasized disappointment at violations of the Ceasefire Agreement, but underlined the next phase of the Revitalization Process, covering power sharing and transitional security arrangement would continue at the beginning of February. -

Gericht Entscheidungsdatum Geschäftszahl Spruch Text
12.10.2018 Gericht BVwG Entscheidungsdatum 12.10.2018 Geschäftszahl W254 2104666-1 Spruch W254 2104666-1/10E W254 2115448-1/8E W254 2153524-1/9E W254 2192540-1/7E W254 2110879-1/13E Schriftliche Ausfertigung des am 12.10.2018 mündlich verkündeten Erkenntnisses: IM NAMEN DER REPUBLIK! I. Das Bundesverwaltungsgericht hat durch die Richterin Dr.in Tatjana CARDONA als Einzelrichterin über die Beschwerden der 1) XXXX , geb. XXXX 2) XXXX , geb. XXXX , 3) XXXX , geb. XXXX , 4) XXXX , geb. XXXX , alle StA. Somalia und vertreten durch die ARGE Rechtsberatung, gegen die Spruchpunkte I. der Bescheide des Bundesamtes für Fremdenwesen und Asyl vom 1) 06.03.2015, Zl. XXXX , 2) 27.08.2015 Zl. XXXX , 3) 08.03.2017 Zl. XXXX , 4) 06.03.2018 Zl. XXXX , nach Durchführung einer mündlichen Verhandlung, zu Recht erkannt: A) Die Beschwerden werden als unbegründet abgewiesen. B) Die Revision ist nicht zulässig. II. Das Bundesverwaltungsgericht hat durch die Richterin Dr.in Tatjana CARDONA als Einzelrichterin über die Beschwerde des XXXX , geb. XXXX , StA. Somalia, vertreten durch ARGE Rechtsberatung, gegen Spruchpunkt I. des Bescheides des Bundesamtes für Fremdenwesen und Asyl vom 29.06.2015, Zl. XXXX , nach Durchführung einer mündlichen Verhandlung, beschlossen: A) Das Beschwerdeverfahren wird wegen Zurückziehung der Beschwerde eingestellt. B) Die Revision ist nicht zulässig. Text ENTSCHEIDUNGSGRÜNDE: www.ris.bka.gv.at Seite 1 von 17 Bundesverwaltungsgericht 12.10.2018 I. Verfahrensgang: Die Beschwerdeführerin XXXX (BF1) stellte am 04.07.2014 einen Antrag auf internationalen Schutz in Österreich. Bei ihrer Erstbefragung am selben Tag gab sie an, Probleme mit ihrer Familie wegen ihrer traditionellen Ehe zu haben. -

Warbixinta Xoghayaha Guud Ee Ku Saabsan Soomaaliya
United Nations S/2020/121 Security Council Distr.: General 13 February 2020 Original: English Situation in Somalia Report of the Secretary-General I. Introduction 1. The present report is submitted pursuant to paragraph 22 of Security Council resolution 2461 (2019) and paragraph 33 of Council resolution 2472 (2019) and provides updates on the implementation of those resolutions, including on the mandates of the United Nations Assistance Mission in Somalia (UNSOM) and the United Nations Support Office in Somalia (UNSOS). The report covers major developments in Somalia during the period 5 November 2019 to 4 February 2020. II. Political, security, and economic overview A. Political developments 2. Preparations for national elections in 2020 gradually proceeded, as the House of the People of the Federal Parliament of Somalia debated and agreed on the electoral bill and submitted it to the Upper House for further revision. On 27 November 2019, the ad hoc parliamentary committee mandated to review the bill had tabled its report to the House of the People following consultations, including with federal member states. On 28 December, the House of the People passed the bill, with 172 votes in favour, 5 against and 2 abstentions. On 2 January 2020, following the receipt of the electoral bill from the House of the People, the Speaker of the Upper House appointed a seven-member ad hoc committee to review it. Plenary debates on the report of the ad hoc committee are continuing. 3. The Federal Parliament passed some of the priority legislation identified in the Mutual Accountability Framework, including the Public Financial Management Act and the Company Act. -

1 Rev. 7 Project Name Joint Rule of Law Programme Total Budget As
SOMALIA UN MPTF PROGRAMME ANNUAL PROGRESS REPORT Period: 1 January – 31 December 2017 Project Name Joint Rule of Law Programme Gateway ID 00096486 (Security), 00096487 (Justice), 00098928 (Security Somaliland) and 00098929 (Justice Somaliland), 00104503 (Rehabilitation Pilot Project) Start date 27 May 2015 Planned end 30 June 2018 Lucien Vermeir (police) and Mitch Dufresne (Justice & Corrections) Focal Person [email protected]>; [email protected]; (Tel): +252 612 857 852 PSG 2: Security and 3: Justice Priority PSG 2 priority 1: Strengthen the capacity and accountability of state institutions to recover territory, stabilize and provide basic safety and security (policing component). PSG 3 priority 1. Key priority laws in the legal framework, including on the reorganization of the judiciary, are aligned with the Constitution and international standards; 2. Justice institutions to start to address the key grievances and injustices of Somalis; 3. More Somalis have access to fair and affordable justice. Milestone 1: Mechanisms to pay, train, equip and sustain the police and military established; 2: Improved command, control and communication of security institutions; 3: National Security Council established; 4: Legal and institutional frameworks reviewed and updated for oversight, fiduciary and operational accountability, to ensure regulated, effective and disciplined security institutions. Location Somalia: Benadir, Jubbaland (Kismayo), South West State (Baidoa), Galmudug, Hirshabelle, Puntland all regions, Somaliland all regions. Gender Marker 2 Total Budget as per ProDoc US$ 66,716,763 MPTF: US$ 39,737,572 PBF: US$2,109,143 Non MPTF sources: UNDP: US$3,023,092 Other: US14,604,194 1 Rev. 7 SOMALIA UN MPTF PUNO Report approved by: Position/Title Signature 1. -

Negotiations Between Somaliland and the Federal Government: Prospects of Success Or Failure
Situation Assessement | 30 June 2020 Negotiations between Somaliland and the Federal Government: Prospects of Success or Failure Unit for Political Studies Negotiations between Somaliland and the Federal Government: Prospects of Success or Failure Series: Situation Assessement 30 June 2020 Unit for Political Studies The Unit for Political Studies is the Center’s department dedicated to the study of the region’s most pressing current affairs. An integral and vital part of the ACRPS’ activities, it offers academically rigorous analysis on issues that are relevant and useful to the public, academics and policy-makers of the Arab region and beyond. The Unit for Political Studie draws on the collaborative efforts of a number of scholars based within and outside the ACRPS. It produces three of the Center’s publication series: Assessment Report, Policy Analysis, and Case Analysis reports. Copyright © 2020 Arab Center for Research and Policy Studies. All Rights Reserved. The Arab Center for Research and Policy Studies is an independent research institute and think tank for the study of history and social sciences, with particular emphasis on the applied social sciences. The Center’s paramount concern is the advancement of Arab societies and states, their cooperation with one another and issues concerning the Arab nation in general. To that end, it seeks to examine and diagnose the situation in the Arab world - states and communities- to analyze social, economic and cultural policies and to provide political analysis, from an Arab perspective. The Center publishes in both Arabic and English in order to make its work accessible to both Arab and non- Arab researchers. -

BTI 2020 Country Report — Somalia
BTI 2020 Country Report Somalia This report is part of the Bertelsmann Stiftung’s Transformation Index (BTI) 2020. It covers the period from February 1, 2017 to January 31, 2019. The BTI assesses the transformation toward democracy and a market economy as well as the quality of governance in 137 countries. More on the BTI at https://www.bti-project.org. Please cite as follows: Bertelsmann Stiftung, BTI 2020 Country Report — Somalia. Gütersloh: Bertelsmann Stiftung, 2020. This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License. Contact Bertelsmann Stiftung Carl-Bertelsmann-Strasse 256 33111 Gütersloh Germany Sabine Donner Phone +49 5241 81 81501 [email protected] Hauke Hartmann Phone +49 5241 81 81389 [email protected] Robert Schwarz Phone +49 5241 81 81402 [email protected] Sabine Steinkamp Phone +49 5241 81 81507 [email protected] BTI 2020 | Somalia 3 Key Indicators Population M 15.0 HDI - GDP p.c., PPP $ - Pop. growth1 % p.a. 2.8 HDI rank of 189 - Gini Index - Life expectancy years 56.7 UN Education Index - Poverty3 % - Urban population % 45.0 Gender inequality2 - Aid per capita $ 120.7 Sources (as of December 2019): The World Bank, World Development Indicators 2019 | UNDP, Human Development Report 2019. Footnotes: (1) Average annual growth rate. (2) Gender Inequality Index (GII). (3) Percentage of population living on less than $3.20 a day at 2011 international prices. Executive Summary The beginning of the review period saw a presidential election in Somalia. Mohamed Abdullahi Mohamed, commonly known by his nickname “Farmaajo,” was elected as new president in January 2017. -

Report on the Somaliland Presidential Election, 13Th November 2017
The Bartlett Development Planning Unit International Election Observation Mission The limits of consensus? Report on the Somaliland Presidential Election, 13th November 2017 by Michael Walls, Conrad Heine, Andrea Klingel, Carrie Goggin, Ahmed Farag, Susan Mwape with input from Rooble Mohamed and Short-Term Observers. dpu Development Planning Unit DPU http://www.bartlett.ucl.ac.uk/dpu/ If a hard copy is required, please contact the De- velopment Planning Unit (DPU) at the address at the bottom of the page. Institutions, organisations and booksellers should supply a Purchase Order when ordering a copy of this report. Where multiple copies are ordered, and the cost of postage and package is significant, the DPU may make a charge to cover costs. Copyright of this report lies with the authors and there are no restrictions on it being published elsewhere in any version or form. Graphics and layout: Luz Navarro Cover photograph: © Kate Stanworth The Bartlett The Bartlett The Bartlett Development Planning Unit | The Bartlett | University College London The Bartlett 34 Tavistock Square - London - WC1H 9EZ Tel: +44 (0)20 7679 1111 - Fax: +44 (0)20 7679 1112 - www.bartlett.ucl.ac.uk/dpu 1 International Election Observation Mission The limits of consensus? Report on the Somaliland Presidential Election, 13th November 2017 by Michael Walls, Conrad Heine, Andrea Klingel, Carrie Goggin, Ahmed Farag, Susan Mwape with input from Rooble Mohamed and Short-Term Observers. March 2018 Acknowledgements. We would like to express our help with transport, Saferworld (Abdijalil Dahir Afqarshe) appreciation to the Foreign and Commonwealth Office for providing additional observers, transport and for shar- (FCO) for providing the funding for the international elec- ing photographs taken by the photographer Kate Stan- tion observation mission and in particular to Rosie Tapper worth, and to the Maan-Soor Hotel for their flexibility and and Edward Prior for their support. -
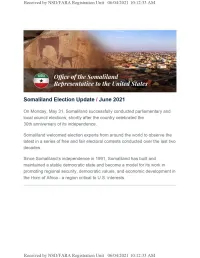
Somaliland Election Update / June 2021
Received by NSD/FARA Registration Unit 06/04/2021 10:12:33 AM ★ Somaliland Election Update / June 2021 On Monday, May 31, Somaliland successfully conducted parliamentary and local council elections, shortly after the country celebrated the 30th anniversary of its independence. Somaliland welcomed election experts from around the world to observe the latest in a series of free and fair electoral contests conducted over the last two decades. Since Somaliland’s independence in 1991, Somaliland has built and maintained a stable democratic state and become a model for its work in promoting regional security, democratic values, and economic development in the Horn of Africa - a region critical to U.S. interests. Received by NSD/FARA Registration Unit 06/04/2021 10:12:33 AM Received by NSD/FARA Registration Unit 06/04/2021 10:12:33 AM Muse Bihi Abdi, President of Somaliland Muse Bihi Abdi O @musebiihi This morning, I cast my vote in the country's first combined Parliamentary & Local Council Elections at a polling station in the Civil Service Commission in Hargeisa. Somaliland votes for peace. It is an honour for our people and the Horn of Africa. #SomalilandElections2021 Received by NSD/FARA Registration Unit 06/04/2021 10:12:33 AM Received by NSD/FARA Registration Unit 06/04/2021 10:12:33 AM Ernest Bai Koroma, Former President of Sierra Leone and member of the Limited International Election Observation Mission in Somaliland Ernest Bai Koroma % @ebklegacy On polling day, 31st May, 2021, observing in #Somaliland, peaceful, free and orderly parliamentary and local council elections. I commend Somalilanders for such extraordinary turn out & great determination to exercise their Democratic rights. -

Somalia: January 2019 by Jon Lunn
BRIEFING PAPER Number 7298, 17 January 2019 Somalia: January 2019 By Jon Lunn update Inside: 1. Somalia under President Hassan Sheikh Mohamud (2012-17) 2. Somalia under President Farmajo (February 2017-) www.parliament.uk/commons-library | intranet.parliament.uk/commons-library | [email protected] | @commonslibrary Number 7298, 17 January 2019 2 Contents Summary 3 1. Somalia under President Hassan Sheikh Mohamud (2012- 17) 6 1.1 His performance in office 6 1.2 Creating regional states 6 1.3 Somalia-Somaliland-Puntland relations 7 1.4 Controversy over the 2016 (s)elections 7 2. Somalia under President Farmajo (February 2017-) 9 2.1 Domestic and foreign challenges 10 Federal fault-lines on display 10 Elite tensions at the centre 11 Wider reform efforts making slow headway 12 UN Special Representative expelled 13 Regional shifts 13 2.2 Security 14 2.3 Future of AMISOM 17 2.4 Humanitarian situation 18 2.5 Somaliland: elections but no rapprochement with Somalia 19 2.6 Ongoing Somaliland-Puntland tensions 20 2.7 UK-Somalia relations: overview 21 Cover page image copyright: 2017_02_08_Presidential_Elections-2_(32664306291) Newly elected president of Somalia, Mohamed Abdullahi Farmajo (centre) makes an acceptance speech after he was sworn into office at the Mogadishu Airport hangar on February 8, 2017 by AMISOM Public Information Licensed by CC0 1.0 Universal (CC0 1.0) / image cropped. 3 Somalia: January 2019 update Summary Mohamed Abdullahi Mohamed (known as Farmajo) was elected president of Somalia by the federal parliament on 8 February 2017. Farmajo was the prime minister of Somalia between 2010 and 2011. -
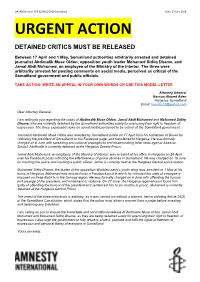
Urgent Action
UA: 90/19 Index: AFR 52/0615/2019 Somaliland Date: 27 June 2019 URGENT ACTION DETAINED CRITICS MUST BE RELEASED Between 17 April and 1 May, Somaliland authorities arbitrarily arrested and detained journalist Abdimalik Muse Oldon, opposition youth leader Mohamed Sidiiq Dhame, and Jamal Abdi Muhumed, an employee of the Ministry of the Interior. The three were arbitrarily arrested for posting comments on social media, perceived as critical of the Somaliland government and public officials. TAKE ACTION: WRITE AN APPEAL IN YOUR OWN WORDS OR USE THIS MODEL LETTER Attorney General Hassan Ahmed Aden Hargeisa, Somaliland Email: [email protected] Dear Attorney General, I am writing to you regarding the cases of Abdimalik Muse Oldon, Jamal Abdi Muhumed and Mohamed Sidiiq Dhame, who are currently detained by the Somaliland authorities solely for exercising their right to freedom of expression. The three expressed views on social media perceived to be critical of the Somaliland government. Journalist Abdimalik Muse Oldon was arrested by Somaliland police on 17 April from his hometown of Burao for criticizing the president of Somaliland on his Facebook page, and transferred to Hargeisa. He was formally charged on 6 June with spreading anti-national propaganda and disseminating false news against Abaarso School. Abdimalik is currently detained at the Hargeisa Central Prison. Jamal Abdi Muhumed, an employee of the Ministry of Interior, was arrested at his office in Hargeisa on 24 April over his Facebook posts criticizing the effectiveness of police services in Somaliland. He was charged on 19 June for insulting the police and insulting a public officer. -

Exercise A. Read Carefully the Following Item, Based on a “Financial Times” Article of 29/10/18, Before Replacing (Writing I
Exercise A. Read carefully the following item, based on a “Financial Times” article of 29/10/18, before replacing (writing in) the 15 words from the list below in the gaps most appropriate in terms of context. aid deal flex former ground hub length mere secure saw serve set spend stark suit way At the Berbera Container Port in the internationally unrecognised the military agreement and its commercial investment. Saad Ali state of Somaliland, employees of Dubai-based DP World unload 40- Shire, Somaliland’s Foreign Minister, said: “The Red Sea Corridor foot crates from a large cargo ship, as more vessels wait on the horizon. has always attracted superpowers because of the importance of the The facility on the Gulf of Aden has been operated by DP World for about sea lane”. He added: “What attracts them is not new — what’s new a year, with the company __________ to invest $442M in an expansion is the new states that are now more powerful, more wealthy. They project that would more than quintuple capacity. want to be seen, they want to __________ their muscles”. That a global port operator is preparing to __________ such a sum in Part of the prize at Berbera is its proximity to a fast-growing a state that is not recognised by the United Nations or anyone else is a economy to the west. The GDP of Ethiopia has risen tenfold in the __________ example of the political and commercial battle taking place past 15 years – to more than $80bn, but the landlocked country in the under-developed Horn of Africa – a gateway to lucrative trade relies on a single port in Djibouti to manage more than 90% of its routes through the Suez Canal and fast-growing African markets.