Institut Hist
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
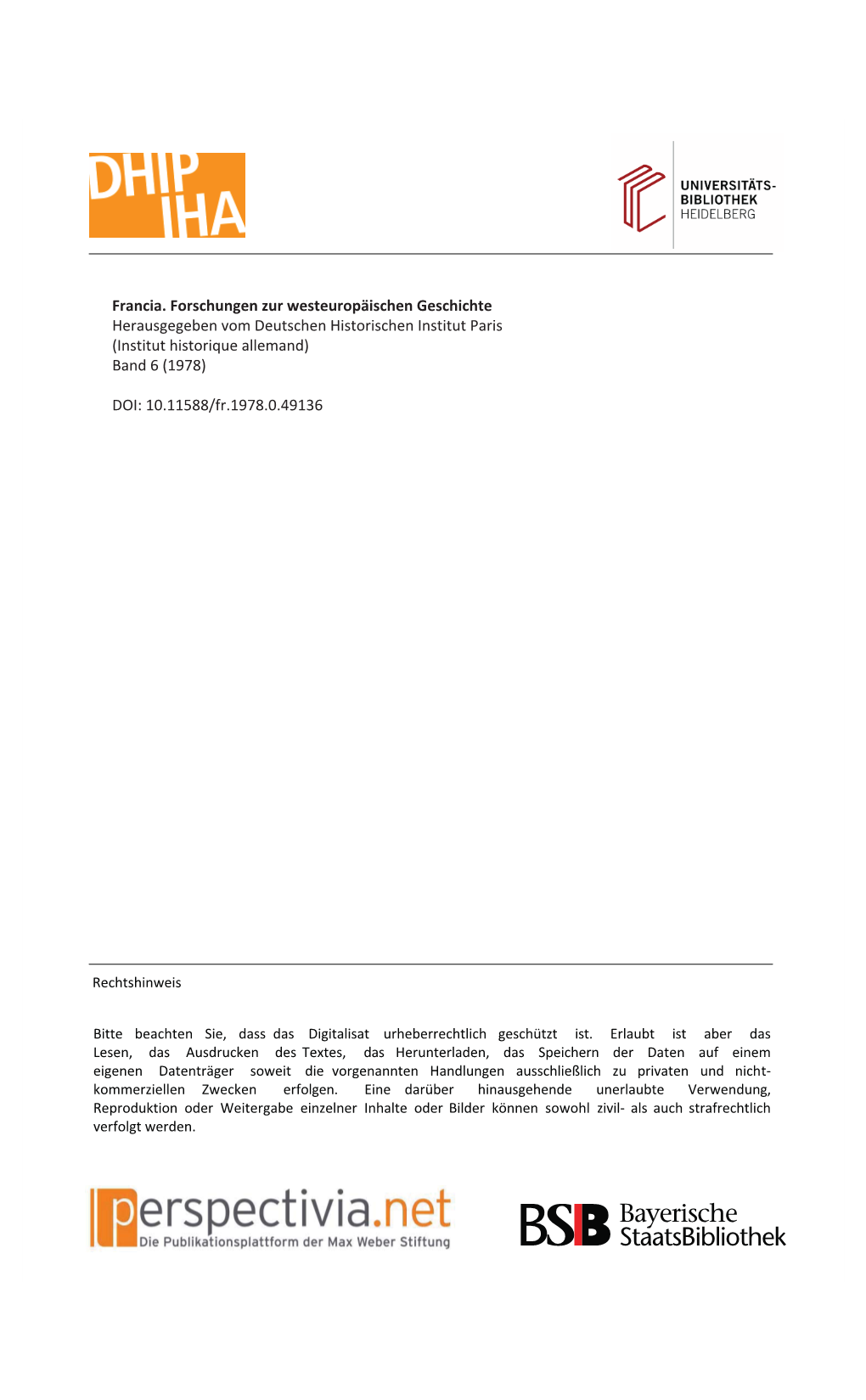
Load more
Recommended publications
-

180 Goi Erdi Aroko Pertsona-Izenak. Germaniar Jatorriko Pertsona-Izenak
180 Goi Erdi Aroko pertsona-izenak. Germaniar jatorriko pertsona-izenak 1 Testuingurua 2 Euskaraz nola idatzi germaniar jatorriko izenak? 3 Irizpide xeheak 4 Germaniar jatorriko pertsona-izenen sailkako zerrendak 5 Germaniar jatorriko pertsona-izenak zerrenda bakarrean (euskara-erdarak) 6 Germaniar jatorriko pertsona-izenak zerrenda bakarrean (erdarak-euskara) ------------------------------------------------------------------ 1 Testuingurua Mendebaldeko Erromatar Inperioa desagertu ondoren ere, Erdi Aroaren hasieran, latinak jarraitu zuen prestigiozko hizkuntza izaten Europako erdialdean eta mendebaldean. Garai hartako pertsona-izen nagusiak latinez idatzitako kroniketan (Historiae Francorum, Annales regni Francorum, Annales Fuldenses, Annales Bertiniani...) agertu ziren lehen aldiz idatziz, eta latinaren bidez hedatu ziren Europan erresumetako hizkuntzetara. 1 Inguruko hizkuntzetara eta Europako hizkuntza nagusietara begiratuta, argi eta garbi ageri da garai hartako pertsona-izen nagusiak (errege- erreginak, santu-santak, buruzagiak...) askotan ez direla berdin idazten hizkuntza guztietan. Hau da, hizkuntza bakoitzak bere sistema grafikora egokitu ditu izenok, eta bere grafia eman die. Adibidez, latinezko kroniketan Lotharius dena (jatorria: hlud "ospetsua" eta hari "armada" elementu germanikoak) Lothaire da frantsesez, Lotario gaztelaniaz eta italieraz, Lothair ingelesez, Lothar alemanez, Lotari katalanez, eta abar; latinezko Rudolphus dena (jatorria: hrod "fama" eta wulf "otsoa" elementu germanikoak) Rodolphe da frantsesez, Rodolfo -

Achila, Visigothic King, 34 Acisclus, Córdoban Martyr, 158 Adams
Index ; Achila, Visigothic king, 34 Almodóvar del Río, Spain, 123–24 Acisclus, Córdoban martyr, 158 Almonacid de la Cuba, Spain, 150. See Adams, Robert, 21 also Dams Aemilian, St., 160 Alonso de la Sierra, Juan, 97 Aerial photography, 40, 82 Amalaric, Visigothic king, 29–30, 132, Aetius, Roman general, 173–75 157 Africa, 4, 21–23; and amphorae, 116, Amber, 114 137, 187, 196; and ARS, 46, 56, 90, Ammianus Marcellinus, Roman histo- 99, 187; and Byzantine reconquest, rian, 166, 168 30; and ‹shing, 103; and olive oil, Amphorae, 43, 80, 199–200; exported 88, 188; and Roman army, 114, 127, from Spain, 44, 97–98, 113, 115–16, 166; and trade, 105, 141; and Van- 172; kilns, 61–62, 87–90, 184; from dals, 27–28, 97, 127, 174 North Africa, 129, 187. See also African Red Slip (ARS) pottery, 101, Kilns 147, 186–87, 191, 197; de‹nition, 41, Anderson, Perry, 5 43, 44, 46; and site survival, 90, Andujar, Spain, 38, 47, 63 92–95, 98–99; and trade, 105–6, 110, Annales, 8, 12, 39 114, 116, 129, 183 Annona: disruption by Vandals, 97, Agde, council of, 29, 36, 41 174; to Roman army, 44, 81, 114–17; Agglomeration, 40–42, 59, 92 to Rome, 23, 27, 44, 81, 113; under Agila, Visigothic king, 158–59. See Ostrogoths, 29, 133. See also Army also Athanagild Antioch, Syria, 126 Agrippa, Roman general, 118 Anti-Semitism, 12, 33. See also Jews Alans, 24, 26, 27, 34, 126, 175 Antonine Itinerary, 152 Alaric, Visigothic king, 2, 5, 26–27 Apuleius, Roman writer, 75–76, 122 Alaric II, Visigothic king, 29–30 Aqueducts, 119, 130, 134, 174–75 Alcalá del Río, Spain, 40, 44, 93, 123, Aquitaine, France, 2, 27, 45, 102 148 Arabs, 33–34, 132–33, 137. -

La Prima Moneta D'oro Portoghese
LA PRIMA MONETA D’ORO PORTOGHESE Un solido di Onorio emesso da Rechiar a Bracara a cura di Antonio Di Francesco Suevi in Galizia. Periodo di Rechiar (448-55), a nome di Onorio (395-423), Solido (4,38 g. – 12h), Bracara. D./ D N HONORIVS P F AVG. Busto con diadema di perle, drappeggiato e corazzato, a destra. R./ VICTORIA AVGGG. L’imperatore stante a destra, che tiene un labaro e una Vittoria sul globo; il piede sinistro è su un barbaro; nel campo, ai lati, B – R; in esergo COMOB. Ex Dix Noonan Webb, 27 settembre 2007, lotto n. 2861; stimata £ 20.000 - £ 25.000 e venduta £ 52.000. Il 27 settembre 2007 la Dix Noonan Webb (DNW) di Londra ha messo in vendita un esemplare unico emesso al tempo del re suevo Rechiar (448-55) in Portogallo. La moneta ben illustrata, è stata accompagnata da alcune note che appresso traduciamo in lingua italiana. Abbiamo tralasciato la parte inerente le notizie storiche che invece ab- biamo voluto riportare sulla base delle nostre ricerche. Michael Metcalf ha scritto che: «Una vasta serie di imitazioni di solidi a nome di Onorio (393-423), e con il segno di zecca M D (Mediolanum) fu attribuita agli Suevi sin dal 1942 da W. Reinhart. Essi sono rappresentati in collezioni pubbliche e private portoghesi. Ritrovamenti relativi alle monete sueve sono stati registrati come provenienti da Coimbra, Castelo Branco, Covilhã e Badajoz. Il presente esemplare, che è stilisticamente simile alle serie imitative con M D, differisce da loro avendo il se- gno di zecca B R, che si riscontra anche sulle siliquae d’argento del re suevo Rechiar (448-55). -

Dobosz Strzelczyk – Dodruk.Indd 1 2015-11-24 19:41:32 Dobosz Strzelczyk – Dodruk.Indd 2 2015-11-24 19:41:45 UNIWERSYTET IM
Chrystianizacja Europy Dobosz Strzelczyk – dodruk.indd 1 2015-11-24 19:41:32 Dobosz Strzelczyk – dodruk.indd 2 2015-11-24 19:41:45 UNIWERSYTET IM. ADAMA MICKIEWICZA W POZNANIU SERIA HISTORIA NR 226 Chrystianizacja Europy Kościół na przełomie I i II tysiąclecia Redakcja Józef Dobosz, Jerzy Strzelczyk POZNAŃ 2015 Dobosz Strzelczyk – dodruk.indd 3 2015-11-24 19:41:45 Abstract. Dobosz Józef, Strzelczyk Jerzy (eds). Chrystianizacja Europy. Kościół na przełomie I i II tysiąclecia [The Christianisation of Europe. The Church at the Turn of the Second Millennium]. Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (Adam Mickiewicz University Press). Poznań 2014. Seria Historia nr 226. Pp. 292. ISBN 978-83-232-2842-4. ISSN 0554-8217. Polish text with English summaries. This seminal book is an attempt to summarise and chart new directions in the on-going historical de- bate relating to the formation and spread of Christianity throughout the European continent. The authors examine the processes of the emergence and consolidation of Christianity along with the birth of the foundations of the institutional Church within Imperium Romanum. The question of the Christianisation of tribes and the emergent barbaric states is also explored. The study covers subjects up to the formation of medieval Respublica Christiana circa 1000, and, going beyond the issues of Christianity, addresses also issues appertaining to pagan religions in Europe and to other Christian denominations, Judaism and Islam. Józef Dobosz, Jerzy Strzelczyk – Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Instytut Historii, ul. Umultowska 89d, 61-614 Poznań. Recenzent: dr hab. Krzysztof Skwierczyński © Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 2014 Praca naukowa finansowana w ramach programu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego pod nazwą „Narodowy Program Rozwoju Humanistyki” w latach 2014-2019, n r projektu 0046/NPRH3/H11/82/2014. -

De Episcopis Hispaniarum: Agents of Continuity in the Long Fifth Century
Université de Montréal De episcopis Hispaniarum: agents of continuity in the long fifth century accompagné de la prosopogaphie des évêques ibériques de 400–500 apr. J.-C., tirée de Purificación Ubric Rabaneda, “La Iglesia y los estados barbaros en la Hispania del siglo V (409–507), traduite par Fabian D. Zuk Département d’Histoire Faculté des Arts et Sciences Thèse présentée à la Faculté des études supérieures en vue de l’obtention du grade Maître ès Arts (M.A.) en histoire août 2015 © Fabian D. Zuk, 2015. ii Université de Montréal Faculté des etudes supérieures Ce mémoire intitule: De episcopis Hispaniarum: agents of continuity in the long fifth century présenté par Fabian D. Zuk A été évalué par un jury composé des personnes suivantes : Philippe Genequand, president–rapporteur Christian R. Raschle, directeur de recherche Gordon Blennemann, membre du jury iii In loving memory в пам'ять про бабусю of Ruby Zuk iv TABLE OF CONTENTS Résumé / Summary p. v A Note on Terminology p. vi Acknowledgements p. vii List of Figures p. ix Frequent ABBreviations p. x CHAPTER I : Introduction p. 1 CHAPTER II : Historical Context p. 23 CHAPTER III : The Origins of the Bishops p. 36 CHAPTER IV : Bishops as Spiritual Leaders p. 51 CHAPTER V : Bishops in the Secular Realm p. 64 CHAPTER VI : Regional Variation p. 89 CHAPTER VII : Bishops in the Face of Invasion : Conflict and Contenders p. 119 CHAPTER VIII : Retention of Romanitas p. 147 Annexe I: Prosopography of the IBerian Bishops 400–500 A.D. p. 161 Annexe II: Hydatius : An Exceptional Bishop at the End of the Earth p. -

Calendar of Roman Events
Introduction Steve Worboys and I began this calendar in 1980 or 1981 when we discovered that the exact dates of many events survive from Roman antiquity, the most famous being the ides of March murder of Caesar. Flipping through a few books on Roman history revealed a handful of dates, and we believed that to fill every day of the year would certainly be impossible. From 1981 until 1989 I kept the calendar, adding dates as I ran across them. In 1989 I typed the list into the computer and we began again to plunder books and journals for dates, this time recording sources. Since then I have worked and reworked the Calendar, revising old entries and adding many, many more. The Roman Calendar The calendar was reformed twice, once by Caesar in 46 BC and later by Augustus in 8 BC. Each of these reforms is described in A. K. Michels’ book The Calendar of the Roman Republic. In an ordinary pre-Julian year, the number of days in each month was as follows: 29 January 31 May 29 September 28 February 29 June 31 October 31 March 31 Quintilis (July) 29 November 29 April 29 Sextilis (August) 29 December. The Romans did not number the days of the months consecutively. They reckoned backwards from three fixed points: The kalends, the nones, and the ides. The kalends is the first day of the month. For months with 31 days the nones fall on the 7th and the ides the 15th. For other months the nones fall on the 5th and the ides on the 13th. -

The Suevic Kingdom Why Gallaecia?
chapter 4 The Suevic Kingdom Why Gallaecia? Fernando López Sánchez The Sueves…(came to) hold the supremacy which the Vandals abandoned.1 Introduction: Towards a Re-evaluation of the Suevic Kingdom of Hispania During the reign of Rechiar (448–456) in the middle of the fifth century, the Sueves’ hegemony in Hispania seemed unassailable. Rechiar had inherited from his father, Rechila (438–448), a Suevic kingdom strong in Gallaecia and assertive across the Iberian Peninsula.2 By marrying a daughter of Theoderic I in 449, the new Suevic king won the support of the Visigothic rulers in Toulouse.3 As a Catholic, Rechiar managed to draw closer to the population of Hispania and also to Valentinian III, making himself, in a sense, a ‘modern’ monarch.4 In 453, he secured imperial backing through a pact with the imperial house of Ravenna.5 Confident in his power and prospects, Rechiar plundered Carthaginiensis and, finally, Tarraconensis, the last Spanish province under imperial control, following the deaths of Aëtius (454) and Valentinian III (455).6 1 Ubric (2004), 64. 2 For an analysis of Rechila’s ambitions and achievements: Pampliega (1998), 303–312. 3 Hyd. 132, pp. 98–99; Valverde (1999), 304. 4 Rechiar’s father, Rechila, died a pagan (gentilis), but Hydatius 129, pp. 98–99, describes Rechiar as catholicus at the time of his succession; see also Isidore of Seville, Historia Sueuorum 86–87, p. 301. Presumably, Rechila, his predecessor, Hermeric, and most of the Suevic aristocracy fol- lowed traditional German religious practices: Schäferdiek (1967), 108; García Moreno (1997), 200–201. -

Problem 5.5 X 9Long
Cambridge University Press 978-0-521-43543-7 - Barbarian Migrations and the Roman West, 376-568 Guy Halsall Index More information INDEX · Ad Salices, battle (377) 178 Amory, Patrick 18 Adovacrius, Saxon leader 271 Anthemius, emperor 272–3, 275–6, Adrianople, battle (378) 178–9 277–8 Aegidius, general 263, 266–7, 269 Antonine Constitution (212) 53, Æthelberht, King of Kent 317, 318 72, 98 laws of 464–5 Aquitanian Goths see Visigoths Ae¨tius, general 236–7, 237–40, 241–2, Arabs, Roman ideas about 52 244–5, 248–50, 252–3, 254–5, Arbogast 187–8 519, 520 Arborychoi 304, 305 Africa 5–6, 93–6, 219, 321–7, 514 Arcadius, emperor 188, 213 Africans, Roman ideas about 52–3 archaeology, and barbarians inside the Agila, king of the Visigoths 506 Empire 153–61, 198, 448 agri deserti 91, 434–5, 439 and ethnicity 466–8 Agrippinus, general 263 see also historiography Alamans 118, 138, 149, 151, 174–5, 241, Arianism, and ethnicity 469–70 263, 271, 304–5, 400, 511 aristocracy, in Merovingian Gaul, Alans 222, 227, 228, 248, 249, 253, 268, northern 353–5, 356–7 Alaric I, Gothic king 189–90, 191, 192, in Merovingian Gaul, southern 194–5, 200, 201–2, 209, 213, 214–17, 353, 356 titles of 202–6 in Ostrogothic Italy 331–2 Alaric II, king of the Visigoths 288, in post-imperial Britain, highland 297–8, 304 363–4 Alatheus 170, 176, 177 in post-imperial Britain, lowland Amalafrida, sister of Theoderic Amal 295 364–7 Amalaric, king of the Visigoths 294, in post-imperial Europe 368 298–9 late Roman 77, 78, 81, 92–3 Amalasuentha, daughter of Theoderic Amal involvement -

54 Abd Al-Rahman III (912–61)
Cambridge University Press 978-0-521-60397-3 - A History of Portugal and the Portuguese Empire: From Beginnings to 1807, Volume I: Portugal A. R. Disney Index More information Index Abbasids, the 54 encourages trade 110 Abd al-Aziz 51, 53 Afonso V (1438–81) 128, 141, 158, 170 Abd al-Rahman I (756–88) 54 attains majority 129 Abd al-Rahman III (912–61) 54, 61, 68 crushes ex-regent Prince Pedro 130 Abrantes 80, 101 generous grants to nobility 132, 135 Abrantes, marquis of 272, 332 invades Castile 133 absolutism 239, 242, 250, 264–268 nurtures leading nobility 128 Academia Real das Cieˆncias 318 patronises education and learning 163, Academia Real de Histo´ria see Royal 164 Academy of History, the unusually long reign 131–133 academies 277, 278, 317 Afonso VI (1656-68) Acapulco 206, 209 and Castelo Melhor 229, 232 Achila 52 conspiracy to restore 233 acorns 14 and the cortes 240 administration see royal government marriage 231–233 Adoptionism 64 physical and mental handicaps 228 Aegean colonists 8 relinquishes power to Prince Pedro 232 Aeminium 24 see also Coimbra Afonso (bastard son of Joa˜oI) Afonso I Henriques (count 1128-43; king as count of Barcelos 128 1143–85) 73, 82, 85, 88, 90, 91 as duke of Braganc¸a129, 131 achieves autonomy 74–75 exempted from Lei Mental 128 and Augustinian canons 89 generous grants to 132 captured by Fernando II 78 opposition to regent Prince Pedro 130 and the church 88 Afonso (son of Joa˜o II) 135, 136, 143 delegates responsibility to son Sancho marriage and death of 136 78 Afonso (son of Manuel I) 159 expands -

A Diarquia Sueva: Sociedade E Poder No Regnum Dos Quados Ocidentais E No Regnum Suevorum (358–585 D.C.)
A diarquia sueva: sociedade e poder no regnum dos Quados ocidentais e no Regnum Suevorum (358–585 d.C.) *Investigador José Galazak* independente. E-mail: jose.galazak@gmail. com Resumo Foi a dupla nomeação de Maldras como rex Suevorum em 456/457 e a crescente convicção de que esta era a “chave” para abrirmos a porta do desconhecido mundo dos Suevos que nos conduziu ao presente trabalho. Aqui defendemos que 1) os Quados de Amiano Marcelino e os Suevos são o mesmo povo em diferentes momentos históricos; 2) foram os Quados ocidentais que acompanharam os Alanos e os Vândalos (Asdingos e Silingos) na invasão da Gália em 406/407; 3) o Regnum Suevorum mais não é que a reconstituição do regnum dos Quados ocidentais, tal como Amiano Marcelino no-lo descreve em 358; 4) a monarquia sueva era de facto uma diarquia; 5) os Suevos constituíam uma união de dois grupos diferentes, a saber: i) os Baemi, governados pela stirps regia e que compreendia os descendentes dos antigos seguidores de Maroboduus e de Catualda, maioritariamente Marcomanos e ii) uma tribo quada, à qual pertenciam Heremigarius, Massila, Maldras e Frumário, e onde teve lugar a primeira das duas nomeações de Maldras como rei (na verdade o seu estatuto original não era o de rei, mas de subregulus). Abstract It was the dual appointment of Maldras as rex Suevorum in 456/457 and the growing conviction that this was the ‘key’ to open the door to the unknown world of the Sueves who led us to this paper. We argue here that 1) the Quadi of Ammianus Marcelinus and the Sueves are the same people -

41St International Congress on Medieval Studies in Kalamazoo
41st International ConguGSS on MedieuaL Studies 4-7 May 9.OO6 MEDIEVAL INSTITUTE College of Arts and Sciences Western Michigan University Kalamazoo, Michigan 49008-5432 2006 41st International ConguGSS on MedieuaL Studies 4-7 May 9.OO6 MEDIEVAL INSTITUTE College of Arts and Sciences Western Michigan University Kalamazoo, Michigan 49008-5432 2006 TabLe of Contents Welcome Letter iv-v Registration vi-vii On-Campus Housing viii Off-Campus Accommodations ix Travel and Parking x Driving to WMU xi Meals xii Varia xiii Exhibits Hall xiv Exhibitors xv About the Mail xvi Piffaro xvii 2006 Plenary Lectures xviii A Medieval Film Fest xix David R.Tashjian Travel Awards xx Griindler and Congress Travel Awards xxi Advance Notice—2007 Congress xxii The Congress: How It Works and Why xxiii The Dance xxiv 2006 NEH Summer Seminar xxv 2007 Visiting Fellows Program xxvi 2006 Visiting Fellow xxvii Richard Rawlinson Center xxviii-xxix Master's Program in Medieval Studies xxx-xxxii The Otto Griindler Prize 2007 xxxiii Medieval Institute Publications xxxiv-xxxv The Medieval Review xxxvi-xxxvii Medieval Institute Endowment and Gift Funds xxxviii About Western Michigan University xxxix Director, The Medieval Institute xi Schedule of Events 1-188 Index of Sponsoring Organizations 189-193 Index of Participants 195-217 List of Advertisers A-l Advertising A-2 - A-64 Maps M-l-M-8 Dear Colleague: I am very happy to request the pleasure of your company at the 41st International Congress on Medieval Studies in Kalamazoo. The Congress will take place Thursday through Sunday, May 4-7, 2006, on the campus of Western Michigan University under the sponsor ship of the Medieval Institute. -

Direito E Religião Na Antiguidade Tardia Ibérica
MESTRADO EM HISTÓRIA DO DIREITO, DO DEPARTAMENTO DE HISTÓRICO-JURÍDICAS DIREITO E RELIGIÃO NA ANTIGUIDADE TARDIA IBÉRICA JOÃO MARCOS DE CASTELLO BRANCO FANTINATO LISBOA 2017 JOÃO MARCOS DE CASTELLO BRANCO FANTINATO DIREITO E RELIGIÃO NA ANTIGUIDADE TARDIA IBÉRICA Dissertação apresentada ao Programa de Pós-graduação em História do Direito do Departamento de Histórico- Jurídicas da Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa, como requisito parcial para a obtenção do grau de mestre. Orientador: Professor José Artur Anes Duarte Nogueira LISBOA 2017 JOÃO MARCOS DE CASTELLO BRANCO FANTINATO Direito e Religião na Antiguidade Tardia Ibérica Dissertação apresentada como requisito parcial para obtenção do grau de Mestre pelo Programa de Pós- graduação em História do Direito do Departamento de Histórico-Jurídicas da Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa. Aprovada pela Comissão Examinadora abaixo assinada. Prof. José Artur Anes Duarte Nogueira Orientador Departamento de Histórico-Jurídicas, Universidade de Lisboa ________________________________________ Lisboa, ____ de ________________ de 2017. SUMÁRIO PREFÁCIO ............................................................................................................................ 7 1 - INTRODUÇÃO ................................................................................................................. 9 2 - A ANTIGUIDADE TARDIA .............................................................................................. 15 2.1 - A SITUAÇÃO GERAL NO BAIXO-IMPÉRIO ..................................................