Die Verbreitung Der Molche Im Spessart 5-24 Abh
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
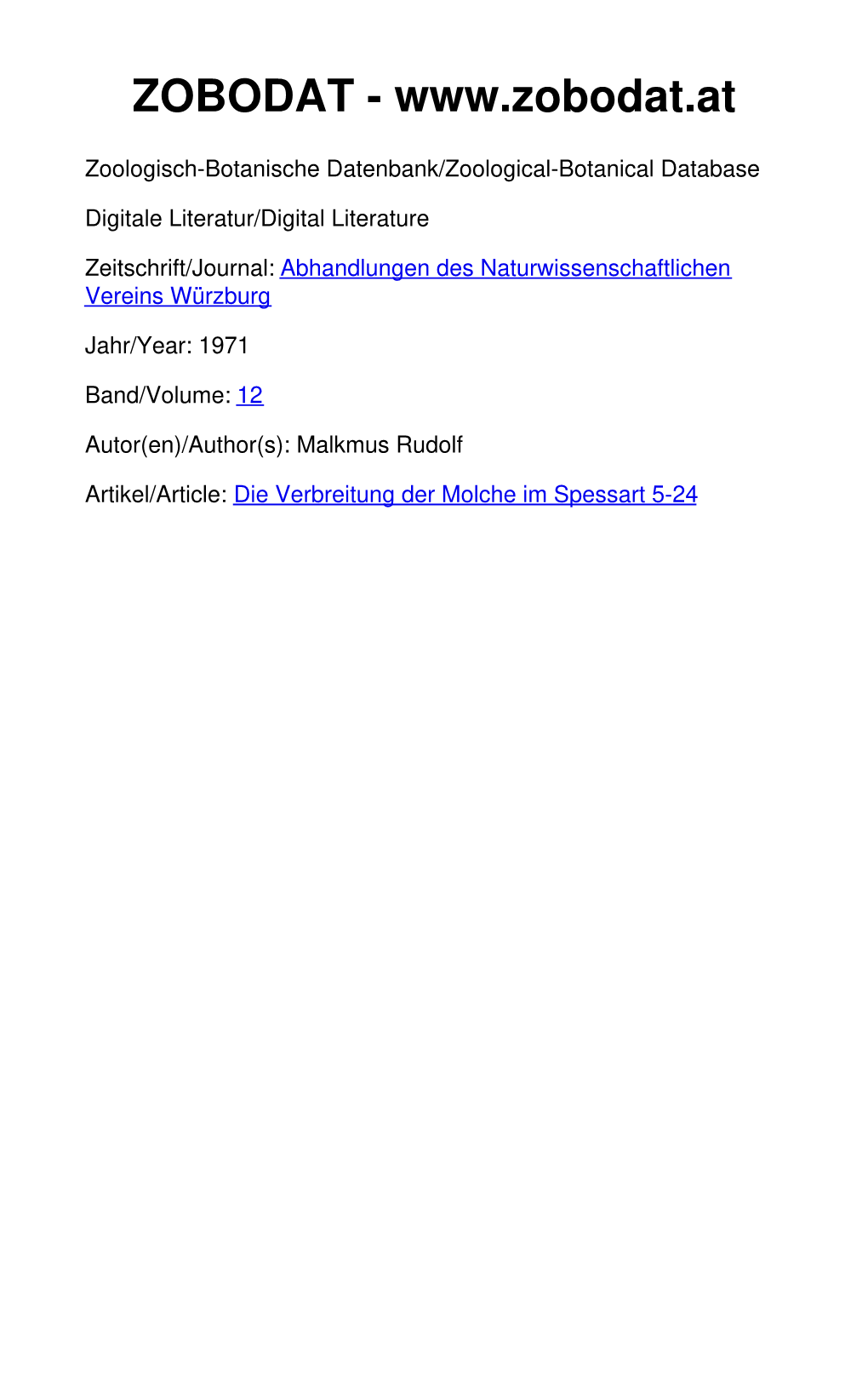
Load more
Recommended publications
-

BERGVERLAG ROTHER Rother Wanderführer Spessart Von Ulrich Tubbesing ISBN 978-3-7633-4269-3
entnommen aus dem BERGVERLAG ROTHER Rother Wanderführer Spessart von Ulrich Tubbesing www.rother.de ISBN 978-3-7633-4269-3 3.40 Std. 1 Zum höchsten Berg des Vorspessart 8C7 Aussicht und Einkehr auf dem Hahnenkamm Beliebtestes Wanderziel im Vorspessart ist der Hahnenkamm, der Hausberg Alzenaus. Seine gezackte Silhouette wirkt tatsächlich wie der aufgestellte Kamm eines Hahnes. Der Aussichtsturm auf dem höchsten Punkt des Vor- spessart garantiert bei klarem Wetter eine ungehinderte Fernsicht. Ausgangspunkt: Alzenau (Parkplatz un- Markierung: Querstrich, Doppelstrich, terhalb der Burg). Marienweg, Kulturweg. Höhenunterschied: 460 m. Einkehr: Hahnenkamm. Anforderungen: Kurze Höhenwande- Karten: Freizeitkarte Spessart Blatt 8, rung mit häufigem Markierungswechsel. 1:25.000. Viele Wege führen zum Hahnenkamm. Einer beginnt direkt an der Burg Al- zenau im Zentrum der Unterfränkischen Weinstadt. Kurmainz ließ die Burg 1395 anlegen. Ihr heutiges Aussehen verdankt sie den Umbauten des 18. Jh. Vom unterhalb gelegenen Parkplatz (1) quert Weg Querstrich die Kahl Ausgangspunkt der Hahnenkammwanderung ist Burg Alzenau. und leitet südwärts zur Stadt hinaus. Hinter der Hochspannungsleitung be- ginnt rechts ein Feldweg (2), der zwischen alten Obstbäumen bequem Rich- tung Wasserlos verläuft. Aus dem verträumten Winzerdorf (3) steigt die Mar- kierung D zum stimmungsvollen Aussichtspunkt am Weinberg (4). Hier, an der nordwestlichsten Ecke Bayerns, wächst auf Urgestein, Gneis und Glim- mer ein ganz typischer, von Kennern hochgeschätzter Frankenwein. »Hoc est vinum – das ist Wein«, soll einst ein spanischer Mönch im Kloster Seli- genstadt ausgerufen haben, dem diese Rebhänge damals gehörten. D zieht anschließend dicht am buchenbestockten Schanzenkopf entlang zur Elbernhöhe (5). Hier wechselt die Markierung. Doppelstrich durchmisst den Einschnitt des Vockenbachs (6) und gewinnt im Gegenanstieg das Steinmal Hemsbacher Kreuz (7). -

Verkehr Und Handel Zwischen Wiesbütt Und Dreimärker
Grenzdorf an der Spessartkreuzung Verkehr und Handel zwischen Wiesbütt und Dreimärker Die Flörsbacher Kirche und der Flörsbacher Altar, der sich heute in Marburg befindet. Die Gemarkung Flörsbach wurde erst- mals um 980 in der Grenzbeschreibung Flörsbach in einer Aufnahme um 1955. Zu dieser Zeit war der Wald weit zurückgedrängt und statt des Aschaffenburger Forstes erwähnt. den heute dominierenden Wiesenflächen herrschte die Feldbewirtschaftung vor. Der Ort selbst erscheint als Hanauer Die Kulturlandschaft um Flörsbach Besitz im Jahr 1324. Die Einwohnerzahl ist von Grenzen geprägt, die bis in lag 1633 bei 170 Personen, 1820 bei 195 Personen. Wie alt der Flörsba- das frühe Mittelalter zurückreichen. cher Kirchenbau ist, wurde noch nicht bestimmt. Unter der Herrschaft der Entlang der wichtigsten Grenze, der Grafen von Hanau wechselten die Flörsbacher in der Reformation zum zwischen Mainz und Hanau (heute evangelischen Glauben über. Aus diesem Grund dürfte der so genannte zwischen Hessen und Bayern) ver- „Flörsbacher Altar“ entfernt worden sein, der sich seit Beginn des vorigen läuft zum größten Teil die Birken- Jahrhunderts im Univer- hainer Straße, der wichtigste Han- sitätsmuseum in Marburg delsweg durch befindet. Er wird der Schu- den Spessart le Tillmann Riemenschnei- bis in das 18. Aus dem Eichenwald kam früher die Lohrinde, ders zugeordnet, der von Jahrhundert. die an Lohmühlen verkauft wurde. Aus der Rin- 1460 bis 1531 lebte. de wurden Gerbstoffe für die Lederherstellung Zentraler Kreu- gewonnen. zungspunkt ist die Wiesbütt, ein Moor (und heute ein kleiner See), Der Flörsbacher Löwe bewacht den wo die Nord-Süd-Verbindung den Eselsweg kreuzt Brunnen, der heute neben dem und dazu nach Südwesten die „Kauffahrteistraße“ (!) Feuerwehrhaus steht. -

Wanderwege Rund Um Partenstein
Partenstein Natur erleben Partenstein – umgeben von dichten Mischwäldern – wurde unterwegs im 1233 erstmals urkundlich erwähnt und hat sich von einem naturpark spessart armen Bauerndorf zu einer fortschrittlichen Gemeinde ent- wickelt. Über wunderschöne Wander- und Radwege können Sie das Spessartdorf erreichen. An den Sonn- und Feiertagen können Sie die evangelische Freizeitgelände Torweg Wanderwege rund und die katholische Kirche besuchen. Partenstein hat immer noch seinen dörflichen Charakter bewahrt: Partenstein bietet mit einem die Werbegemeinschaft organisiert jährlich den Walpurgis- und um Partenstein modernen Kindergarten, ei- den Weihnachtsmarkt, das Heimatkundliche Museum „Ahler ner gut ausgestattete Grund- Kråm“ und Ausgrabungen an der Burgruine, die vom Archäolo- schule – die erste Natur- gischen Spessartprojekt betreut werden, sowie der Rundwander- parkschule in Deutschland weg „Marienschacht – Erichstollen“, geben Einblicke in die Ge- – und Arzt, Zahnarzt, Apo- schichte Partensteins. Auf dem Freizeitgelände am Torweg können Sie boulen, klettern, Bogen schießen, Beach-Volleyball spielen, theke sowie eine Praxis für Ehemaliges Forstamt Podologie und eine für Phy- laufen, Fußball- und Handball auf Rasen spielen. Am Freizeitgelän- siotherapie eine vorbildliche de an der Linkgasse finden Sie Infrastruktur, nicht zuletzt eine Kneipp-Anlage mit Was- auch mit einer eine flächen- serspielplatz und Spielgeräten deckenden Breitbandversor- für Kinder und Senioren. gung. Lebensmittelmärkte, Ein reges Vereinsleben bie- Bäcker, Metzger und -

Bannwald Und Aussichtspunkt
Hahnenkamm Bannwald und Aussichtspunkt Bannwald Hahnenkamm Der Hahnenkamm ist mit 437 Metern der Der Hahnenkamm mit seinen abwechslungsreichen Waldbildern und gut höchste Berg im Vorspessart. Bereits im 19. ausgebauten Wegen ist ein beliebtes Wandergebiet und Ausflugsziel für Jahrhundert war er ein beliebtes Ausflugsziel. Einheimische und Be- Der Ludwigsturm wurde am 9. September sucher aus dem nahe 1880 eingeweiht. Seinen Namen gaben ihm gelegenen Rhein-Main- die Erbauer zur Erinnerung an das im gleichen Gebiet. Jahr gefeierte 700jährige Jubiläum der Re- Auch für viele Tier- und gentschaft der Wittelsbacher. Bayerns König Pflanzenarten, die hier Ludwig II. hatte die Schirmherrschaft über den relativ unberührt und Turmbau übernommen. Eigentümer der bauli- naturnah existieren chen Anlage ist der Freigerichter Bund, der sich können, besteht hier seit 1876 als einer der ältesten Wandervereine ein Rückzugsgebiet. der Region um den Tourismus verdient macht. Doch der Wald ist ein Auf der Jordanschen Karte von 1592 wird der Hahnenkamm 1883 wurde vom Freigerichter Bund auf dem komplexes System, das nicht als solcher benannt, erscheint aber als geschlossenes Hahnenkamm eine Schutzhütte errichtet. gut beobachtet wird und Waldgebiet zwischen den umliegenden Siedlungen. viel Pflege braucht, da- Karl Kihn, einer der Gründerväter des Spessartbundes, veröffentlichte diesen Wanderführer mit er seine Nutz-, Bodenschutz- und Erholungsfunktion für die Region 1886. Auf der Titelseite grüßt im Hintergrund der Hahnenkamm mit dem Ludwigsturm. erhält. Deshalb wurde er zu Bannwald erklärt, d.h. hier darf nur in Aus- nahmefällen gerodet werden. Der Name „Ludwigsturm“ hängt nicht etwa mit dem „Märchenkönig“ Lud- wig II. zusammen, sondern mit König Ludwig I. Grund dafür ist der Be- Der Berg teilt sich in drei Bewuchszo- such Ludwigs I. -
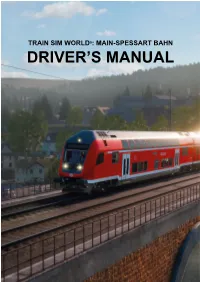
Train Sim World®: Main-Spessart Bahn Driver’S Manual
TRAIN SIM WORLD®: MAIN-SPESSART BAHN DRIVER’S MANUAL 1 © 2018 Dovetail Games, a trading name of RailSimulator.com Limited (“DTG”). All rights reserved. "Dovetail Games" is a trademark or registered trademark of Dovetail Games Limited. “Train Sim World” and “SimuGraph” are trademarks or registered trademarks of DTG. Unreal® Engine, © 1998-2018, Epic Games, Inc. All rights reserved. Unreal® is a registered trademark of Epic Games. Portions of this software utilise SpeedTree® technology (© 2014 Interactive Data Visualization, Inc.). SpeedTree® is a registered trademark of Interactive Data Visualization, Inc. All rights reserved. The DB logo is a registered trademark of Deutsche Bahn AG. All other copyrights or trademarks are the property of their respective owners. Unauthorised copying, adaptation, rental, re-sale, arcade use, charging for use, broadcast, cable transmission, public performance, distribution or extraction of the product or any trademark or copyright work that forms part of this product is prohibited. Developed and published by DTG. The full credit list can be accessed from the TSW “Options” menu. 2 Contents Topic Page 1. An Introduction to the Main-Spessart Railway ....................................................... 4 2. Main-Spessart Bahn Route Map & Key Locations ................................................. 5 3. The Game Modes: Tutorials, Scenarios & Services .............................................. 6 4. An Introduction to the DB BR 185.2 Electric Locomotive ....................................... 7 5. Quick Start Guide: DB BR 185.2 ............................................................................ 7 6. An Introduction to the DB BR 146.2 Electric Locomotive ....................................... 8 7. Quick Start Guide: DB BR 146.2 ............................................................................ 8 8. Quick Start Guide: DB BR 766.2 DBpbzfa Control Car .......................................... 9 9. Setting a Destination in the DB BR 146.2 & DB BR 766.2 Control Car .................10 10. -

Weiterbildungsverbund Main-Spessart
Koordinierungsstelle Allgemeinmedizin Weiterbildungsverbund Main-Spessart Teilnehmende Kliniken: Klinikum Main-Spessart Markplatz 3 97816 Lohr am Main www.klinikum-msp.de Standorte: Lohr Grafen-von-Rieneck-Straße 5 97816 Lohr am Main Lohr Marktheidenfeld Marktheidenfeld Baumhofstraße 91 - 95 97828 Marktheidenfeld Krankenhaus für Psychiatrie, Psychotherapie und Psychosomatische Medizin des Bezirks Unterfranken Am Sommerberg 97816 Lohr am Main www.bezirkskrankenhaus-lohr.de Krankenhaus für Psychiatrie, Psychotherapie und Psychosomatische Medizin des Bezirks Unterfranken Rotationsmöglichkeiten in die Gebiete: Innere Medizin (Kardiologie, Gastroenterologie) Chirurgie (Allgemein-, Viszeral-, Gefäßchirurgie, Orthopädie und spezielle Unfall- und Wiederherstellungschirurgie) Anästhesie Neurologie Psychosomatische Medizin und Psychotherapie Psychiatrie Einzelheiten gemäß Rotationsplan (gemäß WO 2004 i.d.F. der Beschlüsse vom 28.10.2018 in Kraft ab 01.05.2019 sowie i.d.F. der Beschlüsse vom 25.10.2015) Teilnehmende Fachärzt*innen für Allgemeinmedizin: Dr. med. Michael Brack Urspringen Tel. 09396-99930 Akupunktur, Sportmedizin https://allgemeinarztpraxis-m-brack.de/ Dr. med. Petra Gehrsitz Karlstadt-Karlburg Tel. 09353-7080 Palliativmedizin Dr. med. Esther Beck Akupunktur http://www.karlburger-arztpraxis.de/ Dr. med. Karen Heinkel-Wunn Marktheidenfeld Tel. 09391-5823 Notfallmedizin (FÄ Innere Medizin) Dr. med. Barbara Kaiser-Pfaff Notfallmedizin Dr.med. Michael Jovnerovski Karlstadt Tel. 09353-2330 https://www.allgemeinarzt-karlstadt.de/home.html Iryna Serebrennikova Dr. med. Mathias Krämer Dr. med. Johannes Kromczynski Zellingen Tel. 09364-9781 https://www.praxis-zellingen.de/ Dr. med. Horst Magers Arnstein Tel. 09363-90700 Notfallmedizin Christian Raab Dr. med. Heinz Jungwirth Dr. med. Michael Scheuerlein https://hausarzt-arnstein.de/ Dr. med. Josef Pullmann Hafenlohr Tel. 09391-1283 https://www.drpullmann-hausarzt-hafenlohr.de/ (FA Innere Medizin) Dr. med. -

Naturschutzgebiet Spessartwiesen – Perlen Im Spessart
Impressum Herausgeber: Ein Gemeinschaftsprojekt des Naturpark Spessart und des Zweckver- Seit Juni 2005 arbeitet das länderübergreifende Biotopverbundprojekt bands Naturpark Hessischer Spessart sowie der Regierung von Un- Spessart an einer verstärkten Vernetzung der wertvollen Lebensräume terfranken –Höhere Naturschutzbehörde– und den Spessartwiesen- von z.B. Schachblume, Bekassine und Eisvogel. Diese Vernetzung soll gemeinden Flörsbachtal, Frammersbach, Heigenbrücken, Neuhütten, seltenen Tier- und Pfl anzenarten ihr Fortbestehen erleichtern. In diesem Projekt werden die Bemühungen von amtlichem und ehrenamtlichem Partenstein und Wiesen. Naturschutz gebündelt und durch Öff entlichkeitsarbeit begleitet. Ansprechpartner: • Naturpark Spessart e.V., Tel. 09353-793366, E-Mail: [email protected] • Regierung von Unterfranken –Höhere Naturschutzbehörde–, Tel. 0931-3801174, E-Mail: [email protected] • Landkreis Aschaff enburg, Untere Naturschutzbehörde, Tel. 06051-8510, E-Mail: [email protected] E-mail: [email protected] Förderung • Landkreis Main-Spessart, Untere Naturschutzbehörde, Tel. 09353-793367, E-Mail: jü[email protected] • Zweckverband Naturpark Hessischer Spessart, Tel. 06051-883542, E-Mail: [email protected] Dieses Projekt wurde von der Europäischen Union und dem Entwurf und Gestaltung: Naturpark Spessart e.V. Freistaat Bayern gefördert Reinzeichnung: Regierung von Grafi kwerkstatt Jörg Ambrosius, Gemünden Unterfranken Fotos: Naturpark Spessart, Forschungsinstitut Senckenberg, Regierung von Unterfranken –Höhere Naturschutzbehörde–, Walter Malkmus Druck: Farbendruck Brühl, Marktbreit Naturschutzgebiet Spessartwiesen – Perlen im Spessart Naturpark Naturpark Spessart Spessart 2 NATURPARK SPESSART Vorwort Sehr geehrte Damen und Herren, werte Gäste, wie häufi g ist von Perlen und Schmuck die Rede und am Ende versteckt sich nur billiges Imitat dahinter. Davon sind wir hier in den Naturschutzgebieten „Spessartwie- sen“ weit entfernt. -

2019 Geführte Wanderungen-Kompakt, Ausgabe
1. Vorsitzender Richard Mehler Saumstraße 15 97816 Lohr-Ruppertshütten 09355-2575 2. Vorsitzender Manfred Breckner Fliederweg 4 97816 Lohr-Sendelbach 09352-4119 3. Vorsitzende (Schanzkopf-Hütte) Hiltrud Hippeli Amselstraße 9 Die vereinseigene Schanzkopfhütte beim Schanzkopffest 2018 97816 Lohr-Sendelbach 09352-9442 Hinweis zu den Wandergruppen und den Ansprechpartnern: Gruppe 1 (WG1): Gabriele Meixner (Tel.: 09351-5329), Wanderungen zwischen ca. 12 u. 16 km Vereinsmotto: Gruppe 2 (WG2): Bruno Wäschenbach (Tel.: 09352-3494), Wanderungen zwischen ca. 10 u. 13 km „Nur wo du zu Fuß warst, bist Gruppe 3 (WG3): Doris Ketscher (Tel.: 09352-5130), Wanderungen zwischen ca. 6 u. 10 km Gruppe WWG: Josef Mähler (Tel.: 09352-5595), Wanderungen zwischen ca. 20 u. 30 km du auch wirklich gewesen“. (Zitat von Johann Wolfgang von Goethe) Gruppe FAW: Gabriele Meixner (09351-5329), jeden 2. Donnerstag/Monat Die Wanderungen der Gruppen 1, 2 u. 3 finden wöchentlich - jeweils mittwochs statt. Die Weitwandergruppe (WWG) wandert 1x im Monat i.d.R. an einem Freitag. Siehe hierzu den Hinweis am Ende des Terminplans. S. 1 Wander- Treffpunkt: Anzahl Termin: Gruppe: Einkehr: strecke Teil- Führung: Streckenverlauf: Zeitpunkt: in km: nehmer: Parkdeck Lohr 02.01. WG3 Rodenbach 5 13 Karin Mayer Parkdeck-Rodenbach. Mit dem Bus zurück (13:35 Uhr). 10:00 Uhr ZOB Lohr Hafenlohr 15 31 Hermann Neustadt Gasthaus Engel-Gaiberg-Kreuz Rotbild-Hainmarter- 09.01. WG1 Abf. 8:58 Uhr „Kleine Höll“ 11 (14,4) 5 (36) Preßler Hafenlohr-Windheim Kirche. Mit dem Bus zurück. Mainlände Lohr 13 17 Igelhäuschen Lindig Siedlung-Franziskushöhe-Beilstein- 09.01. WG2 Sackenbach Emmi Rückel 9:00 Uhr „Bürgerstübchen“ 7 (11,1) 8 (25) Konrad Seltsam Tierheim-Grotte-Sackenbach-zurück zum Parkplatz. -

Gastgeberverzeichnis 2020/2021 Frammersbach, Habichsthal Und Region Hotels, Pensionen & Gastronomie
Frammersbach Marketing eG Genossenschaft zur Förderung von Kultur, Gesellschaft, Wirtschaft und Tourismus Gastgeberverzeichnis 2020/2021 Frammersbach, Habichsthal und Region Hotels, Pensionen & Gastronomie Übernachten Genießen Spessart Familienaktiv Motorrad Bikewald Wandern fahren Spessart Skifahren Rodeln Langlauf Terrassenbad Frammersbach Herzlich willkommen in Frammersbach und Habichsthal! Bildnachweis: Nordreisender / photocase.com Nordreisender Bildnachweis: Hier zeigt sich der Spessart von seiner schönsten Seite. Besucher auf seine Kosten. Überzeugen Sie sich selbst und Egal ob actionreiche Mountainbike-Tour, gemütliche Wald- entdecken Sie unseren malerischen Spessart sowie unsere wanderung, ein spaßiger Freibadbesuch oder ein Tag auf kulinarischen Highlights und Veranstaltungen. Wir wün- der Skipiste: Im staatlich anerkannten Erholungsort Markt schen Ihnen viel Freude und Erholung für Ihren Besuch bei Frammersbach mit seinem malerischen Ortsteil Habichsthal uns! kommt durch die große Vielfalt an Freizeitaktivitäten jeder Bildnachweis: Francesca Schellhaas / photocase.com Schellhaas Francesca Bildnachweis: NATURLICHH SCHÖN. NATÜRLICH. WANDERUNGEN & SPAZIERGÄNGE Märchenhafte Wälder, wilde Bäche, weite Wanderwege und jekts. Der historische Ortsrundgang gibt zudem Einblicke in Grün soweit das Auge reicht: Erleben Sie bei uns ursprüng- die Ortsgeschichte. liche Natur und den Spessart in seiner reinsten Form – das Rund um Frammersbach und Habichsthal gibt es jede Men- beste Mittel gegen die Hektik des Alltags und perfekt, um ge zu entdecken. -

Europäischer Kulturweg Alzenau 3 - Vom Ringwall Zum Landsitz
Am Sülzert Europäischer Kulturweg Alzenau 3 - Vom Ringwall zum Landsitz Der Höhenzug „Sülzert“ zwi- Michelbach - das Schlösschen schen Hahnenkamm und dem Birkenhainer Forst prägt die Kulturlandschaft in Al- zenaus Norden. Während der bewaldete Bereich von dem Ringwall „Schwedenschan- ze“ gekrönt wird, wurde das liebliche Klima an den West- und Südhängen für die Er- Michelbach mit der Wasser(?)burg auf der Um 1957 steht das Schlösschen von Michelbach Karte von Adam Jordan (1592). noch frei in der Landschaft des Kahltales. richtung von Landsitzen in Mi- Der „Sülzert“ ist die Fortsetzung des Gebirgszuges des „Hahnenkamms“ bis zum Nesslochbach bei Geiselbach. chelbach und Albstadt ge- Der Name derer von „Michelbach“ erscheint urkundlich erstmals 1234. Vermut- Seine Benennung hat sich bis heute fast verloren und soll nutzt. Hinzu tritt der Weinbau, lich lebte die Adelsfamilie in einer Wasser(?)burg an der Stelle des heutigen Schlöss- durch den Kulturweg wieder belebt werden. Auszug aus der in der Vergangenheit noch der Spessartkarte des Frankfurter Kartenzeichners Elias Hoff- chens. Grabungen, welche diesen Vorgängerbau nachweisen könnten, stehen mann von 1584 (Norden ist linker Hand). wesentlich intensiver als heu- noch aus. Das früheste erhaltene Zeugnis der Familie von Michelbach ist der te betrieben wurde. Der Kul- Grabstein von Gutda, der Witwe des Wigand von Michelbach, die 1245 als adeli- turweg präsentiert Sehenswürdigkeiten dieser ge Nonne im Kloster Him- Landschaft, die heute an Hessen grenzt. Vor melthal im Tal der Elsava 1748 war sie ein Teil der Markgenossenschaft starb. Das Michelbacher Freigericht, die von der heute hessischen Ge- Burggebäude muss spätes- meinde Freigericht-Somborn bis ins heute baye- tens im 30-jährigen Krieg rische Alzenau-Hörstein reichte. -

Muschelkalk-Steinbruch Am Frohnberg
Grenze der Gesteine Muschelkalk-Steinbruch am Frohnberg Fränkisches Schichtstufenland Muschelkalksteinbruch am Frohnberg in Ansbach In fränkischen Schulen ist ein wichtiger Bestandteil des Erdkundeunterrichts Wir beinden uns mit ca. 340 m Höhe im Steinbruch an der höchsten Stelle das Kennenlernen des fränkischen Schichtstufenlandes. Es handelt sich des Kulturwanderwegs, der – geologisch gesehen – durch den Obereren Bunt- dabei um den geologischen Aufbau der sandstein (Waldzell-Erlach-Ansbach) und den Unteren Muschelkalk (Ansbach- Region zwischen Alzenau und Regens- Waldzell) führt. burg. Viele verschiedene Gesteinsschichten la- Aufbau des gern übereinander, die in der Zeitspanne Muschelkalks und der dort von 439 bis 1 Millionen Jahren entstan- vorkommen- den sind. Von West nach Ost handelt es den Fossilien. sich um das kristalline Grundgebirge, Rotliegendes, Zechstein, Buntsandstein, Muschelkalk, Keuper, Jura und Kreide. Der Gneis ragt mit dem Hahnenkamm bei Alzenau bis 432 m in die Höhe. Das harte und gut spaltbare Gestein ist ein ehemaliger Granit mit einem Alter von ca. 410 Millionen Jahren, der vor ca. 330 Der Bildstock am Zugang zum Stein- Millionen Jahren durch Hitze und Druck in bruch weißt darauf hin, dass sich hier den Gneis umgewandelt wurde. Darüber Der Buntsandstein endet unterhalb von hier an der Kreisstraße am Ortsausgang früher Weinberge befunden haben. sammelte sich im Trias (251 - 200 Millio- von Ansbach in Richtung Waldzell. Der Flurnamen heißt dort bezeichnender- nen Jahre) zu Beginn des Erdmittelalters weise „Röte“ und kommt vom rötlich eingefärbten Tonboden, der letzten Schicht in wüstenähnlichem Klima roter Sand, der zu Buntsandstein wurde. Dessen des Buntsandsteins. Die Grenzschicht zum Muschelkalk wird Grenzgelbkalk höchste Erhebung ist der Geiersberg im Spessart mit 585 m. -

Prähistorische Und Neuzeitliche Besiedelung Am Bahnhof
„Bembel“ & Archäologie Prähistorische und neuzeitliche Besiedelung am Bahnhof Bahngeschichte von Kahl Archäologie Der Vertrag von 1850 zwischen Bayern und Hessen regelte den Bau der Die reichhaltigen prähistorischen Gräberfunde auf Kahler Gemarkung be- bayerischen Ludwigs-West-Bahn bis zur Landesgrenze Kahl mit der hes- legen die Siedlungskontinuität an günstigen Plätzen, wie Kahl einer ist. Als sischen Strecke, von Hanau kommend. Die Strecke 1896/97 der Wirt des nahe gelegenen Gasthauses Rabenau eine Radrenn- wurde am 22. Juni 1854 mit einem geschmückten bahn anlegen ließ, wurden bei den Erdarbeiten mehrere Gräber angeschnit- Extrazug eröffnet. An den Bahnstationen standen ten. Der Heimatforscher Elmar Freiherr von Haxthausen barg die Funde Ortsvorsteher, winkende Schulkinder und Bürger, und überließ sie später den Museen in Aschaffenburg und Hanau. Nicht dazu spielten Blaskapellen. alle Beigaben wurden Mit dem Zugbetrieb kamen auch Plichten auf die aufgenommen, da Bürger zu: Die bahnpolizeilichen Vorschriften wur- das damalige Vorge- den durch den Ortsdiener bekannt gegeben, so an hen heutigen wissen- welchen Punkten die Gleise überschritten werden schaftlichen Ansprü- durften und dass der Säu- und Gänsehirt durch die chen nicht entsprach. Bahn totgefahrene Tiere selbst bezahlen musste. Ein Ausschnitt aus ei- Ab 1873 zweigleisig verkehrten täglich vier Zug- ner alten lithographi- Eine von 1.260 Aktien, ausgegeben am 1. No- paare von Hanau nach Aschaffenburg. Die Fahrt schen Ansichtskarte vember 1898 von der nach Aschaffen- zeigt als Zeichnung Eisenbahn-& Industrie- burg dauerte 32 einen Teil der gefun- Gesellschaft Minuten. Die an denen Grabbeigaben die private Frankfurt-Hanauer-Eisen- (links). bahn-Gesellschaft verpachtete Strecke ging 1863 an die hessische Ludwigs- Ende 1985 wurden rund 750 m südöstlich des Kahler Bahnhofes zufäl- Eisenbahn-Gesellschaft über und 1897 lig Scherben von 17 Schalen und 7 Krügen gefunden, der sogenannte an die Preußische Staatsbahn.