Der Briefwechsel Alwine Wuthenow Klaus Groth
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
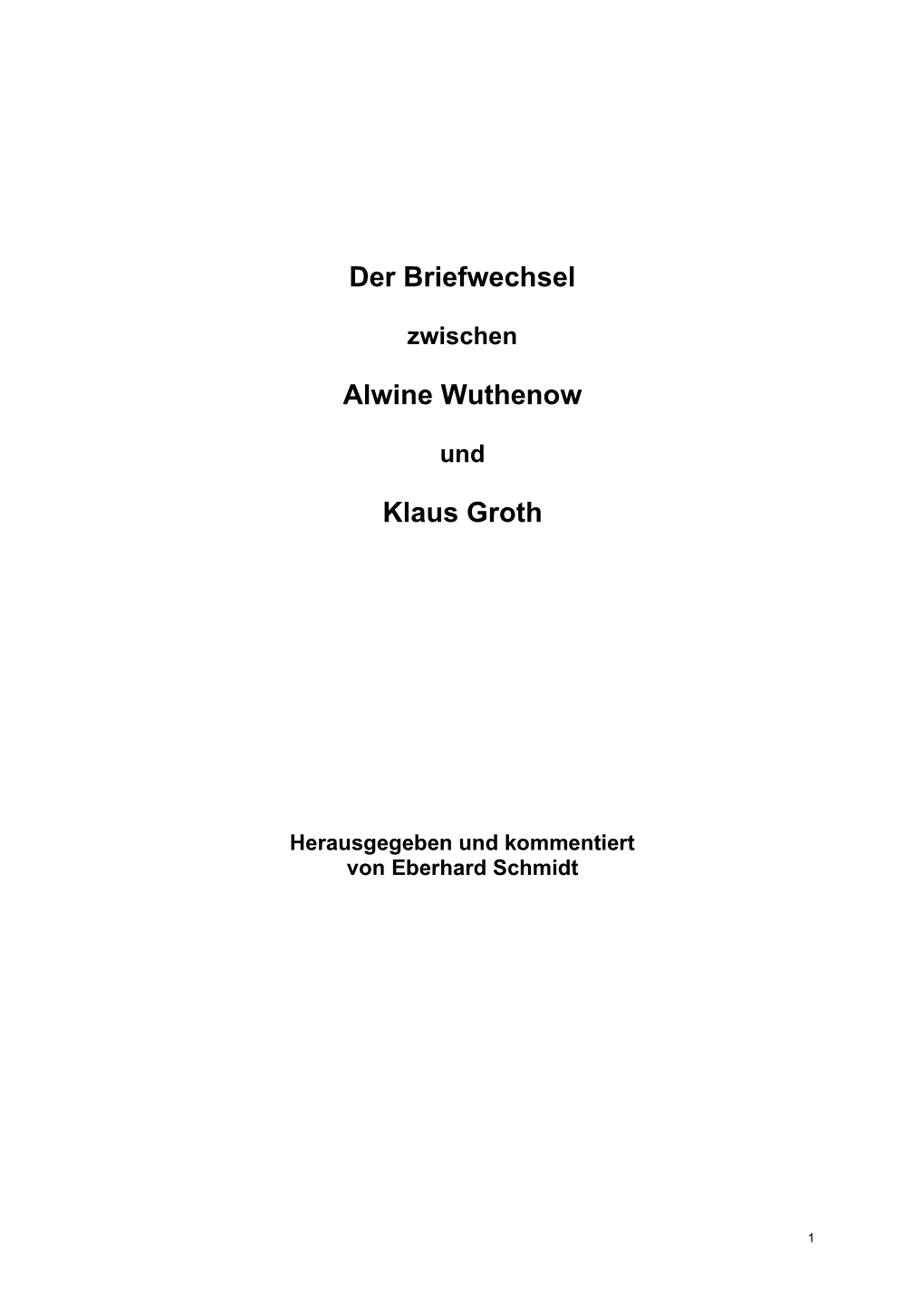
Load more
Recommended publications
-

Klaus Groth Bibliographie Unterpunkt 9
537 9. Groth-Ikonographie Allers, Christian Wilhelm: Berlin, Haltestelle am Brandenburger Thor. // In: C. W. Allers: Spreeathener [Bildmappe]. - Berlin, 1889. - Nr. 5. -- ["Groth in einer Gruppe von Damen und Herren, auf dem Pariser Platz stehend (auf die Straßenbahn wartend?), ganze Figur in Hut und Mantel, Halbprofil nach rechts, Bleistiftzeichnung in photolithographischer Reproduktion (...) Unterschrift: 'C. W. Allers 1889, Berlin, Haltestelle am Brandenburger Thor' (dieses ist im Hintergrund sichtbar). Vorn sieht man Dr. Julius Stinde in Unterhaltung mit 'den Buchholzen'. Wiedergabe in: 'Berlin '76' (Ullstein, Berlin), S. 5." (Ernst Schlee in KGGJ 19, 1977, S. 32). Groth ist außerdem als Rückenfigur mit Schirm auf dem Rücken dargestellt im Gespräch mit sich selbst. - Auch in: Schleswig-Holstein 1979, Nr.4, S.13.] Allers, Christian Wilhelm: Groth, Allers und ein Dritter, undatiert, Federzeichnung, Klaus-Groth-Museum, Heide. // In: KGGJ 19 (1977). - Nach S. 16, Abb. 16. -- ["Groth, Rückenfigur, (...) nimmt Glückwünsche von Allers und einem zweiten Herrn entgegen, karikiert, Federzeichnung auf Glückwunschkarte, 8,7 × 11,4 cm, mit eingeprägtem Monogramm C. W. A., umkreist in der Form einer Palette, dazu Pegasus als Steckenpferd und 'Prosit Neujahr!'. Nicht signiert und nicht datierbar." (Ernst Schlee in KGGJ 19, 1977, S. 33).] Allers, Christian Wilhelm: Groth, dem Maler Bokelmann in dessen Atelier Modell sitzend, Düsseldorf, 1890, Bleistiftzeichnung, Kunsthalle Hamburg. // In: KGGJ 19 (1977). - Nach S. 16, Abb. 14. -- ["(...) signiert: 'C. W. Allers. 23. 5. 1890 Düsseldorf', auch 'Klaus Groth' und 'L. Bokelmann' (...). - Abb.: Dithmarscher Landeszeitung vom 30./31. 5. 1959." (Ernst Schlee in KGGJ 19, 1977, S.32.] Allers, Christian Wilhelm: Groth mit Allers und einem Dritten (Warburg?), Thun, 1888. -

Sprache Der Gegenwart
SPRACHE DER GEGENWART Schriften des Instituts für deutsche Sprache Gemeinsam mit Hans Eggers, Johannes Erben, Odo Leys und Hans Neumann herausgegeben von Hugo Moser Schriftleitung: Ursula Hoberg BAND XXXVII Heinz Kloss DIE ENTWICKLUNG NEUER GERMANISCHER KULTURSPRACHEN SEIT 1800 2., erweiterte Auflage PÄDAGOGISCHER VERLAG SCHWANN DÜSSELDORF CIP-Kurztitelaufnahme der Deutschen Bibliothek Kloss, Heinz: Die Entwicklung neuer germanischer Kultursprachen seit 1800 [achtzehnhundert]. - 2., erw. Aufl. - Düsseldorf: Pädagogischer Verlag Schwann, 1978. (Sprache der Gegenwart; Bd. 37) ISBN 3-590-15637-6 © 1978 Pädagogischer Verlag Schwann Düsseldorf Alle Rechte Vorbehalten ■ 2. Auflage 1978 Umschlaggestaltung Paul Effert Herstellung Lengericher Handelsdruckerei Lengerich (Westf.) ISBN 3-590-15637-6 INHALTSVERZEICHNIS 0. Vorbemerkungen 9 0.1. Aus der Geschichte des Buches 9 0.2. Zum Titel des Buches 10 0.3. Einstimmung: Spracherneuerung und Nationalismus 13 1. Der linguistische und der soziologische Sprachbegriff 23 1.1. Über einige sprachsoziologische Grundbegriffe 23 1.1. 1. Ausbau und Abstand 23 1.1.2. Weiteres von den Einzelsprachen 30 1.2. Ausbaufragen 37 1.2.1. Ausbauweisen 37 1.2.2. Sachprosa 40 1.2.3. Ausbauphasen 46 1.2.4. Ausbaudialekte 55 1.2.5. Dachlose Außenmundarten 60 1.3. Abstandfragen 63 1.3.1. Wie m ißt man den Abstand? 63 1.3.2. Plurizentrische Hochsprachen 66 1.3.3. Scheindialektisierte Abstandsprachen 67 1.3.4. Kreolsprachen: ein von der Forschung neu er schlossener Typ von Abstandsprachen 70 1.4. Zusammenfassung und Vorausschau 79 1.4.1. Zusammenfassung des bisher Gesagten 79 1.4.2. Zur Gliederung der im 2. Kapitel näher behandelten Ausbausprachen und Ausbaudialekte 82 1.4.3. -

Hoofdstuk 1: De Negentiende Eeuw
24 Hoofdstuk 1: De Negentiende eeuw Eeuwen drongen eeuwen voor zich henen, En hoe menig hecht en trotsch gevaart Is er in dien maalstroom niet verdwenen, Waar ook zelfs geen spoor van werd bewaard.41 1.0 INLEIDING Een kentering De oppervlakte van Twenthe bestaat voor het grootste deel uit onafoogbare heidevelden, door oasen van be- bouwde akkers of hoog geboomte afgebroken. Niet dan door vlijt, die eeuwig sleepte en zwoegde, kon de bevol- king aan dezen ondankbaren bodem een sober bestaan ontwringen, zoo dat taai geduld, een langzaam wikkend overleg, spaarzaamheid en een ijzerhard ligchaam zich door de aarde zelve, welke zij betrad, in haar ontwikkelen moest. Verschillende oorzaken liepen er dus zamen, die de aangroeijende beschaving in het overige gedeelte der vrije Nederlanden, hier voormaals tegenhielden. De moeite om aan het brood te komen verbood de massa, om aan eenige beschaving, altijd de dochter van overvloed en gemak, te denken. Aldus beschreef de Friese taalgeleerde en predikant te Deventer Joost Hiddes Halbertsma het oostelijk deel van de voormalige drieguldensprovincie in de Overijsselsche Almanak voor Oudheid en Letteren (OA) in 1837.42 Willem de Clercq (1795-1844) die van 1812 tot 1835 dikwijls Almelo bezocht, had al in zijn dagboek geschreven: “Het is hier een materieel land en ik droom van niet als van weefspoelen en calicots”. Wellicht overdreef hij wat, want hij verhaalde in zijn dagboeken ook van de vermaken na pleziertochtjes. Men uitte zich dan in proza en poëzie en in teken- en schilder- kunst.43 Maar toch. Twente werd niet voor niets wel de Overijsselse Achterhoek genoemd. -

© 2012 Juljana Gjata Hjorth Jacobsen ALL RIGHTS RESERVED
© 2012 Juljana Gjata Hjorth Jacobsen ALL RIGHTS RESERVED SCHLESWIG-HOLSTEIN MEERUMSCHLUNGEN AND THE CALL FOR NATIONALISM: NATIONAL IDENTITY UNDER CONSTRUCTION ON THE GERMAN AND DANISH BORDER IN SELECTED WORKS BY THEODOR STORM, THEODOR FONTANE, AND HERMAN BANG By JULJANA GJATA HJORTH JACOBSEN A Dissertation submitted to the Graduate School-New Brunswick Rutgers, The State University of New Jersey In partial fulfillment of the requirements For the degree of Doctor of Philosophy Graduate Program in German Written under the direction of Martha Helfer And approved by ___________________ ___________________ ___________________ ___________________ New Brunswick, New Jersey May 2012 ABSTRACT OF THE DISSERTATION Schleswig-Holstein meerumschlungen and the Call for Nationalism: National Identity Under Construction on the German and Danish Border in Selected Works by Theodor Storm, Theodor Fontane, and Herman Bang By JULJANA GJATA HJORTH JACOBSEN Dissertation Director: Martha B. Helfer My dissertation examines selected German and Danish literary texts of the late nineteenth century that employ ideological notions of nationalism for the purpose of constructing and stabilizing national identity. The groundwork for the research centers on specific times in nationalist movements in Europe and a specific setting on the border region of Schleswig-Holstein. The urgency of this project lies especially in the effort to understand the shifting qualities and perceptions of nationalism as both a destructive and productive force in current discourses of globalization. In my analysis of four literary narratives, Theodor Storm’s novellas Ein grünes Blatt (1850) and Abseits (1863), Theodor Fontane’s Unwiederbringlich (1891), and Herman Bang’s Tine (1889), I demonstrate how national identity is constructed on the basis of a firm nationalism and constantly destabilized when confronted with the presence ii of an Other by the border. -

PDF Van Tekst
Lyts hânboek fan de Fryske literatuer Klaes Dykstra & Bouke Oldenhof bron Klaes Dykstra en Bouke Oldenhof, Lyts hânboek fan de Fryske literatuer. Afûk, Leeuwarden 1997 (tweede, verbeterde en aangevulde druk) Zie voor verantwoording: http://www.dbnl.org/tekst/dyks005lyts01_01/colofon.php © 2010 dbnl / Bouke Oldenhof & erven Klaes Dykstra i.s.m. 5 Wurd foarôf Yn 1957 ferskynde de twadde, útwreide printinge fan Jan Tjittes Piebenga syn Koarte Skiednis fan de Fryske Skriftekennisse, in útjefte dêr't hy doedestiids mei rjocht en reden de Wassenberghmedalje foar takend krigen hat. It boek wie mei oerjefte en meinimmend skreaun, joech de bliken fan in ferbjusterjende belêzenheid en mocht yn it doalhôf fan 'e Fryske skriften sa de betroubere paadwizer hjitte dêr't lange tiden sa'n djip ferlet fan west hie. Beswieren waarden lykwols ek daliks oanfierd. Guon mienden, it boek soe folle mear de literêre ‘bodders’ beljochtsje as har wurk. Oaren wiisden derop, dat dizze skiednis by 't útkommen eins fuort al ferâldere wie, om't de jongste literatuer der net in earlik en folweardich plak yn taskikt krigen hie. Wer oaren koene oantsjutte, dat it wurk op 't stik fan 'e feiten ek wolris net hielendal lyk rûn, of dat de yndieling hjir en dêr wol oars en better kind hie. Underwilens soe him yn Fryslân nei de oarloch in literêr stoarmeftige fearnsieu trochsette, jierren dêr't navenant op syn minst likefolle yn feroarje soe as oars suver yn ieuwen: Fryslân, altiten wend oan in betreklike lijte, soe - wat skruten earst noch - yn 'e sigen fan wrâldomfiemjende streamingen komme te stean. -

Metalinguistic Discourses on Low German in the Nineteenth Century*
How to Deal with Non-Dominant Languages – Metalinguistic Discourses on Low German in the Nineteenth Century* Nils Langer (Flensburg/Bristol) and Robert Langhanke (Flensburg/Kiel) Abstract This paper discusses nineteenth-century metalinguistic discussions of Low German, an authochthonous of Northern Germany, which, having lost its status as a written language suitable for formal discourse during the Early Modern period, has since been reduced to the spoken domain. During the nineteenth century the language was on the verge of enjoying a revival, with original poetry being published and extensive discussions as to whether Low German ought to play a role in formal education. As this article shows, this discussion was intense and controversial. Comparing the views of Klaus Groth, the leading proponent of Low German in the second half of the nineteenth century, with the internal debates amongst school teachers - hitherto never discussed by the scholarly literature – this article demonstrates the intellectual and ideological split felt by these educational practioners in their views of Low German: on the one hand, they recognise the cultural value of Low German as the historical language of the North and the native language of the pupils they teach, on the other hand they agree with each other that the language of education and science, as well as national unity, can only be High German. We hope to show with our discussion not only how very similar modern thinking on the use of Low German is to these historical discussions but also how the status and perception of many regional and minority languages across the world has been subject to the same or very similar thoughts and pressures. -

Chips from a German Workshop. Vol. III. by F
The Project Gutenberg EBook of Chips From A German Workshop. Vol. III. by F. Max Müller This eBook is for the use of anyone anywhere at no cost and with almost no restrictions whatsoever. You may copy it, give it away or re-use it under the terms of the Project Gutenberg License included with this eBook or online at http://www.gutenberg.org/license Title: Chips From A German Workshop. Vol. III. Author: F. Max Müller Release Date: September 10, 2008 [Ebook 26572] Language: English ***START OF THE PROJECT GUTENBERG EBOOK CHIPS FROM A GERMAN WORKSHOP. VOL. III.*** CHIPS FROM A GERMAN WORKSHOP BY F. MAX MÜLLER, M. A., FOREIGN MEMBER OF THE FRENCH INSTITUTE, ETC. VOLUME III. ESSAYS ON LITERATURE, BIOGRAPHY, AND ANTIQUITIES. NEW YORK: CHARLES SCRIBNER AND COMPANY. 1871. Contents DEDICATION. 2 I. GERMAN LITERATURE. 3 LIST OF EXTRACTS FOR ILLUSTRATING THE HISTORY OF GERMAN LITERATURE. 39 II. OLD GERMAN LOVE-SONGS. 48 III. YE SCHYPPE OF FOOLES. 58 IV. LIFE OF SCHILLER. 68 V. WILHELM MÜLLER. 1794-1827. 90 VI. ON THE LANGUAGE AND POETRY OF SCHLESWIG-HOLSTEIN. 108 VII. JOINVILLE. 144 VIII. THE JOURNAL DES SAVANTS AND THE JOUR- NAL DE TRÉVOUX. 179 IX. CHASOT. 187 X. SHAKESPEARE. 200 XI. BACON IN GERMANY. 203 XII. A GERMAN TRAVELLER IN ENGLAND. 217 XIII. CORNISH ANTIQUITIES. 223 XIV. ARE THERE JEWS IN CORNWALL? . 268 XV. THE INSULATION OF ST. MICHAEL'S MOUNT. 294 XVI. BUNSEN. 317 LETTERS FROM BUNSEN TO MAX MÜLLER IN THE YEARS 1848 TO 1859. 360 Footnotes . 485 [i] DEDICATION. TO FRANCIS TURNER PALGRAVE, IN GRATEFUL REMEMBRANCE OF KIND HELP GIVEN TO ME IN MY FIRST ATTEMPTS AT WRITING IN ENGLISH, AND AS A MEMORIAL OF MANY YEARS OF FAITHFUL FRIENDSHIP. -

Klaus Groth Bibliographie Unterpunkt 6C
198 6.3. Beiträge zur Person 6.3.0. Allgemeines Andresen, Dieter: Würde des Volkes : Politische Zeitgenossenschaft in Werk und Leben Klaus Groths. -- HE: 8.2. Bartels, Adolf: Klaus Groth : Sein Leben und seine Werke. -- HE: 6.4.1. -- [Nur wenig und in den Daten nicht zuverlässig zum Leben, hauptsächlich zum Werk. - Zweite Aufl. von Bartels Adolf: Klaus Groth. Zu seinem 80. Geburtstage.] Bartels, Adolf: Klaus Groth : Zu seinem 80. Geburtstage. -- HE: 6.4.1. -- [Zwischen Darstellung des Werkes kurze Informationen zum Leben (nicht zuverlässig in den Daten).] Bieder, Theobald: Klaus Groth : Deutsche Dichter am Schreibtisch 3. // In: Norag. - 1929 v. 17.3. -- Nach: Qu. - 22 (1928/29). - S.108. -- [Mit Bildern, Handschriften u. ungedr. Gedicht. - NE: 6.1.2.; 6.4.2.3.; 9.] Claus Groth // In: Männer der Zeit : Biographisches Lexikon der Gegenwart; Mit Supplement: Frauen der Zeit. - Leipzig : Lorck, 1862. - S. 182. -- [Eine Reihe von Angaben ist fehlerhaft; die Fehler werden von Carl Rosenberg (Klaus Groth som plattydsk Digter, s. 6.4.2.) weitergetragen.] Gleim, Bernhard: Wessling, Berndt W.: Versuch über Klaus Groth. : Teil 1: Der geistige Standort, 8.9.1979 - Teil 2: Der verhinderte Akademiker, 15.9.1979 - Teil 3: Zwischen Glauben und Unglauben, 21.9.1979 ; In: "Heimatfunk am Wochenend" - Radio Bremen. // In: Qu. - 70 (1980). - S. 132-136. -- [Bespr. d. Hörfolge.] Hoffmann, Georg: Dornen am Dichterpfad. // In: Rheinisch Westfälische Zeitung. - 1919 v. 27.4. -- Nach: Qu. - 12 (1918/19). - S.123. -- [NE: 6.3.10.10.; 6.3.12.4.] Jensen, Wilhelm: Vom Schreibtisch und aus dem Atelier : Heimat- Erinnerungen ; III. Klaus Groth. -- HE: 8.1. -
Klaus Groth Bibliographie Unterpunkt 6E
314 6.4. Beiträge zum Werk 6.4.1. Zum Gesamtwerk Bartels, Adolf: Klaus Groth. -- HE: 6.3.12.4. -- [Zeitungsartikel zu Leben und Werk.] Bartels, Adolf: Klaus Groth : Sein Leben und seine Werke. - Heide : Westholsteinische Verlagsanstalt, 1943. -- [2. Aufl. von Bartels Adolf: Klaus Groth. Zu seinem 80. Geburtstage. - Würdigung der Gesamtdichtung Groths, wenig zu seinem Leben, in Daten nicht immer zuverlässig. - NE: 6.3.0.] Bartels, Adolf: Klaus Groth : Zu seinem 80. Geburtstage. - Leipzig : Avenarius, 1899. -- [2. Aufl. s. Bartels, Klaus Groth. Sein Leben und seine Werke. 1943. - Ästhetische und literarische Würdigung. Stellung in der deutschen Literatur. - Bespr. in: Die Heimat 9 (1899) Nr. 6 v. Juni, S.131-132 (Hermann Krumm). - NE: 6.3.0.; 6.3.12.3.] Ein bedeutender Interpret Klaus Groths : Zum Tode Richard Mehlems. -- HE: 12.2. Beutin, Wolfgang: „Die Plattdeutsche Literatur ist plötzlich wieder auf den Markt getreten und sogar mit einigem Lärm“ : zur Renaissance der niederdeutschen Dichtung im Nachmärz (Fritz Reuter - John Brinckman - Klaus Groth). // In: Eke, Norbert Otto und Renate Werner (Hrsg.): Vormärz - Nachmärz / unter Mitarbeit von TanjaCoppola. - Bielefeld : Aisthesis Verlag, 2000. - S. 357-395. Biese, Alfred: Die lyrische Kunst Klaus Groths. -- HE: 6.3.12.4. Bödewadt, Jacob: Klaus Groths Werk und Erbe. // In: Jahrbuch für den Kreis Pinneberg 4 (1920). - S. 31-38. -- [Auch in: Westermanns illustrierte deutsche Monatshefte (1919) Nr. 8 (nach Qu. 12, 1918/19, S.123). - NE: 6.1.2.; 6.3.12.4.; 8.2.] Bödewadt, Jacob: Zwischen zwei Meeren : 25 Dichter der Nordmark ; Ein niederdeutsches Dichterbuch. -- HE: 11. -- [Darin S. 464-465: Kurze Würdigung von Groths nddt. -

Publikationen Robert Langhanke Flensburg / Kiel
Publikationen Robert Langhanke Flensburg / Kiel (Stand: Oktober 2020) 1. Herausgeberschaft (Sammelbände) 1.) Peters, Robert: Mittelniederdeutsche Studien. Gesammelte Schriften 1974 bis 2003. Herausgegeben von Robert Langhanke. Bielefeld 2012. 2.) Niederdeutsche Syntax. Herausgegeben von Robert Langhanke, Kristian Berg, Michael Elmentaler und Jörg Peters. Hildesheim, Zürich und New York 2012 (Germanistische Linguistik. Bd. 220). 3.) Variation, Wandel, Wissen. Studien zum Hochdeutschen und Niederdeutschen. Herausgegeben von Yvonne Hettler, Carolin Jürgens, Robert Langhanke und Christoph Purschke. Frankfurt am Main u. a. 2013 (Sprache in der Gesellschaft. Bd. 32). 4.) Sprache, Literatur, Raum. Festgabe für Willy Diercks. Herausgegeben von Robert Langhanke. Bielefeld 2015. 5.) Modernisierung in kleinen und regionalen Sprachen. Herausgegeben von Elin Fredsted, Robert Langhanke und Astrid Westergaard. Hildesheim, Zürich und New York 2015 (Kleine und regionale Sprachen. Bd. 1). 6.) Debus, Friedhelm: Kleinere Schriften. Band 5. Herausgegeben von Hans-Diether Grohmann und Robert Langhanke. Hildesheim, Zürich und New York 2017. 7.) Klaus Groth zum 200. Geburtstag. Jubiläumsmagazin. „An Hęben seil de stille Maan“. Herausgegeben von der Klaus-Groth-Gesellschaft. Redaktion: Robert Langhanke, Bernd Rachuth und Werner Siems. Heide 2019. 8.) Klaus-Groth-Lesebuch. Herausgegeben von Robert Langhanke. Heide 2019. 9.) Dynamik in den deutschen Regionalsprachen: Gebrauch und Wahrnehmung. Beiträge aus dem Forum Sprachvariation. Herausgegeben von Matthias Hahn, -

Galavics Gábor
GALAVICS GÁBOR RICHARD MÜHLFELD DOKTORI ÉRTEKEZÉS 2015 Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem 28. számú művészet- és művelődés- történeti tudományok besorolású doktori iskola RICHARD MÜHLFELD EGY KIVÉTELES TEHETSÉGŰ KLARINÉTMŰVÉSZ ÉLETPÁLYÁJA GALAVICS GÁBOR TÉMAVEZETŐ: HORVÁTH BALÁZS DOKTORI ÉRTEKEZÉS 2015 III Tartalomjegyzék Köszönetnyilvánítás V Bevezetés VI 1. A klarinét kialakulása és fejlődése a 18-19. században 1 1.1. A chalumeau és az első klarinétok 1 1.2. A klarinét a klasszicizmus korában 4 1.3. Fejlesztések a 19. században 7 1.4. A Bärmann-Ottensteiner klarinétok kialakulása, és Richard Mühlfeld hangszerei 7 1.5. A klarinét kezdeti alkalmazása és elterjedése a 18. században 12 2. A klarinét kamarazenei alkalmazásának áttekintése Mozarttól Brahmsig 14 2.1.1. Mozart megismerkedése a klarinéttal 14 2.1.2. A Harmoniemusik és az első Mozart-kamaraművek 15 2.1.3. A Stadlerhez köthető művek 17 2.2. Beethoven klarinétos kamaraművei 18 2.3. A klarinétrepertoár fejlődése a 19. század első felében 21 2.4. 19. század második felének klarinétos kamarazenéje 26 3. Richard Mühlfeld, Brahms klarinétosa 28 3.1. Gyermekkor és zenei tanulmányok 29 3.2. A tehetség kibontakozása és a korai sikerek 30 3.3. A megismerkedés Johannes Brahmsszal 33 3.4. Johannes Brahms klarinétos kamaraműveinek keletkezése 36 3.4.1. Az Op.114-es a-moll trió és az Op.115-ös h-moll klarinétötös 37 3.4.2. A nemzetközi karrier első állomásai és az új Brahms-művek fogadtatása 40 3.4.3. Az Op.120-as f-moll és Esz-dúr szonáta 47 3.5. Mühlfeld életének utolsó évtizede 52 4. Mühlfeld és Brahms hatására keletkezett új klarinétművek 58 4.1. -

PDF of Rippley Article
RAMSEY COUNTY Minnesota’s German Forty-eighter Albert Wolff: Brilliant Career, Tragic Death LaVern J. Rippley A Publication of the Ramsey County Historical Society Hıstory —Page 12 Spring 2016 Volume 51, Number 1 “Brighter and Better for Every Person”: Building the New Salvation Army Rescue Home of St. Paul, 1913 Kim Heikkila, page 3 “Children of the Home.” This large portrait of twelve children is from the Salvation Army Rescue Home and Maternity Hospital annual report for the year ending September 30, 1916. The home, located on Como Avenue in St. Paul, cared for 207 children that year, 109 of whom had been born in the home. The inset photo is Adjutant True Earle, superintendent of the Home from 1913 to 1918. Photo courtesy of The Salvation Army USA Central Territory Historical Museum. RAMSEY COUNTY HISTORY RAMSEY COUNTY President Chad Roberts Founding Editor (1964–2006) Virginia Brainard Kunz Editor Hıstory John M. Lindley Volume 51, Number 1 Spring 2016 RAMSEY COUNTY HISTORICAL SOCIETY THE MISSION STATEMENT OF THE RAMSEY COUNTY HISTORICAL SOCIETY BOARD OF DIRECTORS ADOPTED BY THE BOARD OF DIRECTORS ON JANUARY 25, 2016: James Miller Preserving our past, informing our present, inspiring our future Chair Jo Anne Driscoll First Vice Chair Carl Kuhrmeyer C O N T E N T S Second Vice Chair Susan McNeely 3 “Brighter and Better for Every Person”: Secretary Building the New Salvation Army Rescue Home Kenneth H. Johnson Kim Heikkila Treasurer William B. Frels 12 Minnesota’s German Forty-eighter Immediate Past Chair Albert Wolff: Brilliant Career, Tragic Death Julie Brady, Anne Cowie, Cheryl Dickson, Mari Oyanagi Eggum, Thomas Fabel, LaVern J.