GEMEINDE REICHRAMING Teilbereich Nord
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
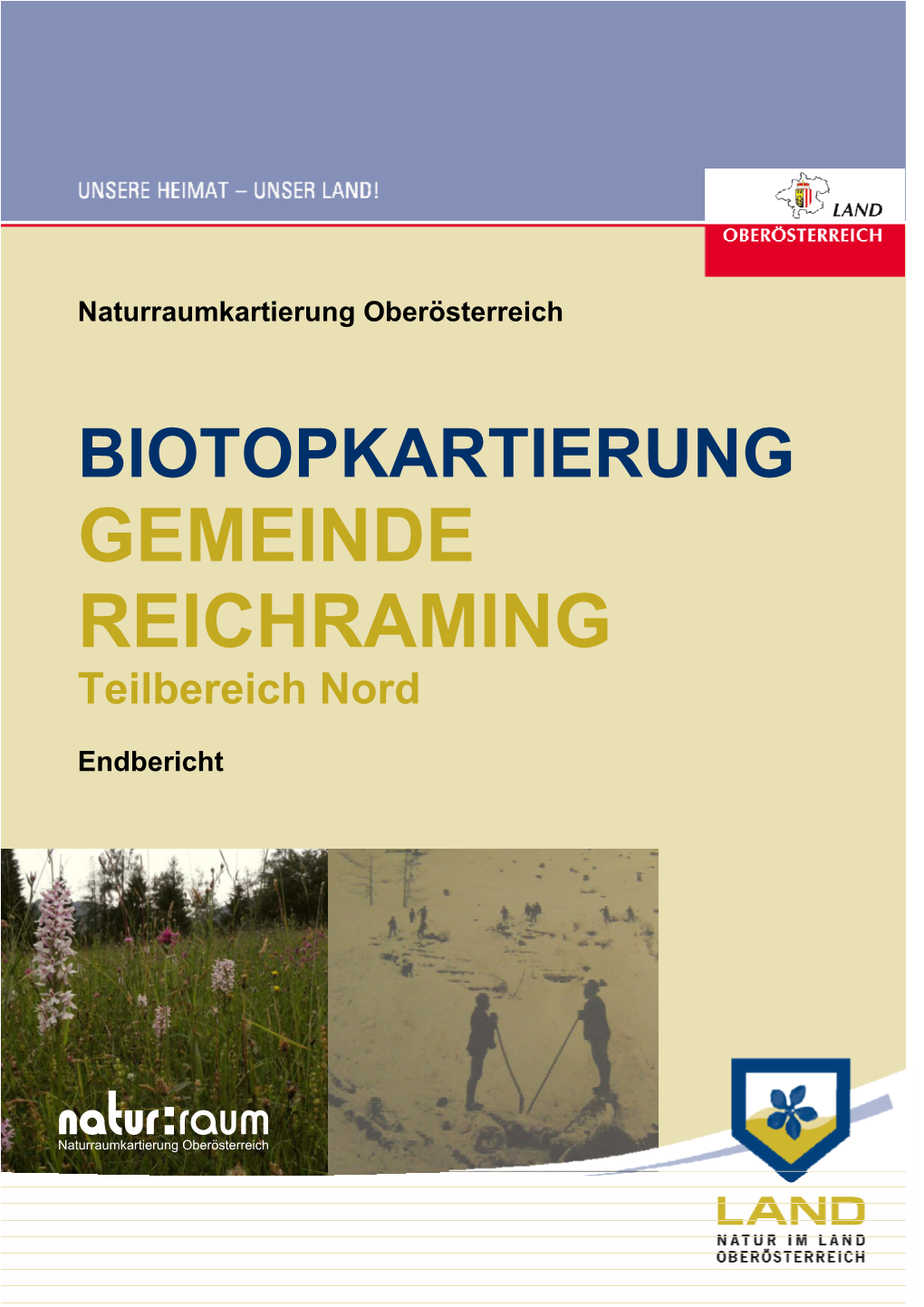
Load more
Recommended publications
-

Bildungskatalog 2019/2020 Unter Finden Sie Die Regelmäßig Aktualisierte Version Des Bildungskatalogs 2019/2020
Bildungskatalog 2019/2020 Unter www.steyrland.at/bildungskatalog finden Sie die regelmäßig aktualisierte Version des Bildungskatalogs 2019/2020. Sie können uns gerne jederzeit Ihr Bildungsangebot senden, an E-Mail: [email protected] Impressum: Für den Inhalt verantwortlich: Verein zur Förderung eines Technologie- und Dienstleistungszentrum Ennstal • c/o TDZ Ennstal GmbH • Eisenstraße 75 • 4462 Reichraming • Austria • Sprecher der Initiative „steyrland – wir rocken die region!“ MMag. Johannes Behr-Kutsam • Ansprechpartnerin für den Bildungskatalog: Karin Fachberger, [email protected], Tel.: 0664 8241139 • Fotos Cover: 7 x Shutterstock • Druck: Mittermüller • Idee, Konzeption und Artwork: Kommhaus Bad Aussee, www.kommhaus.com • Vorbehaltlich Änderungen, Irrtümer und Druckfehler • Genderhinweis: Wir legen großen Wert auf geschlechtliche Gleichberechtigung. Aufgrund der Lesbarkeit der Texte wird bei Bedarf nur eine Geschlechtsform gewählt. Dies impliziert keine Benachteiligung des jeweils anderen Geschlechts. Editorial Die Initiative steyrland – wir rocken die Region! macht Steyr-Land noch attraktiver – für Unternehmen, Gemeinden, Vereine, Bildungseinrichtungen und Familien. Zahlreiche Projekte unterstreichen die Bedeutung des Wirtschaftsstandorts Steyr-Land. Nach dem Erfolg der ersten Auflage konnten wir in dieser zweiten Auflage unser Bildungsangebot erweitern. 58 regionale Betriebe, Bildungseinrich- tungen, Gemeinden, Verbände und Vereine laden mit mehr als 90 Angeboten Schülerinnen und Schüler ein, einen Blick hinter die Kulissen zu werfen. Sie bieten den jungen Menschen kostenlos und mit persönlicher Betreuung die Gelegenheit, verschiedene Bereiche der regionalen Wirtschaft schon © Susanne Weiss frühzeitig kennenzulernen. Johannes Behr-Kutsam (2. v. l.), Sprecher der Initiative mit seinen Stellvertretern Martin Hartl, Judith Ringer und Alois Gruber (v. l.). Nicht im Bild: Peter Guttmann Die Schülerinnen und Schüler können so in unterschiedliche Branchen hilfe für den weiteren Karriereweg. -

Ortsbauernobmänner, Bäuerinnenbeirätinnen Und Stv
Ortsbauernobmänner, Bäuerinnenbeirätinnen und Stv. Bäuerinnenbeirätinnen BBK Ortsbauernschaft Ortsbauernobmann/Obfrau Bäuerinnenbeirätin Bäuerinnenbeirätin Stv Braunau Altheim Rudolf Wintersteiger Petra Steinhögl Gallenberg 7 Gaugsham 10 4950 Altheim 4950 Altheim Braunau Aspach Johann Angleitner-Kettl Ing. Christine Wimmleitner Ursula Schachinger Kasting 5 Teinsberg 2 Katzlberg 3 5252 Aspach, Innkreis 4933 Wildenau 5252 Aspach, Innkreis Braunau Auerbach Johann Birgmann Oberkling 1 5224 Auerbach Braunau Braunau am Inn Ing. Maximilian Ober Osternberger Straße 46 5280 Braunau am Inn Braunau Burgkirchen Ing. Josef Ortner Edeltraud Haberfellner Eva Maria Ortner Passberg 2 Fürch 6 Passberg 2 5274 Burgkirchen 5274 Burgkirchen 5274 Burgkirchen Braunau Eggelsberg Anton Kammerstetter Melanie Wimmer Vera Andrea Kainzbauer Haselreith 10 Ibm 42 Untergrub 1/1 5142 Eggelsberg 5142 Eggelsberg 5142 Eggelsberg Braunau Feldkirchen bei Mattighofen Andreas Stockhammer Manuela Kainz Christina Theresia Huber Oichten 57 Gietzing 3 Kampern 16 5143 Feldkirchen bei Mattighofen 5143 Feldkirchen bei Mattighofen 5143 Feldkirchen bei Mattighofen Braunau Franking Walter Pfaffinger Buch 5 5131 Franking Braunau Geretsberg Otto Felber Maria Eichberger Anneliese Brunthaler Pimbach 3 Henkham 8 Mühlberg 4 5131 Franking 5132 Geretsberg 5132 Geretsberg Braunau Gilgenberg am Weilhart Manfred Hirschlinger Maria Huber Revier 4 Hub 5 5133 Gilgenberg am Weilhart 5133 Gilgenberg am Weilhart Braunau Haigermoos Ernestine Huber-Hochradl Marianne Renzl Erika Tischlinger Pfaffing 1 Weyer -

Landesgesetzblatt Für Oberösterreich
P.b.b. 01Z022528 K Seite 209 Erscheinungsort Linz Verlagspostamt 4021 Linz LANDESGESETZBLATT FÜR OBERÖSTERREICH Jahrgang 2003 Ausgegeben und versendet am 30. Juni 2003 81. Stück Nr. 81 Verordnung der Oö. Landesregierung, mit der die Vereinbarung der Gemeinden Gaflenz, Großraming, Laussa, Losenstein, Maria Neustift, Reichraming, Weyer-Land und Weyer-Markt über die Bildung eines Gemeindeverbandes für die Errichtung und den Betrieb von Betriebs- ansiedlungsgebieten genehmigt wird Nr. 81 Anlage Verordnung der Oö. Landesregierung, mit der die Vereinbarung SATZUNGEN DES VERBANDES der Gemeinden Gaflenz, Großraming, Laussa, "REGIONALER WIRTSCHAFTSVERBAND OÖ Losenstein, Maria Neustift, Reichraming, Weyer- ENNSTAL" Land und Weyer-Markt über die Bildung eines Gemeindeverbandes für die Errichtung und den Die Gemeinden Gaflenz, Großraming, Laussa, Losen- Betrieb von Betriebsansiedlungsgebieten genehmigt wird stein, Maria Neustift, Reichraming, Weyer-Land und Weyer-Markt bilden zum Zweck der Errichtung und des Betriebes von Betriebsansiedlungsgebieten einen Auf Grund des § 2 Z. 3, des § 4 und des § 5 Abs. 1 und Gemeindeverband im Sinn des Oö. Gemeindeverbände- 2 des Oö. Gemeindeverbändegesetzes, LGBl. Nr. gesetzes, der im folgenden "Verband" genannt wird. Der 51/1988, in der Fassung des Landesgesetzes LGBl. Nr. Verband wird durch freie Vereinbarung der beteiligten 113/2002 wird verordnet: Gemeinden mit Genehmigung der Aufsichtsbehörde gebildet. § 1 I. ALLGEMEINES (1) Die Vereinbarung der Gemeinden Gaflenz, Großra- ming, Laussa, Losenstein, Maria Neustift, Reichraming, § 1 Weyer-Land und Weyer-Markt über die Bildung eines Gemeindeverbandes für die Errichtung und den Betrieb Name, Sitz und Geschäftsstelle von Betriebsansiedlungsgebieten wird genehmigt. 1. Der Verband trägt den Namen "Regionaler Wirt- (2) Der Wortlaut der im Abs. 1 genannten Vereinbarung schaftsverband oö Ennstal". -

Amtsblatt Mai 2019
5 Amtsblatt der Stadt Steyr Informationen für Bürger und amtliche Mitteilungen 4400 Steyr 17. Mai 2019 17. 62. Jahrgang Die Bäume auf der Himmlitzer Streuobstwiese in RM 01A023457 K RM 01A023457 An einen Haushalt der Unterhimmler Au stehen in voller Blüte. Seit zehn Jahren gibt es diese 2,5 Hektar große Anlage, die dazu AG Post Österreichische einladen soll, die Vielfalt der heimischen Obstraritäten zu erkunden, zu pflücken und zu kosten. 9 1 5 WOHNUNGEN noch verfügbar! Die Obermair Immobilien GmbH errichtet ab Mai in Dietach insgesamt 11 hochwertige Terrassenwohnungen mit faszinierendem Fernblick und Wohnflächen von 52 bis 116 m2. Sichern Sie sich jetzt Ihre Wohnung! MIETE: 71 m2 WOHNUNG + EIGENGARTEN Teilmöblierte Erdgeschoß-Wohnung im Wohnpark Steyrdorf Die Wohnung verfügt über 3 Zimmer, 24,46 m2 Terrasse und 121 m2 Eigengarten, italienische Designerküche inkl. E-Geräte, 2 Tiefgaragen- KAUF: 805 m2 GRUNDSTÜCK IN ST. ULRICH Stellplätze sind in der Miete bereits inkludiert! HWB 15 kWh/m²a Sonnige Lage – Jetzt anrufen! | Kaufpreis € 173.075,- Ab sofort – Jetzt anrufen! | Miete inkl. BK € 977,19 BAUBEGINN HERBST 2019 Die Obermair Immobilien GmbH errichtet ab Herbst 2019 in Sierning 15 Premium-Terrassenwohnungen mit Wohnflächen von 52 bis 91 m2. VERKAUFSSTART bereits erfolgt! OBERMAIR Immobilien GmbH | Leopold-Werndl-Str. 27, 4400 Steyr | T: 07252 / 91 211 | E: [email protected] | www.obermair-immobilien.at Die Seite des Schlanke Verwaltung und dem Genussland Oberösterreich, einer Platt- gutes Polit-Klima form für lokale Produkte. Mehr als 50 Produ- Bürgermeisters Auch in der Verwaltung der Stadt hat sich viel zenten werden in Steyr ihre Spezialitäten prä- getan. -

Sinemurian Biostratigraphy of the Tannscharten Section
ZOBODAT - www.zobodat.at Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database Digitale Literatur/Digital Literature Zeitschrift/Journal: Austrian Journal of Earth Sciences Jahr/Year: 2018 Band/Volume: 111 Autor(en)/Author(s): Lukeneder Petra, Lukeneder Alexander Artikel/Article: Sinemurian biostratigraphy of the Tannscharten section near Reichraming (Lower Jurassic, Schneeberg Syncline, Northern Calcareous Alps) 92- 110 download https://content.sciendo.com/view/journals/ajes/ajes-overview.xml Austrian Journal of Earth Sciences Vienna 2018 Volume 111/1 092 - 110 DOI: 10.17738/ajes.2018.0007 Sinemurian biostratigraphy of the Tannscharten section near Reichraming (Lower Jurassic, Schneeberg Syncline, Northern Calcareous Alps) Petra LUKENEDER1)*) & Alexander LUKENEDER1) 1) Museum of Natural History Vienna, Burgring 7, 1010 Vienna, Austria; *) Corresponding author: [email protected] KEYWORDS Ammonites; Allgäu Formation; Lower Jurassic; Reichraming Nappe; Northern Calcareous Alps Abstract Lower Jurassic ammonites were collected from deep-water limestones of the Tannscharten section, southwest of Reich- raming (Northern Calcareous Alps, Upper Austria). The outcrop provides a rich Upper Sinemurian (Lower Jurassic) ammo- nite fauna of the Allgäu Formation. The area is situated in the westernmost part of the Schneeberg Syncline in the north of the Reichraming Nappe (High Bajuvaric Unit). The ammonite fauna consists of seven different genera, each apparently represented by 1–2 species. Echioceratids are the most frequent components (Echioceras, Leptechioceras, Paltechioceras), followed by the phylloceratids (Juraphyllites, Partschiceras) and oxynoticeratids (Gleviceras, Paroxynoticeras). Juraphyllites libertus, Partschiceras striatocostatum, Gleviceras paniceum, Echioceras quenstedti, Echioceras raricostatoides, Paltechioceras boehmi, Leptechioceras meigeni, Leptechioceras macdonnelli and Paltechioceras oosteri are new for the Schneeberg Syn- cline and allow for the first time a detailed biostratigraphy of the Echioceras raricostatum zone. -

Übersichtskarte Der Wasserverbände In
Wasserverbände für Schutzwasserbau in OÖ Schwarzenberg am Böhmerwald Klaffer am Hochficht Wasserverbände Ulrichsberg Gewässerinstandhaltung im Bezirk Vöcklabruck Gewässerbezirk Aigen im Mühlkreis Julbach Schlägl Gewässerinstandhaltung im Bezirk Vöcklabruck Grieskirchen Nebelberg , Hochwasserschutz Großraum Schwanenstadt Peilstein im Mühlviertel St.Oswald bei Haslach Leopoldschlag Lichtenau im Mühlkreis Gewässerinstandhaltung im Bezirk Vöcklabruck Kollerschlag Berg bei Rohrbach , Mattig Oepping Windhaag bei Freistadt Rohrbach/Oberösterreich Haslach an der Mühl Afiesl Schönegg Gewässerinstandhaltung im Bezirk Vöcklabruck Oberkappel Sarleinsbach St.Stefan am Walde Rainbach im Mühlkreis Sandl Freinberg Reichenthal , Mondessklause Helfenberg Vorderweißenbach Grünbach Atzesberg Mattig Esternberg Auberg Bad Leonfelden Liebenau Schardenberg Pfarrkirchen i.Mühlkreis Arnreit Ahorn Vichtenstein Hörbich Neustift im Mühlkreis St.Peter am Wimberg Waldburg Zeichenerklärung Putzleinsdorf Schenkenfelden Freistadt Mattig, Enknach Wernstein am Inn Altenfelden St.Oswald bei Freistadt Weitersfelden Engelhartszell St.Johann am Wimberg Neufelden Hirschbach im Mühlkreis Lembach im Mühlkreis Reichenau im Mühlkreis Gewässer St.Roman Lasberg Brunnenthal St.Ulrich im Mühlkreis Oberneukirchen Enknach Münzkirchen Hofkirchen im Mühlkreis Ottenschlag im Mühlkreis Kaltenberg Niederkappel St.Veit im Mühlkreis Zwettl an der Rodl Fließgewässer St.Aegidi Kleinzell im Mühlkreis Sonnberg im Mühlkreis Schärding Rainbach im Innkreis Unterweißenbach Niederwaldkirchen St.Leonhard -

Steyr Steyr-Land
Steyr Steyr-Land 08.01.2020 / KW 02 / www.tips.at Turnerball Der ÖTB Turnverein Bad Hall lädt Balltiger am 18. Jän- ner zum Tanz übers Parkett in der Jahn-Turnhalle ein. Auch tolle Show- Neujahrsbaby Oberösterreichs Neujahrsbaby heißt Lina und kam am 1. Jänner um 0.18 Uhr im Krankenhaus Einlagen warten. Seite 28 / Foto: privat Steyr zur Welt. Für Mama Ines und Papa Thomas aus Neuzeug ist es das erste Kind. Seite 8 / Foto: Land OÖ/Max Mayrhofer 51.365 Stk. | OÖ 690.344 Stk. | Gesamt 865.213 Stk. | Redaktion +43 (0)72 45 52 / 711 Reichraming sucht neuen Ortschef Seite 3 Kleintierzucht Kinderbetreuung Olympiatraum Der Kleintierzuchtverein aus Steyr wird von der Arbeiterkam- Sportler aus der Region Steyr Österreichische Post AG | RM 02A034591K | 4010 Linz | AuflageSteyr Weyer ist äußerst erfolgreich und mer mit der Höchstnote bewertet, kämpfen um die Quali kation für darf sich über Welt- und Europa- schlechter schaut es im Bezirk die Olympischen Spiele 2020 in meistertitel freuen. >> Seite 6 Steyr-Land aus. >> Seite 12 Tokio (Japan). >> Seite 24 Landesrat Spitzenschule Sicherheit Der Grüne Stefan Kaineder aus Das Spitzenschule-Voting ist in Die Volksschüler aus Bad Hall Bestseller-Autoren Ge- Dietach dürfte nach dem Abgang der heißen Phase angelangt: Nur lernen spielerisch, wie wichtig das meinsam mit Konrad Paul Liessmann von Rudi Anschober nach Wien noch bis 9. Jänner kann abge- Tragen von Warnwesten auf dem kommt Michael Köhlmeier am 10. Landesrat werden. >> Seite 11 stimmt werden. >> Seite 15 Schulweg ist. >> Seite 26 Jänner nach Steyr. Seite 27 / Foto: Hassiepen 2 Land & Leute Steyr 2. Woche 2020 HeRBeRt OSteRMann „Jeden zweiten Tag war Fliegeralarm“ SIeRnInG. -

Wahlkreise A3 Mit Gemnam.Pdf
WahlkreiseWahlkreise inin OberösterreichOberösterreich Schwarzenberg Klaffer Ulrichsberg Julbach Aigen-Schlägl Nebelberg St. Oswald Peilstein Leopoldschlag Kollerschlag Lichtenau Oepping Windhaag St. Haslach Stefan-Afiesl Oberkappel Sarleinsbach H! Rainbach Freinberg Sandl Rohrbach-Berg Vorderweißenbach Reichenthal Atzesberg Grünbach Pfarrkirchen Helfenberg Schardenberg Esternberg Auberg Schenkenfelden Arnreit Liebenau Vichtenstein Neustift Putzleinsdorf Hörbich St. Peter Waldburg Weitersfelden B.Leonfelden H! St. Oswald Wernstein Altenfelden Neufelden St. St. Roman Engelhartszell Lembach Johann Hirschbach Freistadt Oberneukirchen Reichenau St. Ulrich Brunnenthal Münzkirchen Lasberg Kaltenberg Hofkirchen Niederkappel St. Ottenschlag Kleinzell Schärding St. Aegidi Veit Zwettl Sonnberg Rainbach Niederwaldk. Haibach St. Leonhard ± H! Unterweißenbach St. Kopfing Haibach Kefermarkt Waldkirchen Kirchberg Hellmonsödt Florian Neumarkt Gutau Diersbach Neukirchen Herzogsdorf Kirchschlag Taufkirchen St. Martin Schönau Königswiesen Suben Natternbach Sigharting Aschach Eidenberg Alberndorf Hagenberg Eschenau St. Agatha St. Gotthard St. Marienk. Gramastetten St. Enzenkirchen Hartkirchen Altenberg Unterweitersdorf Georgen/W. Eggerding Lichtenberg BadZell St. Willibald Pierbach Andorf Feldkirchen Gallneukirchen Pregarten Raab Heiligenberg Walding Antiesenhofen Mayrhof Stroheim Steegen Ottensheim Tragwein Reichersberg Engerwitzdorf Wartberg Pabneukirchen Waizenkirchen Pupping Rechberg Altschwendt Goldwörth Obernberg Zell Puchenau Katsdorf Ort Peuerbach -

Vorschau KM & 1B Datum Uhrzeit Spiel Ort Sa. 26.09. 16:00 / 13:45 Maria Neustift
Vorschau KM & 1b Datum Uhrzeit Spiel Ort Sa. 26.09. 16:00 / 13:45 Maria Neustift - Ternberg Sportplatz Maria Neustift So. 04.10. 16:00 / 14:00 Reichraming – Maria Neustift Sportplatz Reichraming Das Kaufhaus Merkinger sponsort bei unserem Heimspiel gegen Ternberg einen neuen Matchball. Herzlichen Dank für die Unterstützung! 5. u. 6. Runde sowie Nachtragsspiel 3. Runde Datum Team Spiel Ergebnis Torschützen So. 13.09. 1b Maria Neustift – Wartberg 3:0 (2:0) Robert Sulzner, Hermann Putz, Eigentor So. 13.09. KM Maria Neustift – Wartberg 0:1 (0:0) 2x Lukas Schweighuber, Robert Sulzner, Mi. 16.09. 1b Ried i. Trkr. – Mara Neustift 5:4 (1:3) Gabriel Schörkhuber 3x Lukas Farveleder, 3x Kilian Haas, 2x So. 20.09. 1b Kirchdorf/Kr. – Maria Neustift 2:11 (1:4) Lukas Schweighuber, 2x Mathias Ratzberger, Marcus Riener 2x Tobias Stubauer, Jonas Krifter, Simon So. 20.09. KM Kirchdorf/Kr. – Maria Neustift 2:5 (2:3) Keller, Simon Aspalter 2. Klasse Ost Rang Mannschaft Sp. S U N +/- Pkt. 2. Klasse Ost 1b 1 Adlwang 6 5 1 0 20 16 Rang Mannschaft Sp. S U N +/- Pkt. 2 Waldneukirchen 6 5 0 1 10 15 1 Losenstein 5 4 1 0 32 13 3 Losenstein 6 4 1 1 5 13 2 Ried i.Trkr. 4 4 0 0 15 12 4 Ried i.Trkr. 6 3 3 0 4 12 3 Waldneukirchen 6 4 0 2 14 12 5 SV Micheldorf 1b 6 3 2 1 6 11 4 Adlwang 6 3 1 2 5 10 6 Sipbachzell 6 3 1 2 2 10 5 Sipbachzell 5 3 0 2 5 9 7 Großraming 6 3 0 3 1 9 6 SPG SV Weyer 5 2 3 0 4 9 8 Ternberg 6 1 4 1 1 7 7 Maria Neustift 5 2 0 3 5 6 9 Reichraming 6 2 1 3 -5 7 8 Großraming 5 1 1 3 -4 4 10 Maria Neustift 6 2 0 4 -3 6 9 Wartberg/Kr. -

Bleib Daheim
Steyr Steyr-Land Bleib daheim in Steyr / Steyr-Land 08.04.2020 / KW 15 / www.tips.at Helden des Alltags Die Rettungssanitäter Lukas Buchberger und Nikolas Etlinger von der Rotkreuz-Ortsstelle Ternberg unterstützten den kleinen Lorenz dabei, dass Licht der Welt zu erblicken. Seite 4 / Foto: OÖRK/Grillmayr 51.365 Stk. | OÖ 690.344 Stk. | Gesamt 865.213 Stk. | Redaktion +43 (0)72 45 52 / 711 Steyrer Stadtfest 2020 abgesagt Seite 30 Finanzielle Nöte Viele Arbeitslose Städte und Gemeinden kämpfen 5.159 Menschen sind in Steyr und WIR HABEN FÜR IHRE Österreichische Post AG | RM 02A034591K | 4010 Linz | AuflageSteyr mit nanziellen Problemen. Steyrs Steyr-Land ohne Job. Der Anstieg GRUNDVERSORGUNG GEÖFFNET! Bürgermeister fordert die Ausset- der Arbeitslosen ist geringer als in zung der Landesumlage. >> Seite 3 anderen Regionen. >> Seite 12 Studium in den USA Training zu Hause Sebastian Dietachmair aus Die Athleten des Schwimmclub Schiedlberg schildert seine Ein- Steyr müssen auf Training im beratung. service. reparatur. drücke vom Auslandssemester in Wasser verzichten und halten sich Potsdam nahe New York. >> Seite 6 zu Hause t. >> Seite 27 Danke den Mitarbeiterinnen & Mitarbeitern der geöffneten Geschäfte! 2 Land & Leute Steyr 15. Woche 2020 KOMMentaR COROnaKRISe von 15 Milliarden-Hilfsfonds für Josef Gruber [email protected] wirtschaftlichen Neustart Ungerechte Politik SteYR. Der von vielen Betrieben In der aktuellen Krisensituation dringend erwartete 15 Milliar- tut die Regierung viel. Nicht alles den-Corona-Hilfsfonds startet. ist gut überlegt und gerecht. Neben Krediten mit staatlichen So wurde vergangenen Freitag Garantien beinhaltet er nicht ein Hilfspaket für Zeitungen be- rückzuzahlende Zuschüsse. schlossen, bei dem etwa „heute“ Tips hat mit Unternehmern aus 1,82 Millionen Euro erhält, Wolf- Steyr darüber gesprochen. -

Ortsplatz Reichraming Veranstalter:Naturfreunde Ortsgruppe Reichraming
6.Reichraminger Kinder+Ortsrundenlauf mit Staffellauf 3x1800m Samstag,20.August 2016 - Ortsplatz Reichraming Veranstalter:Naturfreunde Ortsgruppe Reichraming OFFIZIELLE RANGLISTE :Klassenwertung RNG STN TEILNEHMER JAHR VEREIN LAUFZEIT Min/km Super Mini weiblich*2011/jüng. Gesamt-Km: 0.240 km/h:14.91 gewertet: 19/21 1 2 GUTMANN Jennifer 2011 Naturfreunde Weyer 57.94 04:01 2 27 RIEDLER Amelie 2011 SV Opponitz 1:04.27 04:28 3 109 FARVELEDER Jana Victori 2011 Union Maria Neustift 1:07.81 04:43 4 103 KERSCHBAUMSTEIN Lucie 2012 Weyer 1:10.21 04:53 5 135 MIKOTA Vera 2011 NF Reichraming 1:11.56 04:58 6 139 ASPALTER Alina 2011 1:14.07 05:09 7 128 HARTLAUER Martha 2011 Laufwunder Steyr 1:16.63 05:19 8 113 BRANDECKER Amelie 2011 Reichraming 1:17.92 05:25 9 127 WIESINGER Anna 2011 Reichraming 1:20.02 05:33 10 133 RIEDLECKER Valentina 2011 Steyr 1:29.36 06:12 11 132 HANSLIK Emma 2012 Reichraming 1:30.46 06:17 12 90 SIGL Mia 2012 SIG-Harreither 1:37.25 06:45 13 118 PLöCHL Amelie 2011 Laussa 1:38.77 06:52 14 6 MITTERHAUSER Miriam 2012 Kleinreifling 1:40.07 06:57 15 137 DREIER Heidi 2013 SIG Harreither 1:48.01 07:30 16 119 PLöCHL Natalie 2013 Laussa 1:52.96 07:51 17 95 KRONSCHACHNER Lea 2012 Steinbach/Steyr 1:54.97 07:59 18 134 RIEDLECKER Sophia 2013 Steyr 2:14.38 09:20 19 12 OBERMAIER Anna 2013 SV Losenstein 2:49.32 11:46 Super Mini männlich*2011/jüng. -

Steyr Steyr-Land
Steyr Steyr-Land 12.06.2019 / KW 24 / www.tips.at Cup-Finale Der Wickie Spar- kassen Kinderlauf-Cup im Ennstal geht am Samstag, 15. Juni, mit dem 20. Gafl enzer Laufsporttag zu Ende. Premiere Der beliebte Schauspieler Gerald Pichowetz ist heuer für die Operette „Die Fledermaus“ in Bad Hall Seite 32 / Foto: WSG Gafl enz/Stephan Schönberger sowohl inszenierend als auch darstellerisch im Einsatz. Premiere wird am 14. Juni gefeiert. Seite 39 / Foto: klangvoll 51.780 Stk. | OÖ 690.344 Stk. | Gesamt 865.213 Stk. | RedaktionJob-Motor +43 (0)72 52 / 711 45 in der Region brummt Seite 3 Seifenkisten-Rennen Abschiedsfeier OÖ-Radrundfahrt Waghalsige Piloten stürzen sich Peter Guttmann aus Großraming 144 Radpro s rittern bei der zehn- Österreichische Post AG | RM 02A034591K | 4010 Linz age |Steyr Aufl am Samstag, 15. Juni, mit ihren legt sein Amt als Bezirksstellen- ten internationalen OÖ-Rundfahrt Gefährten die Steyrer Pfarrgasse obmann der Wirtschaftskammer um den Sieg. Die Schlussetappe hinunter. >> Seite 6 Steyr-Land zurück. >> Seite 11 führt nach Ternberg. >> Seite 33 Laufend neue Fisch-Aufstiegshilfe Volkshilfe Steyrdorf Top Highlights... Einen ökologischen Beitrag soll Um Menschen mit Beeinträchti- Begeisterte Stadtteil-Bewohner Parken: der derzeit in Bau be ndliche gung mehr Selbstbestimmung zu organisieren am 14. Juni ein Parkgarage Fischaufstieg beim Ennskraftwerk ermöglichen, startet die Volkshilfe weltmusikalisches Konzert beim Dukartstrasse 1a Garsten-St. Ulrich leisten. >> Seite 8 neue Wohnprojekte. >> Seite 17 Roten Brunnen. >> Seite 35 www.schanda.com/steyr 2 Land & Leute Steyr 24. Woche 2019 BaLtIC Sea CIRCLe Mit altem Jeep ins Abenteuer Ehe SteYR. Die frisch Vermählten Katharina und David Kempt- ner-Rauscher pfeifen auf Flitter- wochen am türkisblau gesäum- Berzacola Chiara ten Sandstrand.