Diplomarbeit
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
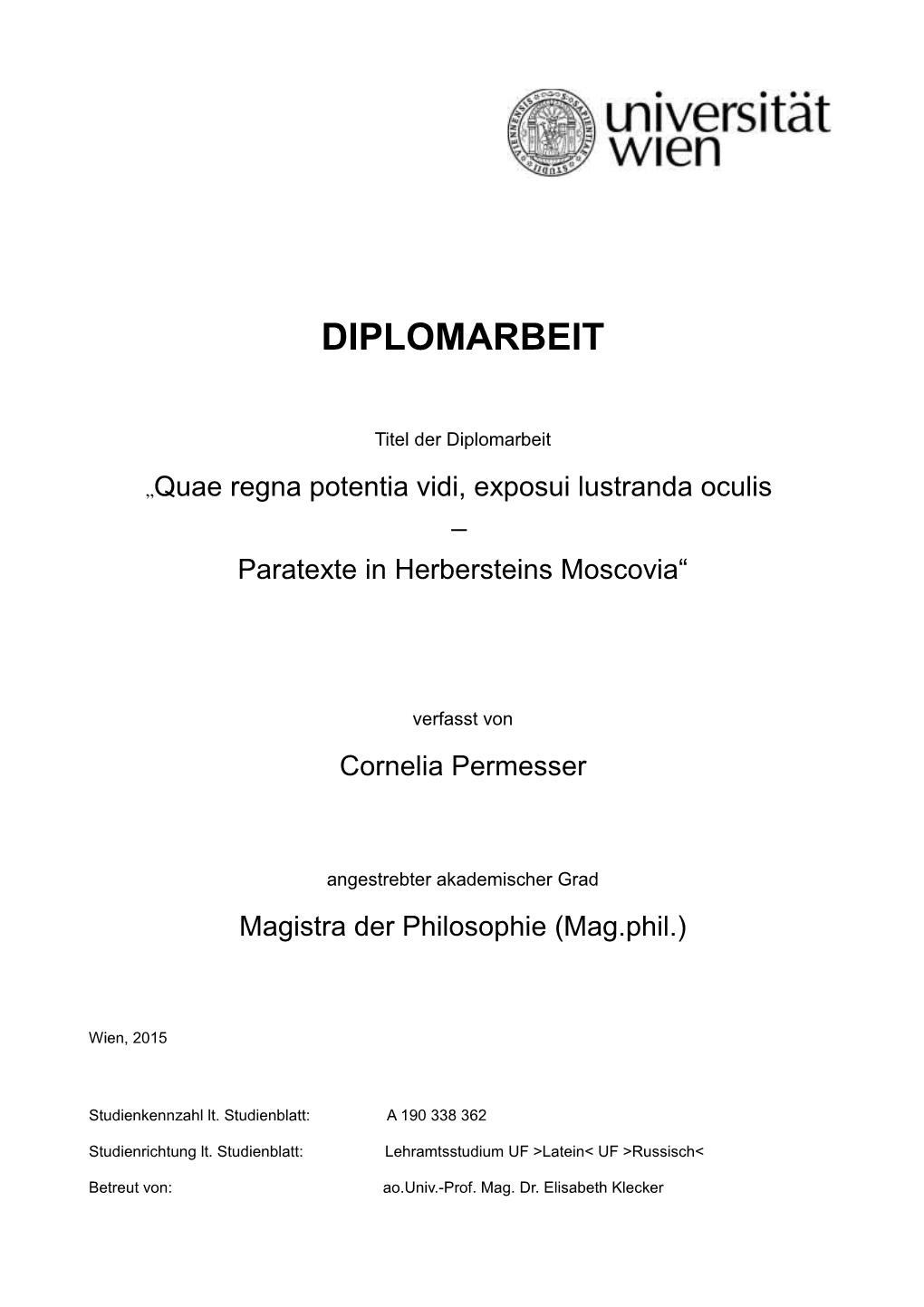
Load more
Recommended publications
-

PDF Van Tekst
De correspondentie van Desiderius Erasmus. Deel 16. Brieven 2204-2356 Desiderius Erasmus Vertaald door: Tineke ter Meer bron Desiderius Erasmus, De correspondentie van Desiderius Erasmus. Deel 16. Brieven 2204-2356 (vert. Tineke L. ter Meer). Ad. Donker, Rotterdam 2018 Zie voor verantwoording: https://www.dbnl.org/tekst/eras001corr17_01/colofon.php Let op: werken die korter dan 140 jaar geleden verschenen zijn, kunnen auteursrechtelijk beschermd zijn. 9 Inleiding Erasmus van augustus 1529 t/m juli 1530 Uit de periode 9 augustus 1529 tot en met 31 juli 1530 zijn 156 brieven van en aan Erasmus bekend. De vorm waarin ze zijn overgeleverd varieert van een geautoriseerde gedrukte versie tot een rommelig kladje vol doorhalingen. Tot die laatste categorie horen elf brieven van de jurist Bonifacius Amerbach, hoogleraar aan de universiteit van Bazel. Van Erasmus ontving hij in deze periode eenzelfde aantal eigenhandig geschreven brieven en nog twee waarvan alleen kopieën bekend zijn. Al deze brieven dragen het karakter van privé-correspondentie. Dat laatste geldt bij uitstek voor hun brieven over Erasmius Froben, de jongste zoon van de overleden drukker Johann Froben en petekind van Erasmus. De ongeveer vijftienjarige jongen had enige tijd bij zijn peetvader in Freiburg doorgebracht en was vervolgens door zijn beduidend oudere halfbroer Hieronymus weer meegenomen naar Bazel. Blijkbaar liepen de meningen uiteen hoe de verdere opleiding van Erasmius eruit moest zien. Erasmus ziet hem het liefst in Leuven studeren, maar de familie heeft daar andere gedachten over. Helemaal zeker van zijn zaak is ook Erasmus zelf niet. Terug in Bazel laat de jongen niets van zich horen en blijkens brief 2229 had hij een briefje dat de grote geleerde aan hem had geschreven in Freiburg laten liggen. -

History, Medicine, and the Traditions of Renaissance Learning
History, Medicine, and the Traditions of Renaissance Learning History, Medicine, and the Traditions of Renaissance Learning • • nancy g. siraisi the university of michigan press • ann arbor Copyright © by the University of Michigan 2007 All rights reserved Published in the United States of America by The University of Michigan Press Manufactured in the United States of America c Printed on acid-free paper 2010 2009 2008 2007 4 3 2 1 No part of this publication may be reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted in any form or by any means, electronic, mechanical, or otherwise, without the written permission of the publisher. A CIP catalog record for this book is available from the British Library. Library of Congress Cataloging-in-Publication Data Siraisi, Nancy G. History, medicine, and the traditions of Renaissance learning / Nancy G. Siraisi. p. cm. — (Cultures of knowledge in the early modern world) Includes bibliographical references and index. ISBN-13: 978-0-472-11602-7 (cloth : alk. paper) ISBN-10: 0-472-11602-9 (cloth : alk. paper) 1. Medicine—History—16th century. 2. Renaissance. I. Title. R146.S57 2008 610.9—dc22 2007010656 ISBN13 978-0-472-02548-0 (electronic) For nobuyuki siraisi PREFACE AND ACKNOWLEDGMENTS his book is a study of connections, parallels, and mutual interaction T between two in›uential disciplines, medicine and history, in ‹fteenth- to seventeenth-century Europe. The elevation of history in status and signi‹- cance, the expansion of the scope and methods of history, and the related (but distinct) growth of antiquarianism are among the most striking—and recently among the best studied—features of the humanist culture of that period. -

Renaissance and Reformation, 1993
^ Unica Oblatio Christi: Eucharistie Sacrifice and the first Zurich Disputation KEITH D. LEWIS S ummary: The First Zurich Disputation (January 29th, 1523) between Ulrich Zwingli and Johann Faber was the earliest Reformation-era public debate of the doctrine of the eucharistie sacrifice. While Zwingli was at an early and relatively fluid stage in his rejection of eucharistie sacrifice, Faber's defense employed not only traditional scholastic sources but other authoritative supports previously unused in the defense of doctrine. Never- theless, the polemical atmosphere of the exchange between the two both during and after the disputation precluded true clarity andpotential common ground on this issue. For ten long years, our opponents have written many books asserting that the mass is a sacrifice, and yet not one of them has defined what sacrifice is or is not [Philip Melanchthon, Apologia Confessionis XXIV, XII, 15 (1531)]. The fact that Swiss reformer Ulrich Zwingli rejected any notion of eucharistie sacrifice and insisted on a strictly anamnetic eucharist early-on in his emer- gence as a reformer, is well-known. Yet for all that has been written concerning Zwingli' s eucharistie theology,^ surprisingly little attention has been paid to the actual circumstances of his initial rejection of the doctrine of eucharistie sacrifice in the theological context of the First Zurich Disputation of January 29th, 1523, during which the vicar-general of the diocese of Constance Johann Faber ( 1478-1541) emerged as an impromptu and reluctant debating opponent to ZwingH, with whom Faber had been on friendly terms. This is especially surprising, when one considers that the Zurich meeting appears to have been the first public debate in the sixteenth century between a controversial theologian and a major reformation personality concerning the doctrine of eucharistie sacrifice. -

CO:L\ CORDIA THEOLOGICAL MONTHLY
CO:l\ CORDIA THEOLOGICAL MONTHLY The Presence of Christ's Body and Blood in the Sacrament of rhe Altar According to Luther NORMAN NAGEL The Theology of Communism MARTIN H. SCHARLEMANN Thomas More and the Wittenberg Lutherans CARL S. MEYER Pietism: Classical and Modem - A Comparison of Two Representative Descriptions EGON W. GERDES Homiletics Brief Studies Book Review VolXXXIX April 1968 No.4 Thomas More and t~1e Wittenberg Lutherans CARL S. MEYER man for all seasons" was also a po few scholars about the 16th century4 have A lemicist, although this is not gen told in some detail the story about the re erally noted. Some of Thomas More's lations between More and Luther. Only biographers,l writers about the relation Sister Gertrude Donnelly investigated these ships between Henry VIII and Martin Lu relations comprehensively.5 One can learn ther,2 one biographer of Luther,S and a something about some aspects of these re lations from secondary sources, although 1 Algernon Cecil, A Portrait of Thomas the accounts may be distorted. Sometimes More: Scholar, Statesman, Saint (London: Eyre and Spottiswoode, 1937), pp.193-207. How reference is made to the polemic More ever, R. W. Chambers, Thomas More (London: wrote against Bugenhagen.6 No writer Jonathan Cape, 1935), p. 193, has only a brief seems to have noticed, or at least has not reference to this topic. W. E. Campbell, Eras mus, Tyndale and More (London: Eyre and thought it worthwhile mentioning, that Spottiswoode, 1949), pp.148-52, 220-22, More never wrote against the Wittenberg does not mention More's work, under the pseu- donym of Wr::___ ::-... -

April 2007 Newsletter
historians of netherlandish art NEWSLETTER AND REVIEW OF BOOKS Dedicated to the Study of Netherlandish, German and Franco-Flemish Art and Architecture, 1350-1750 Vol. 24, No. 1 www.hnanews.org April 2007 Have a Drink at the Airport! Jan Pieter van Baurscheit (1669–1728), Fellow Drinkers, c. 1700. Rijksmuseum, Amsterdam. Exhibited Schiphol Airport, March 1–June 5, 2007 HNA Newsletter, Vol. 23, No. 2, November 2006 1 historians of netherlandish art 23 S. Adelaide Avenue, Highland Park NJ 08904 Telephone/Fax: (732) 937-8394 E-Mail: [email protected] www.hnanews.org Historians of Netherlandish Art Officers President - Wayne Franits Professor of Fine Arts Syracuse University Syracuse NY 13244-1200 Vice President - Stephanie Dickey Bader Chair in Northern Baroque Art Queen’s University Kingston ON K7L 3N6 Canada Treasurer - Leopoldine Prosperetti Johns Hopkins University North Charles Street Baltimore MD 21218 European Treasurer and Liaison - Fiona Healy Marc-Chagall-Str. 68 D-55127 Mainz Germany Board Members Contents Ann Jensen Adams Krista De Jonge HNA News .............................................................................. 1 Christine Göttler Personalia ................................................................................ 2 Julie Hochstrasser Exhibitions ............................................................................... 2 Alison Kettering Ron Spronk Museum News ......................................................................... 5 Marjorie E. Wieseman Scholarly Activities Conferences: To Attend .......................................................... -

Metaliteracy & Theatricality in French & Italian Pastoral
THE SHEPHERD‘S SONG: METALITERACY & THEATRICALITY IN FRENCH & ITALIAN PASTORAL by MELINDA A. CRO (Under the Direction of Francis Assaf) ABSTRACT From its inception, pastoral literature has maintained a theatrical quality and an artificiality that not only resonate the escapist nature of the mode but underscore the metaliterary awareness of the author. A popular mode of writing in antiquity and the middle ages, pastoral reached its apex in the sixteenth and seventeenth centuries with works like Sannazaro‘s Arcadia, Tasso‘s Aminta, and Honoré d‘Urfé‘s Astrée. This study seeks to examine and elucidate the performative qualities of the pastoral imagination in Italian and French literature during its most popular period of expression, from the thirteenth to the seventeenth century. Selecting representative works including the pastourelles of Jehan Erart and Guiraut Riquier, the two vernacular pastoral works of Boccaccio, Sannazaro‘s Arcadia, Tasso‘s Aminta, and D‘Urfé‘s Astrée, I offer a comparative analysis of pastoral vernacular literature in France and Italy from the medieval period through the seventeenth century. Additionally, I examine the relationship between the theatricality of the works and their setting. Arcadia serves as a space of freedom of expression for the author. I posit that the pastoral realm of Arcadia is directly inspired not by the Greek mountainous region but by the Italian peninsula, thus facilitating the transposition of Arcadia into the author‘s own geographical area. A secondary concern is the motif of death and loss in the pastoral as a repeated commonplace within the mode. Each of these factors contributes to an understanding of the implicit contract that the author endeavors to forge with the reader, exhorting the latter to be active in the reading process. -

Jacopo Sannazaro's Piscatory Eclogues and the Question of Genre
NEW VOICES IN CLASSICAL RECEPTION STUDIES Issue 9 (2014) Jacopo Sannazaro’s Piscatory Eclogues and the Question of Genrei © Erik Fredericksen INTRODUCTION In 1526, Jacopo Sannazaro (1458-1530), the Italian humanist and poet from Naples, published a collection of five Neo-Latin eclogues entitled Eclogae Piscatoriae. He had already authored a hugely influential text in the history of the Western pastoral tradition (the vernacular Arcadia) but, while the Piscatory Eclogues had their admirers and imitators, these poems provoked a debate for many later readers over their authenticity as pastoral poems, due to one essential innovation: Sannazaro exchanged the bucolic countryside and shepherds of classical pastoral for the seashore and its fishermen.ii Through this simple substitution, Sannazaro’s poems question the boundaries of the pastoral genre and— considered along with their critical reception—offer a valuable case study in how a work attains (or does not attain) generic status. In what follows, I argue, against recent criticism, that Sannazaro’s Piscatory Eclogues should be regarded as a pastoral work and suggest that this leads to a better understanding both of the poems themselves and of the dynamics of generic tradition. After examining various features of Sannazaro’s poems, I turn to his models for literature of the sea, both within and outside of pastoral poetry. This is more than a debate over how to label or categorize Sannazaro’s poems; rather, I am arguing that these poems are best understood in relation to the classical tradition of pastoral poetry.iii Thus, after arguing for the collection’s identity as pastoral poems, I will examine the structural relationship of Sannazaro’s eclogue collection to earlier eclogue books (especially Vergil’s), emphasizing how recognition of the poems’ genre helps us appreciate Sannazaro’s sophisticated intertextuality with Vergil and other pastoral predecessors. -

Die Unterrichtseinheit Zum Film Sus Sek Ii
DIE UNTERRICHTSEINHEIT ZUM FILM SUS SEK II Inhaltsverzeichnis 2 Die Unterrichtseinheit Impressum zum Film „Zwingli“ SUS / SEK II INHALTSVERZEICHNIS / IMPRESSUM SET 1 SET 5 Figurengruppe Anna Reinhart und Figurengruppe Christoph Froschauer Katharina von Zimmern 3 und Söldner 43 – – AB 1 Auftrag: Figuren-Zeit-Panorama 4 AB 1 Auftrag: Figuren-Zeit-Panorama 44 AB 2 Figurenkonstellation und Sequenzen 5 AB 2 Figurenkonstellation und Sequenzen 45 AB 3 Steckbrief 7 AB 3 Steckbrief 47 AB 4 Materialset 1: Anna Reinhart und AB 4 Materialset 5: Christoph Froschauer Katharina von Zimmern 8 und Söldner 48 AB 5 Zwingli: Biografie und Ereignisse 10 AB 5 Zwingli: Biografie und Ereignisse 50 AB 6 Zeitstrahl 12 AB 6 Zeitstrahl 52 SET 2 SET 6 Figurengruppe Gerold und Bettlerjunge 13 Zwingli und der Krieg 53 – – AB 1 Auftrag: Figuren-Zeit-Panorama 14 AB 1 Auftrag: Figuren-Zeit-Panorama 54 AB 2 Figurenkonstellation und Sequenzen 15 AB 2 Figurenkonstellation und Sequenzen 55 AB 3 Steckbrief 17 AB 3 Steckbrief 57 AB 4 Materialset 2: Gerold und Bettlerjunge 18 AB 4 Materialset 6: Zwingli und der Krieg 58 AB 5 Zwingli: Biografie und Ereignisse 20 AB 5 Zwingli: Biografie und Ereignisse 60 AB 6 Zeitstrahl 22 AB 6 Zeitstrahl 62 SET 3 Figurengruppe Leo Jud und Felix Manz 23 – AB 1 Auftrag: Figuren-Zeit-Panorama 24 AB 2 Figurenkonstellation und Sequenzen 25 AB 3 Steckbrief 27 AB 4 Materialset 3: Leo Jud und Felix Manz 28 AB 5 Zwingli: Biografie und Ereignisse 30 AB 6 Zeitstrahl 32 IMPRESSUM – AutorInnen: SET 4 Prof. Dr. Karin Fuchs (Dozentin) mit Fabian Blaser und Figurengruppe -

Ulrich Zwingli (1484–1531)
Ulrich Zwingli (1484–1531) Conditions in Switzerland • Holy Roman Empire divided into provinces where the loyalty was primarily toward local governments • Swiss Republic consisted of 13 provinces or cantons • Humanism was becoming more and more popular (thanks to the influence of Erasmus) • Religious corruption evident (Huss had been burned to death at Constance in 1415; papacy was in obvious disrepair; local church leaders were morally corrupt) • Switzerland was ripe for a reformation Switzerland (1515) Born January 1, 1484 (Wildhaus) Wildhaus Early Life • Born in Wildhaus, seven weeks after Martin Luther • His fhfather was a ciiivic ldleader (ba iliff) in the town • His parents wanted him to pursue the priesthood • Attended school at Basel and Bern • Entered UUestyniversity of Vieeanna in 1500 • Finished at University of Basel in 1504 • Hig hly iflinfluence d by Thomas WttWyttenb ac h, and thus exposed to Erasmus and Religious Humanism in Basel • RidReceived his Mt’Master’s degree in 1506 Bern (old city) University of Vienna Old University of Basel Zwingli was highly influenced by the teachings of Erasmus; who himself had spent some time at the University of Basel (1514–16; 1521–29) As a result, Zwingli had a strong interest in Scripture and biblical thlheology; he was eager to see reform take place in the Catholic Church Erasmus Earlyyy Ministry • Became priest in Galarus (1506); a position he purchased for 100 guilders (a few hundred dollars) • Also served as a chaplain for Swiss troops • Wrote against abuses in the French and Swiss -

Rechenschieber Von Faber-Castell
Rechenschieber Slide Rules A.W. Faber A.W. Faber-Castell Modelle, Typen, Skalen Models, Types, Scales V 8.0 Peter Holland Peter Holland unter Mitarbeit von, in co-operation with Dieter von Jezierski Günter Kugel David Rance Rechenschieber - Slide Rules A.W. Faber - A.W. Faber-Castell Modelle, Typen, Skalen Models, Types, Scales © 2020, Digitale Ausgabe, V 8.0 © 2020, Digital Edition, V 8.0 Kontakt zum Autor, to contact the author: [email protected] Titelfoto: Faber-Castell, Modell 367 Cover picture: Faber-Castell model 367 Jegliche Haftung für die Richtigkeit des gesamten Werkes kann trotz sorgfältiger Prüfung nicht übernommen werden. Die im Buch genannten Produkte, Warenzeichen und Firmennamen sind in der Regel durch deren Inhaber geschützt. Despite all possible care and attention, no liability for the correctness of the contents is accepted. The products named in the book, the trademarks and company names are, as a rule, protected by the owner. Dieses Werk ist lizenziert unter einer Creative Commons Namensnennung - Nicht kommerziell - Keine Bearbeitungen 4.0 International Lizenz. This work is licensed under a Creative Commons Attribution – NonCommercial - NoDerivatives 4.0 International License. Inhaltsverzeichnis 1 1 Vorwort und Dank S. 5 2 Erläuterungen zum Gebrauch S. 8 3 Rechenschieber-Modelle S. 13 3.1 Frühe Modelle ohne Nummerierung S. 19 3.2 Serie 3xx S. 20 3.3 Serie D S. 28 3.4 Serie 1/xx/3xx S. 28 3.5 Serie 'hel', 'kad', 'cme' S. 30 3.6 Serie 1/xx S. 30 3.7 Serie 2/xx, 2/xxN S. 33 3.8 Serie 3/xx/3xx S. -

PROTESTÁNS INTÉZMÉNYI KÖNYVTÁRAK MAGYARORSZÁGON 1530-1750 Jegyzékszerű Források
PROTESTÁNS INTÉZMÉNYI KÖNYVTÁRAK MAGYARORSZÁGON 1530-1750 Jegyzékszerű források ORSZÁGOS SZÉCHÉNYI KÖNYVTÁR BUDAPEST 2009 0 PROTESTÁNS INTÉZMÉNYI KÖNYVTÁRAK MAGYARORSZÁGON Libraries of the Protestant Institutions in Hungary ADATTÁR X'VI—XVIII. SZÁZADI SZELLEMI MOZGALMAINK TÖRTÉNE 1 ÉHEZ Documentation of Intellectual Movements History in Hungary from the 16th to the 18th Century 19/2 Sorozatszerkesztő / Ed. by BALÁZS MIHÁLY KESERŰ BÁLINT PROTESTÁNS INTÉZMÉNYI KÖNYVTÁRAK MAGYARORSZÁGON 1530-1750 Jegyzékszerű források Sajtó alá rendezte OLÁH RÓBERT ORSZÁGOS SZÉCHÉNYI KÖNYVTÁR BUDAPEST 2009 Készült a Szegedi Tudományegyetem Régi Magyar Irodalom Tanszéke, a Szegedi Tudományegyetem Könyvtártudományi Tanszéke, és az Országos Széchényi Könyvtár együttműködése keretében In memoriam Oláh Imréné (1961-2008) Lektorálta és szerkesztette MONOK ISTVÁN SZÉKELY JÚLIA Egyes jegyzékek közlésénél munkatárs PAVERCSIK ILONA Technikai szerkesztő DETRE ILDIKÓ ISBN 978-963-200-565-2 HU ISSN 0230-8495 Terjesztés Országos Széchényi Könyvtár H-1827 Budapest, Budavári Palota F épület Király Tímea, [email protected] , tel. +36 — 1 - 22 43 878 TARTALOMJEGYZÉK ELŐSZÓ VII VORWORT X RÖVIDÍTÉSEK XIV KÖNYVJEGYZÉKEK 1 Evangélikus könyvtárak 3 Beszterce 3 Besztercebánya 3 Brassó 4 Eperjes 10 Kassza 11 Késmárk 11 Kisszeben 12 Medgyes 14 Missen 15 Nagyszeben 15 Selmecbánya 16 Sopron 17 Trencsén 19 Református könyvtárak 20 Borberek 20 Debrecen 20 Érsekújvár 225 Gyöngyös 225 Kecskemét 232 Kolozsvár 233 Marosvásárhely 237 Nagybánya 240 Nagyenyed 243 Nagykőrös 245 Nagyszombat 248 Sárospatak 252 Szászváros 330 Szatmár 330 Székelyudvarhely 332 Tarcal 337 Torda 337 V Zabola 337 Zilah 338 Unitárius könyvtárak 338 Kolozsvár 338 Torda 343 Függelék (városi könyvtárak, városi tanácsi könyvtárak, városi intézmények könyvei) 344 Besztercebánya 344 Eperjes 345 Kassa 347 Kőszeg 347 Nagyszeben 348 Trencsén 348 SZEMÉLY- ÉS HELYNÉVMUTATÓ 354 VI ELŐSZÓ Az Adattár a XVI—XVIII. -

Doubt, the Book Under Review Has Presented Fresh Material for Further Research on the Topic
comptes rendus 283 doubt, the book under review has presented fresh material for further research on the topic. sergius kodera University of Vienna https://doi.org/10.33137/rr.v43i3.35321 Brevaglieri, Sabina. Natural desiderio di sapere. Roma barocca fra vecchi e nuovi mondi. La corte dei papi 31. Rome: Viella, 2019. Pp. 476 + 32 ill. ISBN 978-8-8331- 3233-4 (paperback) €49. Sabina Brevaglieri’s book Natural desiderio di sapere. Roma barocca fra vecchi e nuovi mondi is an original and welcome addition to scholarship which brings together work on the history of science and medicine, art patronage, scholarly networks, cultural diplomacy, and urban history. Her impressive evocation of the intellectual fervour in Rome in the first half of the seventeenth century, which saw the creation of the Accademia dei lincei in 1603 by Federico Cesi and the presence in Rome of key European intellectuals, makes the city come alive. Readers are treated to a riveting depiction of the city and the learned players involved in sharing and disputing ideas and circulating new knowledge about the Asian and American worlds. The protagonists are at once the Eternal City itself, at the time a key centre of exchange and mediation, and the botanists, physicians, mathematicians, philosophers, artists, and scientists who lived there. The result is a vivid glimpse into the dynamics that brought them together in the space of a few decades especially propitious for intellectual discovery and exchange. Organized in six chapters, the book is dense and full of detail while at the same time highly readable and accessible to those who are not grounded in the history of science or medicine.