Zolling: Heinrich V. Kleist in Der Schweiz
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
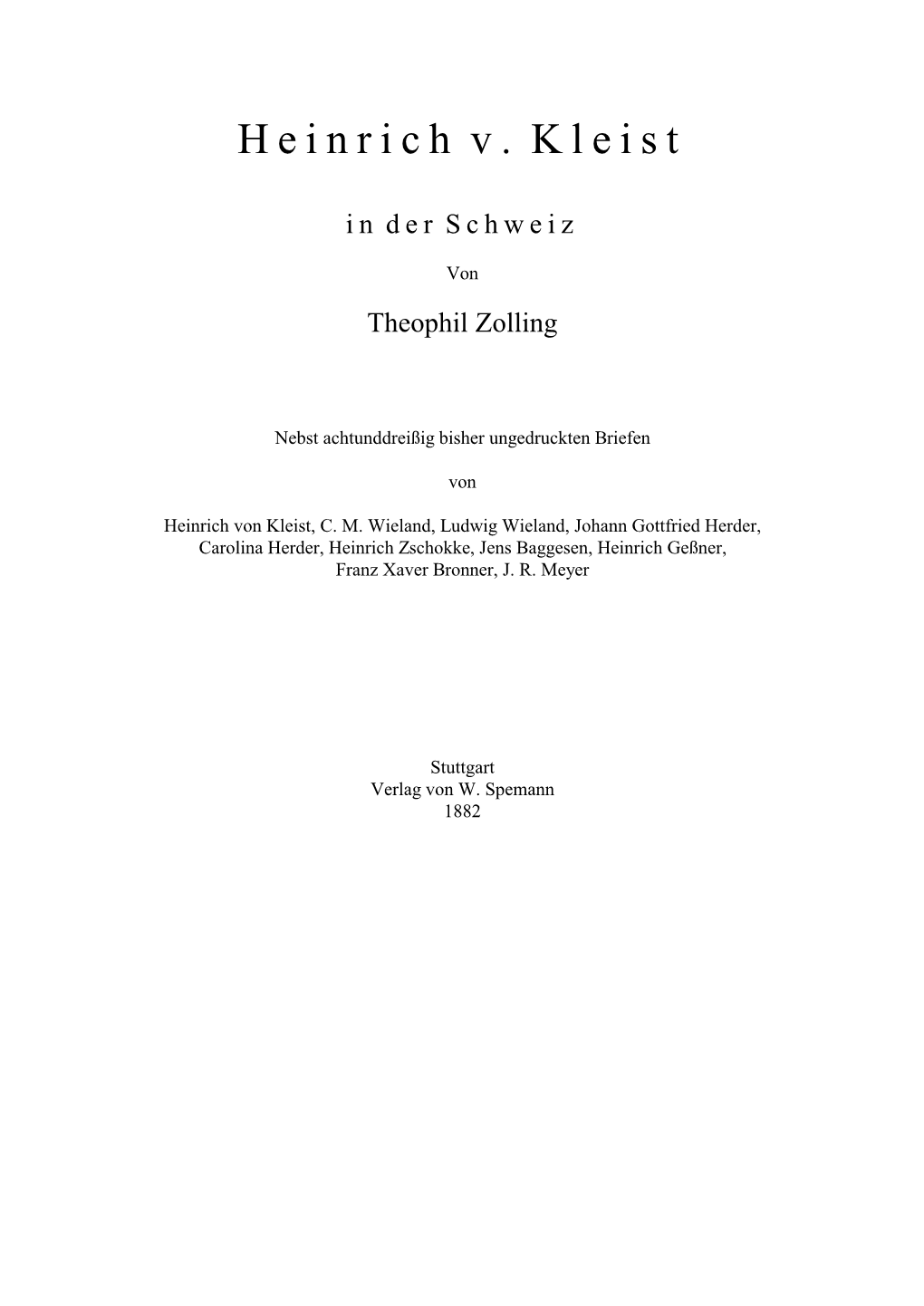
Load more
Recommended publications
-

Heinrich Zschokke Über Die Rätoromanen in Graubünden
Jerzy Slizinski HEINRICH ZSCHOKKE ÜBER DIE RÄTOROMANEN IN GRAUBÜNDEN Der Name Zschokke ist heute nur noch Literaturhistorikern gut bekannt. Johann Heinrich Daniel Zschokke (1771-1848), in Magdeburg geboren, ließ sich mit vierundzwanzig Jahren in Graubünden nieder, wo er in Rei¬ chenau die Leitung einer Erziehungsanstalt übernahm. Dort schrieb er die "Geschichte des Freistaates der drei Bünde im hohen Rätien ", welche zum ersten Mal in Zürich im Jahre 1789 erschien. Kurz darauf finden wir Zschokke in Aarau, wo er einige Zeit als Chef des Departements für Schulwesen tätig war. Während der Helvetik wirkte er im Auftrage des Direktoriums als bevollmächtigter Regierungskommissar in Unterwaiden, und bald wurde die ihm erteilte Vollmacht auch auf die Kantone Uri, Schwyz und Zug ausgedehnt. Im Jahre 1800 ernannte die Berner Zentral¬ regierung Zschokke zum Regierungskommissar, als welcher er mit Erfolg die italienischen Amtsbezirke Lugano und Bellinzona organisierte. Kurze Zeit, nachdem er zum Regierungsstatthalter des Kantons Basel ernannt worden war, legte er sein Amt nieder und lebte auf Schloß Bieberstein im Aargau. 1808 übersiedelte er von dort nach Aarau, wo er Mitbegründer der Gesellschaft für vaterländische Kultur wurde. Auch wurde er in den Großen Rat, in den evangelischen Kirchenrat und in die Kantonsschuldi¬ rektion gewählt, sowie mit vielen Ehrenämtern betraut. Siebzigjährig zog er sich vom öffentlichen Leben zurück und verbrachte seinen Lebens¬ abend in der "Blumenhalde", seinem 1817 am Ufer der Aar erbauten Landhause. Zschokkes literarische Tätigkeit war sehr vielfältig und umfangreich - sei¬ ne in Aarau in den Jahren 1851-1854 herausgegebenen "Gesammelten Schriften" umfassen 35 Bände - und zu seiner Zeit erfolgreich. Sein Hauptziel war, eine erbauliche und belehrende Volkslektüre im Geiste des politischen Rationalismus zu schaffen, wobei jedoch weniger auf den literarischen, künstlerischen Wert geachtet wurde. -

Kleist Und Die Schweiz 2 Anett Lütteken/Carsten Zelle/Wolfgang De Bruyn Vorbemerkung 3
Vorbemerkung 1 Kleist in der Schweiz – Kleist und die Schweiz 2 Anett Lütteken/Carsten Zelle/Wolfgang de Bruyn Vorbemerkung 3 Kleist in der Schweiz – Kleist und die Schweiz Herausgegeben von Anett Lütteken, Carsten Zelle und Wolfgang de Bruyn Wehrhahn Verlag 4 Anett Lütteken/Carsten Zelle/Wolfgang de Bruyn Wir danken der Stadt Thun, dem Schweizerischen Nationalfonds (SNF), der Burgergemeinde Bern und dem Germanistischen Institut der Ruhr-Universität Bochum – die Förderung seitens dieser Institutionen hat die Realisierung dieses Bandes und der ihm zugrunde liegenden Thuner Tagung inkl. Graduiertenwork- shop ermöglicht. Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über <http://dnb.ddb.de> abrufbar. 1. Auflage 2015 Wehrhahn Verlag www.wehrhahn-verlag.de Satz und Gestaltung: Wehrhahn Verlag Umschlagabbildung: Vue des environs de Thoun [Ansicht der Umgebung von Thun, im Vordergrund links das später von Kleist gemietete Haus auf der Oberen Insel bei Thun, jetzt: Kleist-Inseli]. Gemalt und gestochen von D[aniel Simon] Lafon[d] (1763–1831). Kolorierter Umrissstich, 1792 (Bestand: Kleist-Museum, Frankfurt (Oder)). Druck und Bindung: Beltz Bad Langensalza GmbH Alle Rechte vorbehalten Printed in Germany © by Wehrhahn Verlag, Hannover ISBN 978–3–86525–432–0 Vorbemerkung 5 Inhalt Anett Lütteken (Bern/Zürich), Carsten Zelle (Bochum), Wolfgang de Bruyn (Frankfurt (Oder)) Vorbemerkung .................................................................................................. 9 Die Schweiz um 1800 Andreas Fankhauser (Solothurn) »Ich selbst aber, der ich gar keine politische Meinung habe, brauche nichts zu fürchten u. zu fliehen.« Die Schweiz zum Zeitpunkt von Kleists Aufenthalten .................................. 17 Reinhart Siegert (Freiburg/Brsg.) »... in der Schweiz einen Bauernhof zu kaufen, der mich ernähren kann ...« Die Agromanie des 18. -

Heinrich Zschokke : 1771-1848
Heinrich Zschokke : 1771-1848 Autor(en): Günther, Carl Objekttyp: Article Zeitschrift: Argovia : Jahresschrift der Historischen Gesellschaft des Kantons Aargau Band (Jahr): 65 (1953) PDF erstellt am: 05.10.2021 Persistenter Link: http://doi.org/10.5169/seals-62495 Nutzungsbedingungen Die ETH-Bibliothek ist Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Inhalten der Zeitschriften. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern. Die auf der Plattform e-periodica veröffentlichten Dokumente stehen für nicht-kommerzielle Zwecke in Lehre und Forschung sowie für die private Nutzung frei zur Verfügung. Einzelne Dateien oder Ausdrucke aus diesem Angebot können zusammen mit diesen Nutzungsbedingungen und den korrekten Herkunftsbezeichnungen weitergegeben werden. Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen ist nur mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. Die systematische Speicherung von Teilen des elektronischen Angebots auf anderen Servern bedarf ebenfalls des schriftlichen Einverständnisses der Rechteinhaber. Haftungsausschluss Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr für Vollständigkeit oder Richtigkeit. Es wird keine Haftung übernommen für Schäden durch die Verwendung von Informationen aus diesem Online-Angebot oder durch das Fehlen von Informationen. Dies gilt auch für Inhalte Dritter, die über dieses Angebot zugänglich sind. Ein Dienst der ETH-Bibliothek ETH Zürich, Rämistrasse 101, 8092 Zürich, Schweiz, www.library.ethz.ch http://www.e-periodica.ch dessen, was Pestalozzi längst durch sein Kämpfen, Lieben und Leiden auf unserem Boden sich erworben hatte. So dürfen wir ihn, ohne sein reiches zürcherisches Erbe zu verkennen, mit gutem Gewissen zu den Unsern zählen. Und Pestalozzis Wunsch, daß es ihm vergönnt sein möge, «den Dank nicht bloß mit leeren Worten auszudrücken, sondern Gelegenheit zu finden, denselben durch tätigen Einfluß auf das Erziehungswesen des Kantons bescheinigen zu können», verbleibt uns als verpflichtendes Vermächtnis. -

Abkiirzungsverzeichnis
Abkiirzungsverzeichnis ADB Allgemeine Deutsche Biographie. Hg. durch die Historische Commission bei der Bayri schen Akademie der Wissenschaften, 56 Bde., Leipzig 1875/1912 AEWK Allgemeine Encyclopadie der Wissenschaften und Kiinste in alphabetischer Foige von ge nannten Schriftstellern bearbeitet und hg. von Johann Samuel Ersch und Johann Gottfried Gruber, 167 Bde., Leipzig 1818/1889 AGL Jocher, Christian Gottlieb: Allgemeines Gelehrten-Lexikon, 4 Bde., nebst Fortsetrungen und Ergiinzungen, 7 Bde., Leipzig 1750/1897 ASGL Allgemeines Schriftsteller- und Gelehrtenlexikon der Provinzen Livland, Esthland und Kurland. Bearbeitet von Friedrich von der Recke und Edward Napiersky, 4 Bde., Mittau 1827/32 BLHA Biographisches Lexikon hervorragender Arzte aller Zeiten und Volker. Hg. von August Hirsch, 5 Bde., Berlin/Wien 21931/ 1934 BLKO Wurzbach, Constant von: Biographisches Lexikon des Kaiserthums Osterreich, enthaltend die Lebensskizzen der denkwiirdigen Personen, welche 1750 bis 1850 irn Kaiserstaate und in seinen Kronliindern gelebt haben, 60 Bde., Wien 1856/1923 Diss. Dissertation DLL Kosch, Wilhelm: Deutsches Literatur-Lexikon. Biographisches und bibliographisches Handbuch, 4 Bde., Bern 21949/58, Bd. 1 ff., Bern/Miinchen 31966 ff. ebd. ebenda f. folgende GGDD Goedeke, Karl: GrundriB rur Geschichte der deutschen Dichtung aus den Quellen, zweite bzw. dritte ganz neu bearbeitete Auflage, Bd. 1 ff., Dresden 1884 ff. GHGSG Grundlage ru einer hessischen Gelehrten- und Schriftsteller-Geschichte seit der Reformation. Hg. von Friedrich Wilhelm Striedter und Ludwig Wachler, 21 Bde., Kassel 1781/1868 GHL Rotermund, Heinrich Wilhelm: Das gelehrte Hannover oder Lexikon von Schriftstellern und Schriftstellerinnen, gelehrten Geschaftsmiinnern und Kiinstlern, die seit der Refor- mation in- und auBerhalb der siimtlichen rum jetzigen Konigreich Hannover gehOrenden Provinzen gelebt haben [... J, 2 Bde., Bremen 1823 GS Das gelehrte Schwaben: oder Lexicon der jetzt lebenden schwabischen Schriftsteller. -

Manuscripta and Others), As Well As Publications of Meteoswiss (Supplement Volumes of Annals of Meteoswiss)
Swiss Early Instrumental Meteorological Measurements Lucas Pfister1,2, Franziska Hupfer1,2, Yuri Brugnara1,2, Lukas Munz1,2, Leonie Villiger1,2, Lukas Meyer1,2, Mikhaël Schwander1,2, Francesco Alessandro Isotta3, Christian Rohr1,4 and Stefan Brönnimann1,2 1 Oeschger Centre for Climate Change Research, University of Bern, Switzerland 5 2 Institute of Geography, University of Bern, Switzerland 3 Federal Office of Meteorology and Climatology MeteoSwiss, Zurich, Switzerland 4 Institute of History, University of Bern, Switzerland Correspondence to: Lucas Pfister ([email protected]) Abstract. Decadal variability of weather and its extremes is still poorly understood. This is partly due to the shortness of re- 10 cords, which, for many parts of the world, only allow studies of 20th century weather. However, the 18th and early 19th cen- tury have seen some pronounced climatic variations, with equally pronounced impacts on the environment and society. Con- siderable amounts of weather data are available even for that time, but have not yet been digitised. Given the recent progress in quantitative reconstruction of sub-daily weather, such data could form the basis of weather reconstructions. In Switzer- land, measurements before 1864 (the start of the national network) have never been systematically compiled except for three 15 prominent series (Geneva, Basel, Great St. Bernard Pass). Here we provide an overview of early instrumental meteorological measurements in Switzerland resulting from an archive survey. Our inventory encompasses 334 entries from 206 locations, providing an estimated 3640 station years and reaching back to the early 18th century. Most of the data sheets have been pho- tographed and a considerable fraction is undergoing digitisation. -

Heinrich- Zschokke- Brief
Heinrich- Zschokke- Brief Nr. 2 Mai 2002 –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Mitteilungsorgan der Heinrich-Zschokke-Gesellschaft Einzelverkaufspreis: Fr. 5.– oder € 3.– –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Zschokke im Bewusstsein verankern Geleitwort von Thomas Pfisterer, Präsident der Heinrich-Zschokke-Gesellschaft it Genugtuung und Stolz stelle ich fest, Hand geben und sind deshalb froh, dass die Neue dass unsere Gesellschaft eine wichtige Aargauer Bank und die Baufirma Zschokke den M Aufgabe erfüllt. Sie ist zur Ansprech- Ladenpreis mit einem finanziellen Beitrag niedrig partnerin geworden, an die man sich gerne wen- halten helfen. Nur soviel sei vom Inhalt gesagt: det, wenn Fragen im Umfeld von Heinrich Man wird erstaunt sein, wie vielseitig Zschokke Zschokke auftauchen. Als in Magdeburg vergan- tätig war und wie modern, ja visionär manches genes Jahr eine Strasse nach ihm benannt wurde, seiner Anliegen wirkt. bat man uns, den Bürgern Zschokkes hauptsächli- Die Auseinandersetzung mit Heinrich Zschok- che Leistungen vorzustellen und so Interesse für ke muss weiter angeregt und der jungen Genera- den wenig bekannten Magdeburger zu wecken. Im tion dabei besondere Achtung geschenkt werden. Mai und Juni werden wir ihn in zwei Referaten Darüber hinaus dürfen wir die Sicherung des wir als Politiker und Erzieher würdigen. Der An- wertvollen Zschokke-Bestandes nicht vergessen. lass bietet eine gute Gelegenheit, Beziehungen Des Briefwechsels nimmt sich das Staatsarchiv zwischen dem Aargau und Sachsen-Anhalt, Aarau mit lobenswertem Eifer an. Wichtig ist ferner der und Magdeburg zu knüpfen. Oberbürgermeister „Blumenhaldner“ im Stadtmuseum Aarau, eine Dr. Lutz Trümper erklärte sich gerne bereit, eine handgeschriebene Familienzeitung von einzigarti- Delegation von uns zu empfangen. gem kulturhistorischem Wert. Ihn der Forschung Im kommenden Jahr feiert der Kanton Aargau zu erhalten, werden wir uns ebenfalls bemühen. -

Heinrich Zschokke Und Heinrich Remigius Sauerländer, Zwei Häupter Der "Aarauer Partei" : Ein Beitrag Zu Den Kommenden Jubiläen Von 1798 Und 1848
Heinrich Zschokke und Heinrich Remigius Sauerländer, zwei Häupter der "Aarauer Partei" : ein Beitrag zu den kommenden Jubiläen von 1798 und 1848 Autor(en): Sauerländer, Heinz Objekttyp: Article Zeitschrift: Aarauer Neujahrsblätter Band (Jahr): 70 (1996) PDF erstellt am: 05.10.2021 Persistenter Link: http://doi.org/10.5169/seals-558855 Nutzungsbedingungen Die ETH-Bibliothek ist Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Inhalten der Zeitschriften. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern. Die auf der Plattform e-periodica veröffentlichten Dokumente stehen für nicht-kommerzielle Zwecke in Lehre und Forschung sowie für die private Nutzung frei zur Verfügung. Einzelne Dateien oder Ausdrucke aus diesem Angebot können zusammen mit diesen Nutzungsbedingungen und den korrekten Herkunftsbezeichnungen weitergegeben werden. Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen ist nur mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. Die systematische Speicherung von Teilen des elektronischen Angebots auf anderen Servern bedarf ebenfalls des schriftlichen Einverständnisses der Rechteinhaber. Haftungsausschluss Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr für Vollständigkeit oder Richtigkeit. Es wird keine Haftung übernommen für Schäden durch die Verwendung von Informationen aus diesem Online-Angebot oder durch das Fehlen von Informationen. Dies gilt auch für Inhalte Dritter, die über dieses Angebot zugänglich sind. Ein Dienst der ETH-Bibliothek ETH Zürich, Rämistrasse 101, 8092 Zürich, Schweiz, www.library.ethz.ch http://www.e-periodica.ch Heinz Sauerländer Heinrich Zschokke und Heinrich Remigius Sauerländer, zwei Häupter der «Aarauer Partei» Ein Beitrag zu den kommenden Jubiläen von 1798 und 1848 gruppe. Den Rest des Jahres verwendete er zur Vorbereitung auf den Besuch der Universität Frankfurt an der Oder, wo er sich im April 1790 immatrikulierte. -

THE HELVETIC REPUBLIC in REVOLUTIONARY EUROPE Fearful of Foreign Intervention in April 1798, Residen
CHAPTER TWO AMBIVALENT REVOLUTIONARIES: THE HELVETIC REPUBLIC IN REVOLUTIONARY EUROPE Fearful of foreign intervention in April 1798, residents of Inner Switzer- land wrote to the French Directory asking, “Where can you fi nd a mode of government which more exclusively than ours puts the exercise and the rights of sovereignty in the hands of the people? in which civil and political equality is more perfect? in which every citizen enjoys a larger sum of liberty?”1 Th is letter was an attempt to forestall a French inva- sion and the implementation of French Revolutionary reforms. In a fi nal plea, the authors asked, “And what government, citizen-directors, can be more consonant to yours?”2 Th is communication claimed that the Swiss already held dear these so-called revolutionary ideals. Th ere- fore, there was no need to alter the government of the Landsgemeinde cantons. While that was not an entirely honest argument, the abstract con- cepts of liberty, popular sovereignty, civil and political equality never- theless lay at the heart of the revolutionary doctrines of the late eighteenth century. Before 1789, these ideals had been extensively dis- cussed by the intellectual elites of the Swiss Confederation. However, for the most part, those participating in these discussions in eighteenth- century Switzerland sought to reform their sociopolitical conditions rather than tear down the status quo and start anew. Th ese discussions, oft en based on the practical motivation for reforms and improvement of life for everybody residing in the republics, played a large role in the transformation of Swiss political culture. -

Switzerland – a Model for Solving Nationality Conflicts?
PEACE RESEARCH INSTITUTE FRANKFURT Bruno Schoch Switzerland – A Model for Solving Nationality Conflicts? Translation: Margaret Clarke PRIF-Report No. 54/2000 © Peace Research Institute Frankfurt (PRIF) Summary Since the disintegration of the socialist camp and the Soviet Union, which triggered a new wave of state reorganization, nationalist mobilization, and minority conflict in Europe, possible alternatives to the homogeneous nation-state have once again become a major focus of attention for politicians and political scientists. Unquestionably, there are other instances of the successful "civilization" of linguistic strife and nationality conflicts; but the Swiss Confederation is rightly seen as an outstanding example of the successful politi- cal integration of differing ethnic affinities. In his oft-quoted address of 1882, "Qu’est-ce qu’une nation?", Ernest Renan had already cited the confederation as political proof that the nationality principle was far from being the quasi-natural primal ground of the modern nation, as a growing number of his contemporaries in Europe were beginning to believe: "Language", said Renan, "is an invitation to union, not a compulsion to it. Switzerland... which came into being by the consent of its different parts, has three or four languages. There is in man something that ranks above language, and that is will." Whether modern Switzerland is described as a multilingual "nation by will" or a multi- cultural polity, the fact is that suggestions about using the Swiss "model" to settle violent nationality-conflicts have been a recurrent phenomenon since 1848 – most recently, for example, in the proposals for bringing peace to Cyprus and Bosnia. However, remedies such as this are flawed by their erroneous belief that the confederate cantons are ethnic entities. -

Heinrich Zschokke – Sein Leben Und Wirken
Heinrich Zschokke – sein Leben und Wirken Vortrag vor der Genealogisch-Heraldischen Gesellschaft Zürich am 4.12.2007 n der Einladung zu meinem Referat steht: „Es So beginnen Zschokkes „Schweizerlands Ge- wird behauptet, der ‚Revolutionär’ Heinrich schichten“: IZschokke habe den Bundesstaat Schweiz ‚er- „Von wunderhaften Dingen, Heldenfahrten, gu- funden’. Nachforschungen in Archiven und Biblio- ten und bösen Tagen der Väter ist viel gesun- theken ergeben, dass diese Behauptung nicht von gen und gelehrt. Nun will ich die alten Sagen der Hand zu weisen ist.“ verjüngen im Gemüth alles Volks. Und ich tra- Der Text basiert auf einer Webseite der Freimau- ge sie den freien Mannen zu in Berg und Bo- rerloge „Zur Brudertreue“ in Aarau, die Zschokke den, auf daß ihre Herzen sich entzünden in vor 197 Jahren mitbegründete. Aber auch der neuer Inbrunst zum theuerwerthen Vaterlande. Schweizer Historiker Edgar Bonjour hat vor etwa So merket auf meine Rede, ihr Alten und 60 Jahren in einem privaten Gespräch geäussert, Jungen. Die Geschichte verflossener Zeiten ist dass ohne Heinrich Zschokke die moderne Schweiz ein Baum der Erkenntniß des Guten und Bösen. nicht möglich gewesen wäre. Wo der von den Eisbergen des Wallis herab- Wir werden sehen, wie dies zu verstehen ist und fallende Rhonestrom, nachdem er einen Theil ob die Behauptung bestätigt werden kann. von Frankreich durchzogen hat, ins Meer 1. Der Mythos Schweiz stürzt, erhebt sich ein geringes Gebirg. Das dehnt sich von da gegen Sonnenaufgang hin, Heinrich Zschokke ist heute bei uns relativ unbe- dreihundert Stunden Wegs lang, an Italien vor- kannt. Das scheint ein Widerspruch zur Aussage zu bei, immer höher zu den Wolken des Himmels sein, dass er viel zur Entstehung der Schweiz beige- seine tausend Hörner streckend, von Eis und tragen habe. -

The Battles Over Swiss Liberty
Swiss American Historical Society Review Volume 38 Number 3 Article 3 11-2002 The Battles over Swiss Liberty Marc H. Lerner Columbia University Follow this and additional works at: https://scholarsarchive.byu.edu/sahs_review Part of the European History Commons, and the European Languages and Societies Commons Recommended Citation Lerner, Marc H. (2002) "The Battles over Swiss Liberty," Swiss American Historical Society Review: Vol. 38 : No. 3 , Article 3. Available at: https://scholarsarchive.byu.edu/sahs_review/vol38/iss3/3 This Article is brought to you for free and open access by BYU ScholarsArchive. It has been accepted for inclusion in Swiss American Historical Society Review by an authorized editor of BYU ScholarsArchive. For more information, please contact [email protected], [email protected]. Lerner: The Battles over Swiss Liberty I. The Battles over Swiss Liberty by Marc H. Lerner Between the French Revolution and the Revolutions of 1848, the European conception of freedom and liberty changed dramatically. 1 Likewise with Switzerland, between the Helvetic Republic and the Sonderbund war of 184 7, the conceptions of true Swiss liberty underwent radical alteration. In Zurich, Schwyz and Vaud a growing individualistic sense of liberty challenged a collective sense of freedom. To some extent an emphasis on guaranteed individual rights replaced the emphasis on local autonomy and self-rule. The changing understandings of Freiheit or liberte in Zurich, Schwyz and Vaud reflect the changes that occurred throughout Switzerland as well as Europe. The battle over what was and who determined true Swiss liberty or virtue also had ramifications beyond the borders of the Swiss state. -

The Broken Pitcher COLLEGE of ARTS and SCIENCES Imunci Germanic and Slavic Languages and Literatures
The Broken Pitcher COLLEGE OF ARTS AND SCIENCES ImUNCI Germanic and Slavic Languages and Literatures From 1949 to 2004, UNC Press and the UNC Department of Germanic & Slavic Languages and Literatures published the UNC Studies in the Germanic Languages and Literatures series. Monographs, anthologies, and critical editions in the series covered an array of topics including medieval and modern literature, theater, linguistics, philology, onomastics, and the history of ideas. Through the generous support of the National Endowment for the Humanities and the Andrew W. Mellon Foundation, books in the series have been reissued in new paperback and open access digital editions. For a complete list of books visit www.uncpress.org. The Broken Pitcher A Comedy in One Act by heinrich von kleist translated by bayard quincy morgan UNC Studies in the Germanic Languages and Literatures Number 31 Copyright © 1961 This work is licensed under a Creative Commons cc by-nc-nd license. To view a copy of the license, visit http://creativecommons. org/licenses. Suggested citation: Kleist, Heinrich von. The Broken Pitcher: A Comedy in One Act. Translated by Bayard Quincy Morgan. Chap- el Hill: University of North Carolina Press, 1961. doi: https://doi. org/10.5149/9781469658025_vonKleist Library of Congress Cataloging-in-Publication Data Names: Morgan, Bayard Quincy. Title: The broken pitcher : A comedy in one act / by Bayard Quincy Morgan. Other titles: University of North Carolina Studies in the Germanic Languages and Literatures ; no. 31. Description: Chapel Hill : University of North Carolina Press, [1961] Series: University of North Carolina Studies in the Germanic Languages and Literatures. Identifiers: lccn 61064205 | isbn 978-0-8078-8031-9 (pbk: alk.