Denkstätte Widerstand Weingarten
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
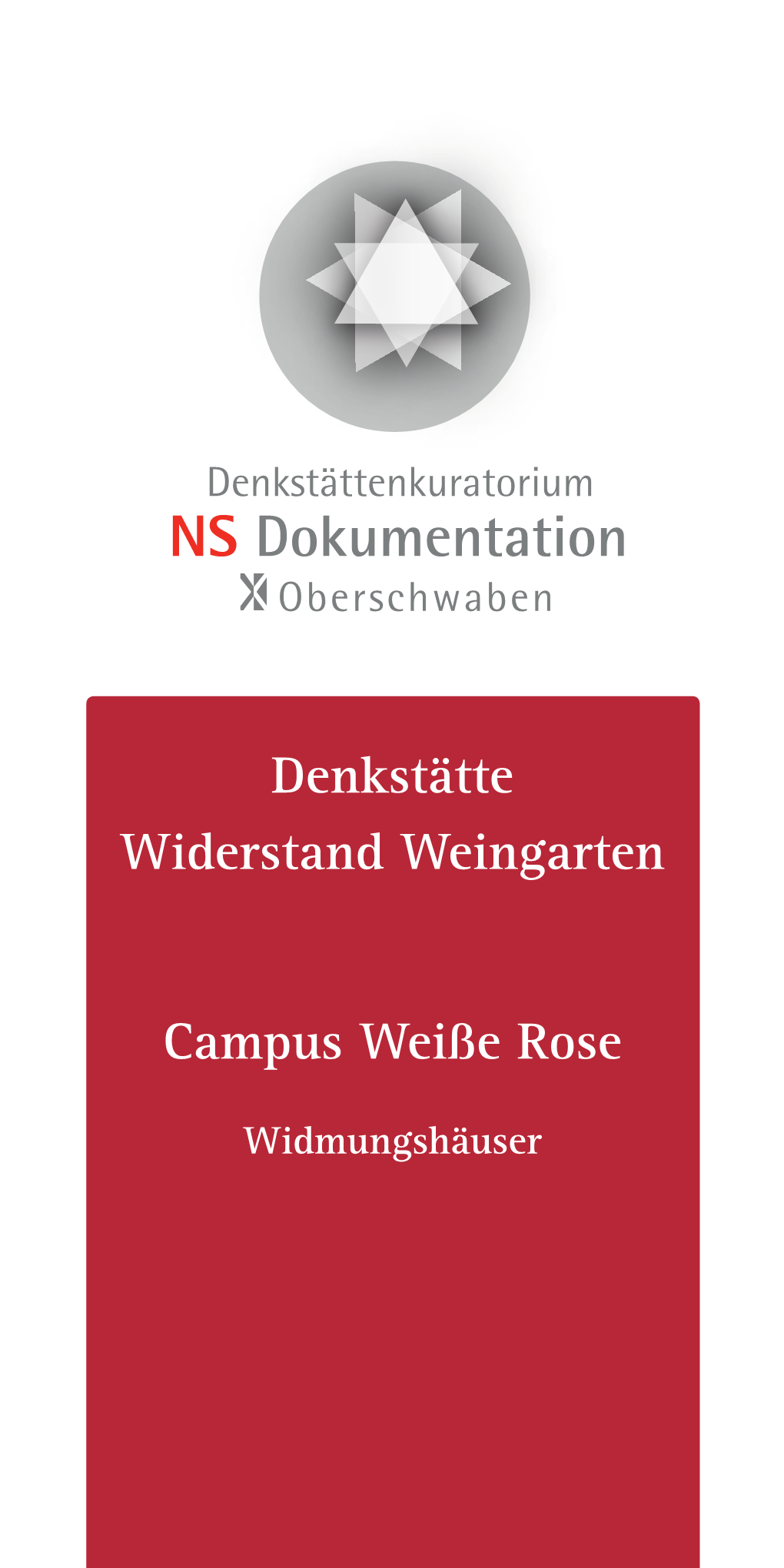
Load more
Recommended publications
-

Scientific Contributions of the First Female Chemists at the University of Vienna Mirrored in Publications in Chemical Monthly 1
Monatshefte für Chemie - Chemical Monthly (2019) 150:961–974 https://doi.org/10.1007/s00706-019-02408-4 ORIGINAL PAPER Scientifc contributions of the frst female chemists at the University of Vienna mirrored in publications in Chemical Monthly 1902–1919 Rudolf Werner Soukup1 · Robert Rosner1 Received: 29 November 2018 / Accepted: 1 March 2019 / Published online: 29 April 2019 © The Author(s) 2019 Abstract In 1897, the frst female students were admitted at the Faculty of Philosophy at Vienna University. The frst dissertation in chemistry was approved in 1902. In the following years, only one or two women were annually enrolled, while the number of male students of chemistry continuously fuctuated around 22. Whereas four women completed their doctorate in the frst year of WWI, six followed in 1917, and ten more in 1919. Strikingly, in that year the number of female students even exceeded that of male colleagues. Margarethe Furcht, the daughter of a Jewish stockbroker, was the frst female chemist with a doctoral degree certifcate in the Austro-Hungarian Empire. Her paper “Über die Veresterung von Sulfosäuren…”, which she published in 1902 together with her academic supervisor Rudolf Wegscheider, was one of the frst scientifc chemical publications of women in Austria. However, of all female graduates, only a small number worked as chemists within the next two decades. After the occupation of Austria by German Troops in March 1938, seven of the Jewish women managed to emigrate, four were murdered in the Holocaust. Given the importance of this period within the landscape of European scientifc history, we here aim to provide the frst comprehensive overview of the history of women studying chemistry at the University of Vienna. -
The White Rose in Cooperation With: Bayerische Landeszentrale Für Politische Bildungsarbeit the White Rose
The White Rose In cooperation with: Bayerische Landeszentrale für Politische Bildungsarbeit The White Rose The Student Resistance against Hitler Munich 1942/43 The Name 'White Rose' The Origin of the White Rose The Activities of the White Rose The Third Reich Young People in the Third Reich A City in the Third Reich Munich – Capital of the Movement Munich – Capital of German Art The University of Munich Orientations Willi Graf Professor Kurt Huber Hans Leipelt Christoph Probst Alexander Schmorell Hans Scholl Sophie Scholl Ulm Senior Year Eugen Grimminger Saarbrücken Group Falk Harnack 'Uncle Emil' Group Service at the Front in Russia The Leaflets of the White Rose NS Justice The Trials against the White Rose Epilogue 1 The Name Weiße Rose (White Rose) "To get back to my pamphlet 'Die Weiße Rose', I would like to answer the question 'Why did I give the leaflet this title and no other?' by explaining the following: The name 'Die Weiße Rose' was cho- sen arbitrarily. I proceeded from the assumption that powerful propaganda has to contain certain phrases which do not necessarily mean anything, which sound good, but which still stand for a programme. I may have chosen the name intuitively since at that time I was directly under the influence of the Span- ish romances 'Rosa Blanca' by Brentano. There is no connection with the 'White Rose' in English history." Hans Scholl, interrogation protocol of the Gestapo, 20.2.1943 The Origin of the White Rose The White Rose originated from individual friend- ships growing into circles of friends. Christoph Probst and Alexander Schmorell had been friends since their school days. -

Today's Martyrs
Today’s Martyrs Resources for understanding current Christian witness and martyrdom White Rose resistance milestones – 1941 through 1945 This timeline contains not only the events of the arrest and execution of the Christian members of the anti-Nazi White Rose resistance movement, but also relevant entries of Bishop Clemens August Graf von Galen (who had inspired them with his anti-Nazi homilies) and Helmut James Graf von Moltke (the jurist responsible for sending the White Rose leaflets to London) Sunday July 13, 1941 Germany: Munster Bishop Clemens August Graf von Galen (aged 63, co-authored the 1937 encyclical Mit Brennender Sorge, which attacked the philosophical underpinnings of the Nazi regime; UPDATE: delivered a homily attacking the Gestapo for human and civil rights violations that denied justice and created a climate of fear in the country) http://en.wikipedia.org/wiki/Clemens_August_Graf_von_Galen Sunday July 20, 1941 Germany: Munster Bishop Clemens August Graf von Galen (aged 63, UPDATE: delivered a homily stating that written protests against the government’s anti-Christian activities had failed, that clergy and religious were still being arrested and deported, and that the German people were being destroyed not by the Allies’ war activities but rather by negative forces within the country) http://en.wikipedia.org/wiki/Clemens_August_Graf_von_Galen Sunday August 3, 1941 Germany: Munster Bishop Clemens August Graf von Galen (aged 63, UPDATE: delivered a homily condemning the desecration of churches, the closing of convents -

Fragebogen Zur Ausstellung Mit Hintergrundinformationen Zu Den Antworten
Fragebogen zur Ausstellung mit Hintergrundinformationen zu den Antworten Bei der Auflösung der Fragen soll zu jeder richtigen Antwort auch geklärt werden, warum genau diese richtig ist und andere Lösungen falsch sind. Es können auch mehrere Antworten richtig sein oder alle falsch! 1, Welcher Zeitraum lag zwischen der Verhaftung von Hans und Sophie Scholl und dem Ende des Zweiten Weltkrieges? a, 1 Jahr und 2 Monate b, über 2 Jahre c, 5 Jahre 2, Welcher der genannten Akteure war kein Mitglied der Weißen Rose? a, Falk Harnack b, Prof. Kurt Huber c, Dietrich Bonhoeffer 3, Wie äußerte sich Jakob Schmid – damaliger Hausschlosser der Universität, der am 18. Februar 1943 durch sein Einschreiten die Verhaftung von Hans und Sophie Scholl verursachte hatte – nach dem Krieg zu seinem Verhalten? a, Beruft sich auf seine Pflicht b, Fühlt sich ungerecht behandelt c, Äußert tiefes Bedauern 4, Wie entstand nach heutiger Kenntnis der Name „Weiße Rose“? a, In Anlehnung an die Redewendung „Weiße Weste“ b, Eine weiße Rose war die Lieblingsblume von Hans Scholl und Alexander Schmorell. c, „Die Weiße Rose“ hieß ein verbotener Roman, den Hans Scholl gelesen hat. 5, Welches Ereignis fand zeitgleich zur Verhaftung der Geschwister Scholl am 18. Februar 1943 in Berlin statt? a, Aufruf des Propagandaministers Joseph Goebbels im Berliner Sportpalast zum „Totalen Krieg“ b, Eine landesweite Großversammlung der deutschen „Hitlerjugend“ c, Eine Massendemonstration von Oppositionellen gegen die NS Diktatur 6, Welches Mitglied zählt nicht zum „inneren Freundeskreis“ der Weißen Rose? a, Alexander Schmorell b, Prof. Kurt Huber c, Hans Conrad Leipelt Weiße Rose Fragebogen Ausstellung mit Hintergrundinformationen – 1 7, Auf welchen Gemeinsamkeiten beruhte ihre Freundschaft? a, Interesse für Philosophie und Literatur b, unangepasstes Verhalten c, Interesse an Militärflugzeugen 8. -

Weingarten KW 51 ID 105174
weingarten im Blick Amtsblatt und Bürgerzeitung der Stadt Weingarten WEIHNACHTSGRÜSSE Ausgabe 45/2015 Freitag, 18. Dezember 2015 OB Ewald: Diese Ausgabe erscheint auch online Den Aufschwung stabilisieren Liebe Bürgerinnen und Bürger der Stadt Weingarten, wieder geht ein ereignis- und arbeitsrei- dem Drehorgelkongress, um nur einige ches Jahr zu Ende. Ein Thema hat im Jahr zu nennen. Nochmals herzlichen Dank an 2015 alle anderen überlagert: die Ankunft die Organisatoren. von mehr als einer Million Flüchtlingen Nach mehreren Jahren des intensiven Spa- in Deutschland. Auch wir im Rathaus rens ist der Aufschwung nach zwei Jahren wurden von dieser Herausforderung über- mit deutlichen Haushaltsüberschüssen rascht. Wir haben uns dafür entschieden, wieder nach Weingarten zurückgekehrt. diese Aufgabe als Chance zu begreifen. Der städtische Haushalt entwickelt sich Hilfreich war, dass Weingarten bereits auch im Jahr 2016 positiv. Die finanzielle viel Erfahrung mit der Integration von Aufarbeitung der Krankenhauskrise wur- Menschen aus den osteuropäischen Län- de vor wenigen Tagen erfolgreich abge- dern hat. Gemeinsam und durch einen schlossen. Neue Investitionen sind wieder In dieser Ausgabe lesen Sie: phantastischen Einsatz von vielen ehren- planbar. Diese positive Entwicklung gilt amtlichen Helferinnen und Helfern haben es in den nächsten Jahren auszubauen und SEITE 1+2: wir diese Aufgabe bisher gut gemeistert zu stabilisieren. Alles Gute! und von vielen Seiten dafür Anerkennung Mir bleibt noch, allen Bürgerinnen und erfahren. Ich bin zuversichtlich, dass wir Bürgern für Ihr Engagement in unserer Weihnachten und das Neue Jahr ste- diese Herausforderung auch in Zukunft Stadt zu danken. Ich wünsche Ihnen und hen vor der Tür. Wir wünschen Ihnen gemeinsam bewältigen werden. Denn Ihren Familien einen schwungvollen Start das Beste und laden zur Neujahrsbe- viele der Flüchtlinge werden in Deutsch- ins Neue Jahr und davor ein besinnlich- grüßung ein. -
Tätigkeitsbericht 2015 Weiße Rose Stiftung E.V
Tätigkeitsbericht 2015 Weiße Rose Stiftung e.V. Inhaltsübersicht 1 Zur Einführung 5 2 Chronik und Ausstellungskalender 7 3 Prof. Dr. Wolfgang Huber berichtet 10 4 Joachim Baez in Weingarten 11 5 Nachrufe 12 6 Wanderausstellungen 16 Die Weiße Rose in Deutschland 16 Die Weiße Rose in Israel 19 Die Weiße Rose in Frankreich 23 Die Weiße Rose in Italien 25 Die Weiße Rose in Mittel- und Osteuropa 26 Die Weiße Rose in den USA 30 Die Weiße Rose in Brasilien 34 7 DenkStätte Weiße Rose München 36 Erneuerung der Dauerausstellung in der DenkStätte 40 8 DenkStätte Weiße Rose Ulm 41 9 Historisch-pädagogische Projekte 42 Lehrerfortbildung 42 Auf den Spuren des Nationalsozialismus in München 45 Ein Tag zu Sophie Scholl in Garmisch 46 Das Dritte Reich – für Kinder erklärt 47 SchülerArbeiten zur Zeitgeschichte 49 Spurensuche – Verlorene Jugend in der NS-Diktatur 50 10 Veranstaltungen 51 Weiße Rose Orgelkonzert zum 18. Februar 1943 51 Konzert mit Lesung „Die Gedanken sind frei“ 52 In Erinnerung an Eugen Grimminger 53 Mozes Ancselovics – Eine Gedenkveranstaltung in Ergoldsbach 54 Werkschau: Sophie Scholl – So entsteht die Comic-Biographie 55 Vortrag: Thomas Mann, Alfred Neumann und die Weiße Rose 57 11 Homepage und Social Media 58 12 Neuerscheinungen 59 13 Kurznachrichten um die Weiße Rose 60 14 Die Weiße Rose Stiftung e.V., ihre Organe und MitarbeiterInnen 65 Die Weiße Rose Stiftung e.V. dankt herzlich allen öffentlichen und privaten Förderern sowie allen Spendern für ihre Zuwendungen. Impressum Weiße Rose Stiftung e.V. Ludwig-Maximilians-Universität Geschwister-Scholl-Platz 1 80539 München Tel. 089 / 2180-5678 / -5359 Fax 089 / 2180-5346 E-Mail: [email protected] Internet: http://www.weisse-rose-stiftung.de Facebook: www.facebook.com/WeisseRoseStiftung Redaktion: Ursula Kaufmann M.A., Dr. -

Hans Conrad Leipelt
Hans Conrad Leipelt Hans Conrad Leipelt wurde am 18. Juli 1921 in Wien als Sohn des Diplomingenieurs Konrad Leipelt und der promovierten Chemikerin Katharina Leipelt geboren und starb am 29. Januar 1945 in München-Stadelheim. 1925 zog seine Familie von Wien nach Hamburg, nachdem sein Vater die Stelle als Hüttendirektor der Zinnwerke Wilhelmsburg angenommen hatte. Ab 1935 unterlag die Familie aufgrund der jüdischen Herkunft von Katharina Leipelt der Unterdrückung der Nürnberger Rassengesetze. 1938 machte Hans L. sein Abitur und meldete sich zum Reichsarbeitsdienst und zur Wehrmacht. Hans Conrad Leipelt Während des Westfeldzuges lernte er Karl Ludwig Schneider kennen mit dem ihn später eine enge Freundschaft verband. Im August 1940 wurde er trotz hoher Auszeichnungen entlassen und begann im Herbst sein Chemiestudium an der Universität Hamburg. Durch Schneider lernte er Margaretha Rothe und Heinz Kucharski - beide ebenfalls NS-Gegner - kennen, mit denen er später die Widerstandsgruppe „Weiße Rose Hamburg" gründete. Im Wintersemester 1941/42 wechselte er an die Ludwig-Maximilians-Universität in München, wo er u.a. das Vermächtnis der Geschwister Scholl fortsetzte, zu Professor Heinrich Otto Wieland, der als Nobelpreisträger in der Lage war, „Halbjuden“ auszubilden, denen das Studium seit 1940 untersagt war. Nach der Hinrichtung der Geschwister Scholl und Christoph Probst im Februar 1943 erhielt Leipelt das 6. Flugblatt der Weißen Rose, welches er gemeinsam mit Marie-Luise Jahn im April nach Hamburg brachte, wo sie es mit dem Zusatz „Und ihr Geist lebt trotzdem weiter!“ versahen, vervielfältigten und verbreiteten. Im Spätherbst 1943 werden sie jedoch mit 28 weiteren Aktivisten verhaftet. Hans Leipelt wird am 13. Oktober 1944 vom Volksgerichtshof als Hochverräter wegen des Hörens ausländischer Rundfunksender, der Wehrkraftzersetzung und der „Feindbegünstigung“ zum Tode verurteilt, Marie-Luise Jahn zu 12 Jahren Zuchthaus. -

Fragebogen Zur Wanderausstellung Weiße Rose
Fragebogen zur Ausstellung „Weiße Rose. Der Widerstand von Studenten gegen Hitler. München 1942/43“ Bei der Auflösung der Fragen soll zu jeder richtigen Antwort geklärt werden, warum genau diese richtig ist und andere Lösungen falsch sind. Es können mehrere oder alle Antworten richtig oder falsch sein! 1. Warum wurde der Name „Weiße Rose“ gewählt? a) Eine weiße Rose war das Symbol der Münchner Medizinstudenten. b) Eine weiße Rose war die Lieblingsblume von Sophie Scholl, sie schlug daher den Namen vor. c) Hans Scholl gab an, dass er den Namen „willkürlich“ gewählt habe, da er gut klinge und eine starke Aussagekraft habe. 2. Welcher Zeitraum lag zwischen der Verhaftung von Hans und Sophie Scholl und dem Ende des Zweiten Weltkrieges? a) Zwei Monate b) Über zwei Jahre c) Fünf Jahre 3. Welcher der genannten Akteure war nicht an den Widerstandsaktionen der Weißen Rose beteiligt? a) Willi Graf b) Prof. Kurt Huber c) Dietrich Bonhoeffer 4. Wer zählt zum erweiterten Widerstandskreis der Weißen Rose und warum? a) Alexander Schmorell b) Prof. Kurt Huber c) Hans Conrad Leipelt 5. Gab es während des Nationalsozialismus eine freie Jugendbewegung? a) Nein. Mit dem „Gesetz über die Hitlerjugend“ von 1936 waren alle Jugendlichen zur Mitgliedschaft in der Hitler-Jugend verpflichtet. Eine dazu alternative Jugendbewegung konnte nur im Untergrund weitergeführt werden. b) Nein. Die Jugendlichen waren so vom Nationalsozialismus begeistert, dass sie kein Bedürfnis hatten, sich einer anderen Jugendgruppe als der Hitler-Jugend anzuschließen. c) Ja. Die Nationalsozialisten förderten die freie Entfaltung der Jugend. 6. Hatten Hans Scholl und weitere Mitstreiter der Weißen Rose vor ihrer Verhaftung 1943 bereits Erfahrungen mit der Gestapo (Geheimen Staatspolizei) gemacht? a) Ja b) Nein c) Nur Hans Scholl 7. -

Remembering Heinrich Wieland (1877-1957) Portrait of an Organic Chemist and Founder of Modern Biochemistry
Remembering Heinrich Wieland (1877-1957) Portrait of an Organic Chemist and Founder of Modern Biochemistry Bernhard Witkop National Institute of Diabetes. Digestive. and Kidney Diseases. National Institutes of Health. Bethesda. Maryland 20892 I . Introduction: The King’s Remembrancer ........... ........ 196 I1 . Master and Disciple .................................................... 196 111 . Wielands Ancestors .................................................... 197 IV . Wielands Lectures ..................................................... 197 V. Principiis Obsta ........................................................ 199 VI . Pforzheim and Its Genius Loci ................. 201 VII . The Dimitri Mendeleyeev Cent ............................... 202 VIII . The Harvard University Tercentenary (1936) .............................. 203 IX . Work, Leisure, and the Muses ........................................... 204 X . Wieland’s Academic Career: An Archivist’s View .......................... 207 XI . Autobiographical Notes ............ 208 XI1 . Activated Acetic Acid and the Nobel Prize for Lynen ...................... 209 XI11 . The Birth of Biochemistry out of the Spirit of Organic Chemistry ........... 211 XIV. Wielands Paradigm of Hydrogen Shift ................................... 211 xv. Intuition and the Biosynthesis of Cholestero .................. 213 XVI . Two Personalities: Woodward and Wieland .................. 214 XVII . The Choleic Acid Principle and its Importan 218 XVIII . Stepping Stones to the Nobel Prize (1928) ............................... -

Mahnmale Maria Elisabeth Stapp
Das Pfarrhaus Mooshausen Denkort im Großen Erinnerungsweg von Oberschwaben Samstag 16. März 2013, 10.00 – 12.00 Uhr Begegnung und Gespräch im Alten Schulhaus Mooshausen Weiger-Guardini- Straße 17 Es sprechen: Prof. Dr. Wolfgang Marcus Beauftragter des Denkstättenkuratoriums Bischof Dr. Gebhard Fürst Prof. Dr. Hanna-Barbara Gerl-Falkovitz Vorsitzende des Freundeskreises Mooshausen 11:45 Uhr Enthüllung der Gedenktafel am Alten Pfarrhaus Mooshausen, Weiger-Guardini-Straße 9 Inhalt 1. Ausstellung im Alten Schulhaus mit 64 DIN A3 Blättern 2. Fotos vom 16. März 2013 (Elisabeth Prégardier und Olaf Schulze) 3. ■Pressenotizen ■Mahnmale von Maria Elisabeth Stapp Pfarrhaus Mooshausen Denkort im Erinnerungsweg von Oberschwaben Ausstellung im Alten Schulhaus von Mooshausen 1. Einführung 1.1 Pfarrhaus ist ein Denkort 1.2. Die Opfer der Weißen Rose 1.3.Josef Weiger 1.4.Romano Guardini 2. Die Freunde 2.1.Erwin Planck 2.2. Die Opfer des 23. Jan. 1945 2.3. Wilhelm Geyer 2.4. Freunde in Treherz 3.-8. Denkorte: Broschüre Landkreis Ravensburg 9. Flugblatt 6 und die Folgen 9.1. Flugblatt 6 9.2.Flugblatt Personen 9.3.Buch: Die Stärkeren 9.4.Text: Christlicher Widerstand 10. Die Gefährten 10.1. Christoph Probst 10.2 Alexander Schmorell 10.3. Willi Graf 10.4. Hans Leipelt 11. Die Mentoren 11.1. Carl Muth und Theodor Haecker 11.2 Kurt Huber u. R. Guardini u. 11.3. Augustinus u. Newman 11.4. Weitere Mentoren / Rieck 12. Johannesgestalten 12.1. Brandenburg-Görden 12.2. Plötzensee 12.3. München-Stadelheim 12.4. Halle / Peter Buchholz 13. Familie Scholl 13.1. Robert u. Magdalena Scholl 13.2. -

1 Wandsbek Erinnert an 1933-1945 Wegweiser Zu Den Gedenkstätten
Wandsbek erinnert an 1933-1945 Wegweiser zu den Gedenkstätten 1 2 Wandsbek erinnert an 1933-1945 Wegweiser zu den Ge- denkstätten Herausgegeben von der Bezirksversammlung Wandsbek Redaktion: Stefan Romey 3 Impressum Herausgeber: Bezirksversammlung Wandsbek Peter Pape, Vorsitzender der Bezirksversammlung Wandsbek Geschäftsstelle: Schloßstraße 60, 22041 Hamburg Olaf Bertolatus, Andreas Marko E-Mail: [email protected] Redaktion: Stefan Romey Mitwirkung: Hans-Joachim Klier, Astrid Louven, Ingo Wille Grafische Gestaltung: Eva-Maria Nerling Hamburg, Januar 2020 ISBN 978-3-00-064458-0 Mit Unterstützung des Bundesministeriums für Familie, Senioren, Frauen und Jugend im Rahmen des Bundesprogramms 4 Zu diesem Buch Mit diesem Buch ergänzt der Bezirk Wandsbek die von Detlef Garbe und Kerstin Klingel herausgegebene Schrift „Gedenkstät- ten in Hamburg. Ein Wegweiser zu Stätten der Erinnerung an die Jahre 1933 bis 1945.“ 1 Es stellt umfänglich die im Bezirk Wands- bek liegenden Gedenkorte vor und erweitert somit die Hambur- ger Gesamtübersicht. Dieser Wegweiser erhebt nicht den Anspruch auf Vollstän- digkeit. Gleiches gilt für die beigefügten Literaturempfehlungen. Diese sollen Interessierten ermöglichen, sich weitere Informati- onen zu den jeweiligen Gedenkorten und vertiefende Kenntnisse zu den Jahren 1933 — 1945 zu verschaffen. Geschichte vor Ort soll erlebbar werden. Es sollen Schlüsse aus der Vergangenheit für Gegenwart und Zukunft gezogen wer- den können. Die deutsche Kultusministerkonferenz sagt in ihren Empfehlungen zur -

Forsch Bonner Universitäts-Nachrichten1 Studieren Heute Zwischen Anwesenheitspflicht Und Bewerberansturm
Februar 2012forsch Bonner Universitäts-Nachrichten1 Studieren heute Zwischen Anwesenheitspflicht und Bewerberansturm http://unishop-bonn.de Im „Unishop“ kann man ganz in Ruhe die Artikel im Internet ansehen und bestellen, was es Nützliches und Schönes im Universitätsdesign gibt. Die Textilien sind in verschiedenen Schnitten, Farben, und Designs – nämlich klassisch, modern oder peppig – zu haben, getreu dem Bonner Uni-Motto „Traditionell modern“. Es gibt Tassen, Schirm, Schreibset und eine silberfarbige Thermoskanne sowie weitere Artikel. Neu sind zwei verschiedene Taschen jeweils in mehreren Farben. Die Artikel sind auch beim Infopunkt / FAZ-Café im Hauptgebäude und bei der Buchhandlung Behrendt erhältlich. Fotos:Campussportswear (7) ThomasDr. / Mauersberg (3) Unishop 02-12.indd 1 25.01.12 11:25 EDITORIAL Editorial Foto: Dr. Thomas Mauersberg / Uni Bonn / Uni Mauersberg Thomas Dr. Foto: Liebe Leserinnen und Leser, Eine ganz besondere Abendstimmung im das hat es bislang noch nicht gegeben: Eigentlich wollten wir nur ein schö- Bonner Hofgarten. nes Foto von unserem Hauptgebäude veröffentlichen. Zugegeben: Das Motiv, das unser Webkoordinator Dr. Thomas Mauersberg in der „High Dynamic Range“ (HDR)-Fototechnik aufgenommen hatte, ist sicher eines der schönsten Bilder, die in der letzten Zeit im Hofgarten entstanden sind. Aber was dann geschah, hat uns wirklich sehr überrascht: Rund 2.000 Nutzer unserer Face- book-Seite klickten innerhalb von nicht einmal 24 Stunden auf „Gefällt mir!“, 300 „teilten“ das Bild mit ihren Facebook-Freunden und über 100 Kommenta- re wurden abgegeben, die zumeist denselben Tenor hatten: „So ein schönes Unihauptgebäude muss man erstmal haben!“ brachte es eine Teilneh- merin auf den Punkt. Viele erinnerten sich freudig an ihre Studienzeit in Bonn und ließen ihrem Heimweh nach der Universitätsstadt am Rhein freien Lauf.