Tätigkeitsbericht 2015 Weiße Rose Stiftung E.V
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
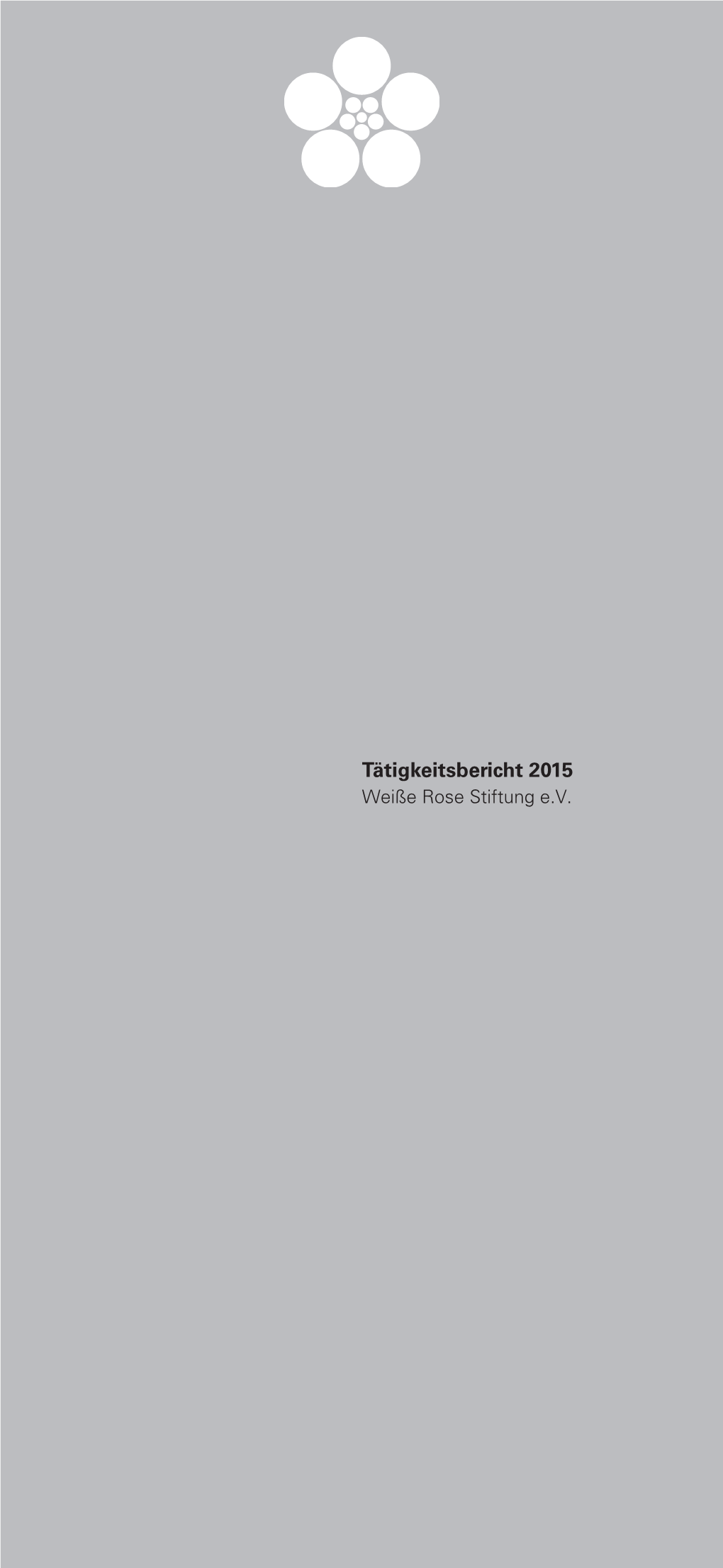
Load more
Recommended publications
-

Scientific Contributions of the First Female Chemists at the University of Vienna Mirrored in Publications in Chemical Monthly 1
Monatshefte für Chemie - Chemical Monthly (2019) 150:961–974 https://doi.org/10.1007/s00706-019-02408-4 ORIGINAL PAPER Scientifc contributions of the frst female chemists at the University of Vienna mirrored in publications in Chemical Monthly 1902–1919 Rudolf Werner Soukup1 · Robert Rosner1 Received: 29 November 2018 / Accepted: 1 March 2019 / Published online: 29 April 2019 © The Author(s) 2019 Abstract In 1897, the frst female students were admitted at the Faculty of Philosophy at Vienna University. The frst dissertation in chemistry was approved in 1902. In the following years, only one or two women were annually enrolled, while the number of male students of chemistry continuously fuctuated around 22. Whereas four women completed their doctorate in the frst year of WWI, six followed in 1917, and ten more in 1919. Strikingly, in that year the number of female students even exceeded that of male colleagues. Margarethe Furcht, the daughter of a Jewish stockbroker, was the frst female chemist with a doctoral degree certifcate in the Austro-Hungarian Empire. Her paper “Über die Veresterung von Sulfosäuren…”, which she published in 1902 together with her academic supervisor Rudolf Wegscheider, was one of the frst scientifc chemical publications of women in Austria. However, of all female graduates, only a small number worked as chemists within the next two decades. After the occupation of Austria by German Troops in March 1938, seven of the Jewish women managed to emigrate, four were murdered in the Holocaust. Given the importance of this period within the landscape of European scientifc history, we here aim to provide the frst comprehensive overview of the history of women studying chemistry at the University of Vienna. -

UME Frederick County Master Gardener FREE 2017 Spring Seminars by Devra G
VOLUME 2, NO. 9 • www.woodsborotimes.com • sePtember 2014 VOLUME 5, NO. 4 • WWW.WOODSBOROTIMES.COM • APRIL 2017 tear on the rubber surface. A child swing suspended off the NewNew President playground and CEO comingCounty rejectsground anddeveloper pushed by an adult can be built. “Swings where kids drag their of Woodsboro Bank The playground structure is for newapplication barbecue grills, volleyball feet will only tear the surface children ages 5 to 12. courts,Michele and Kettner benches at the park up andSome create of the a councilmaintenance members Stephen K. Heine has joined in the Frederick community After soliciting design and - items the town had not origi- problem,”were concerned he said. that the“A applicationmerry- Woodsboro Bank as President where he serves as the YMCA of pricing proposals from sev- nallyThe asked Frederick for. County Council go-roundwas brought where kidsto themrun in asthe one and CEO, effective immediately, Frederick County, Chair-elect; eral recreation design compa- voted“I asked against them the Urbana not to rezoning leave samedocument circle pushing instead ofit threewill wearseparate following the announcement St. Katherine Drexel Catholic nies, town commissioners vot- anyapplication money onwhich the table,”would Rithave- andpieces. be a “It’smaintenance not the problemapplications of the retirement of C. Richard Church, Corporator; and the ed unanimously at their Aug. telmeyeradded 75 said. townhouses to the as andwell.” the merits of the application; Miller, Jr. late last year. Mr. Rotary Club of Carroll Creek. 12 meeting to hire playground MarketThe company District ofhas Urbana. constructed it Commissioneris the combining Ken of allKellar three of Heine has 35 years of banking He is on the Alfred University Specialists Inc., of Thurmont. -
The White Rose in Cooperation With: Bayerische Landeszentrale Für Politische Bildungsarbeit the White Rose
The White Rose In cooperation with: Bayerische Landeszentrale für Politische Bildungsarbeit The White Rose The Student Resistance against Hitler Munich 1942/43 The Name 'White Rose' The Origin of the White Rose The Activities of the White Rose The Third Reich Young People in the Third Reich A City in the Third Reich Munich – Capital of the Movement Munich – Capital of German Art The University of Munich Orientations Willi Graf Professor Kurt Huber Hans Leipelt Christoph Probst Alexander Schmorell Hans Scholl Sophie Scholl Ulm Senior Year Eugen Grimminger Saarbrücken Group Falk Harnack 'Uncle Emil' Group Service at the Front in Russia The Leaflets of the White Rose NS Justice The Trials against the White Rose Epilogue 1 The Name Weiße Rose (White Rose) "To get back to my pamphlet 'Die Weiße Rose', I would like to answer the question 'Why did I give the leaflet this title and no other?' by explaining the following: The name 'Die Weiße Rose' was cho- sen arbitrarily. I proceeded from the assumption that powerful propaganda has to contain certain phrases which do not necessarily mean anything, which sound good, but which still stand for a programme. I may have chosen the name intuitively since at that time I was directly under the influence of the Span- ish romances 'Rosa Blanca' by Brentano. There is no connection with the 'White Rose' in English history." Hans Scholl, interrogation protocol of the Gestapo, 20.2.1943 The Origin of the White Rose The White Rose originated from individual friend- ships growing into circles of friends. Christoph Probst and Alexander Schmorell had been friends since their school days. -

Die Weiße Rose Kurt Hubers Letzte Tage Herausgegeben Von Wolfgang Huber
Die Weiße Rose Kurt Hubers letzte Tage herausgegeben von Wolfgang Huber Herbert Utz Verlag · München Satz, Layout sowie Umschlaggestaltung: Matthias Hoffmann. Umschlagillustration: Marlis Glaser. Die Künstlerin verfasste zu ihrem Bild den auf Seite 6 wiedergegebenen Text. Bibliographische Information der Deutschen Nationalbibliothek Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliographie; detaillierte bibliographische Daten sind im Internet über http://dnb.d-nb.de abrufbar. Dieses Werk ist urheberrechtlich geschützt. Die dadurch begründeten Rechte, insbesondere die der Überset- zung, des Nachdrucks, der Entnahme von Abbildungen, der Wiederga- be auf photomechani schem oder ähnlichem Wege und der Speicherung in Datenverarbeitungs anlagen bleiben – auch bei nur auszugsweiser Verwen- dung – vorbehalten. Copyright © Herbert Utz Verlag GmbH · 2018 ISBN 978-3-8316-4686-9 Printed in EU Herbert Utz Verlag GmbH, München 089–277791–00 · www.utzverlag.de Prof. Dr. Kurt Huber, geboren 1898 in Chur und aufgewachsen in Stuttgart. Das Zentrum seiner wissenschaftlichen Arbeit war die Musik: Wahrnehmung von Klängen, Tonpsychologie, Musikästhetik, allgemeine Ästhetik. Er lehrte an der Ludwig-Maximilians-Universität in München Psychologie, war Philosoph und Musikwissenschaftler, Mitglied der Weißen Rose; Hinrichtung in München-Sta- delheim zusammen mit Alexander Schmorell am 13. Juli 1943. Im Portait-Bild sind links verspielt-heitere Farbtupfer, Elemente, die an Töne erinnern können, Hinweise, die mit seiner Beschäftigung bereits in früheren Lebensjahren zu tun haben. Sie stehen für Klänge, Tonpsychologie; ein Hinweis auf seine Volkslied-Sammlung. Die hellgelb bis mittelgelben Farbfelder bringen das Klare, Lichte und Frohe zum Ausdruck, auch die Wärme in seiner Persön- lichkeit. Mit dem Grün wollte ich außer der Liebe zur Natur auch Bodenständig- keit veranschaulichen. -

Sophie Scholl
SOPHIE SCHOLL D I E L E T Z T E N T A G E DREHBUCH FRED BREINERSDORFER REGIE MARC ROTHEMUND eine Co-Produktion von neue Goldkind Film und Broth Film Fass. vom 1. Juni 2004 umformatiert in fdx VORSPANN Titel: SOPHIE SCHOLL die letzten Tage zugleich läuft im Off der Swingtitel Sugar Mit Billie Holliday WOHNUNG SCHOLL, KÜCHE, TAG/INNEN Gerade als die Vocalpassage von Billie Holliday beginnt: Sophie und GISELA SCHERTLING hören mit dem Radio (nicht Volksempfänger) Feindsender. Die BBC und über deren Sender auch DIE STIMME AMERIKAS spielten damals unter anderem populäre Swing-Titel. Diese Musik durfte in Deutschland niemand hören, deswegen kleben die beiden jungen Frauen fast mit den Ohren am Radio. Sophies Augen sprühen vor Begeisterung, und sie sieht, dass Gisela auch davon angesteckt ist. Sophie und Gisela trommeln auf dem Tisch. Sophie deutet auf Gisela und sagt: SOPHIE Das ist Billie Holliday, ich kenne die Stimme. GISELA Der Song ist neu! Toll! Sophie trommelt ein kurzes „Solo“. Dann ist Gisela an der Reihe. SOPHIE Hör mal das Saxophon° Ein Saxophonsolo. Sophie imitiert das Instrument, wie die Mädels heute Luftgitarre spielen. SOPHIE (CONT'D) Billie hat süsse Locken, Aber sie macht sie sich weg. GISELA Woher weißt du das? SOPHIE Hans hat eine englische Zeitung gehabt, da war ein Foto von ihr drin. Sophie schaut auf die Uhr und will das Radio abschalten. SOPHIE (CONT'D) Ich muss gehen. Tut mir leid, Gisela. Gisela hält sie zurück. 2. GISELA (bittend) Lass sie erst fertig singen. Sophie lacht, bleibt dran, trommelt wieder. SOPHIE Die Schwarzen sind einfach besser. -
Veranstaltungen Zum 100. Geburtstag Von Hans Scholl
100. Geburtstag Hans Scholl Crailsheimer Veranstaltungen 2018 Crailsheim. Alles, was Stadt braucht. Veranstaltungen „Helft den Gefangenen in Hitlers Kerkern!“ – Die Rote Hilfe Deutschlands im antifaschistischen Widerstand ab 1933 VERANSTALTER: WEISSE ROSE-ARBEITSKREIS CRAILSHEIM E. V. Vortrag von Silke Makowski (Hans-Litten-Archiv) Die Rote Hilfe Deutschlands (RHD) war schon in der Weimarer Republik eine große linke Solidaritätsorganisation mit etwa einer Million Mitglie- dern. Nach dem Verbot im Frühjahr 1933 arbeiteten viele RHD-AktivistIn- nen, darunter auch auffallend viele Frauen, in der Illegalität weiter – teils in losen Zusammenhängen, teils in gut vernetzten Gruppen. Die Rote Hilfe sammelte Spenden für die zahllosen KZ-Häftlinge und ihre Angehörigen, klärte mit Flugblättern und Zeitungen über den NS-Terror auf und brachte politisch Verfolgte heimlich über die Grenze ins Exil, wo die EmigrantInnen von den Auslandsbüros der RHD versorgt wurden. Selbst nach der offiziel- GEBURTSHAUS HANS SCHOLLS IN INGERSHEIM len Auflösung der Roten Hilfe Deutschlands im Jahr 1938 führten dezent- rale Strukturen die Unterstützung für die Verfolgten fort. Führungen durch das Scholl-Grimminger-Zimmer Donnerstag, 22. Februar 2018, 20 Uhr VERANSTALTER: WEISSE ROSE-ARBEITSKREIS CRAILSHEIM E. V. Ort: Geschwister-Scholl-Schule Ingersheim, Informationen in Wort, Bild und Ton über die Weiße Rose. Das Zimmer Scholl-Grimminger-Zimmer (Zugang Michael-Haf-Straße) beherbergt – einzigartig in Deutschland – authentische Möbel der Famili- en Scholl und Grimminger und baugleiche Schreib- und Druckmaschinen, wie sie von den Weiße-Rose-Mitgliedern zur Herstellung ihrer Flugblätter verwendet wurden. Besichtigt wird auch das eindrucksvolle Wandbild des Crailsheimer Malers Gerhard Frank zur Weißen Rose. Die Führung schließt mit einem Gang zum nahegelegenen Geburtshaus von Hans Scholl. -

Today's Martyrs
Today’s Martyrs Resources for understanding current Christian witness and martyrdom White Rose resistance milestones – 1941 through 1945 This timeline contains not only the events of the arrest and execution of the Christian members of the anti-Nazi White Rose resistance movement, but also relevant entries of Bishop Clemens August Graf von Galen (who had inspired them with his anti-Nazi homilies) and Helmut James Graf von Moltke (the jurist responsible for sending the White Rose leaflets to London) Sunday July 13, 1941 Germany: Munster Bishop Clemens August Graf von Galen (aged 63, co-authored the 1937 encyclical Mit Brennender Sorge, which attacked the philosophical underpinnings of the Nazi regime; UPDATE: delivered a homily attacking the Gestapo for human and civil rights violations that denied justice and created a climate of fear in the country) http://en.wikipedia.org/wiki/Clemens_August_Graf_von_Galen Sunday July 20, 1941 Germany: Munster Bishop Clemens August Graf von Galen (aged 63, UPDATE: delivered a homily stating that written protests against the government’s anti-Christian activities had failed, that clergy and religious were still being arrested and deported, and that the German people were being destroyed not by the Allies’ war activities but rather by negative forces within the country) http://en.wikipedia.org/wiki/Clemens_August_Graf_von_Galen Sunday August 3, 1941 Germany: Munster Bishop Clemens August Graf von Galen (aged 63, UPDATE: delivered a homily condemning the desecration of churches, the closing of convents -

Fragebogen Zur Ausstellung Mit Hintergrundinformationen Zu Den Antworten
Fragebogen zur Ausstellung mit Hintergrundinformationen zu den Antworten Bei der Auflösung der Fragen soll zu jeder richtigen Antwort auch geklärt werden, warum genau diese richtig ist und andere Lösungen falsch sind. Es können auch mehrere Antworten richtig sein oder alle falsch! 1, Welcher Zeitraum lag zwischen der Verhaftung von Hans und Sophie Scholl und dem Ende des Zweiten Weltkrieges? a, 1 Jahr und 2 Monate b, über 2 Jahre c, 5 Jahre 2, Welcher der genannten Akteure war kein Mitglied der Weißen Rose? a, Falk Harnack b, Prof. Kurt Huber c, Dietrich Bonhoeffer 3, Wie äußerte sich Jakob Schmid – damaliger Hausschlosser der Universität, der am 18. Februar 1943 durch sein Einschreiten die Verhaftung von Hans und Sophie Scholl verursachte hatte – nach dem Krieg zu seinem Verhalten? a, Beruft sich auf seine Pflicht b, Fühlt sich ungerecht behandelt c, Äußert tiefes Bedauern 4, Wie entstand nach heutiger Kenntnis der Name „Weiße Rose“? a, In Anlehnung an die Redewendung „Weiße Weste“ b, Eine weiße Rose war die Lieblingsblume von Hans Scholl und Alexander Schmorell. c, „Die Weiße Rose“ hieß ein verbotener Roman, den Hans Scholl gelesen hat. 5, Welches Ereignis fand zeitgleich zur Verhaftung der Geschwister Scholl am 18. Februar 1943 in Berlin statt? a, Aufruf des Propagandaministers Joseph Goebbels im Berliner Sportpalast zum „Totalen Krieg“ b, Eine landesweite Großversammlung der deutschen „Hitlerjugend“ c, Eine Massendemonstration von Oppositionellen gegen die NS Diktatur 6, Welches Mitglied zählt nicht zum „inneren Freundeskreis“ der Weißen Rose? a, Alexander Schmorell b, Prof. Kurt Huber c, Hans Conrad Leipelt Weiße Rose Fragebogen Ausstellung mit Hintergrundinformationen – 1 7, Auf welchen Gemeinsamkeiten beruhte ihre Freundschaft? a, Interesse für Philosophie und Literatur b, unangepasstes Verhalten c, Interesse an Militärflugzeugen 8. -

Weingarten KW 51 ID 105174
weingarten im Blick Amtsblatt und Bürgerzeitung der Stadt Weingarten WEIHNACHTSGRÜSSE Ausgabe 45/2015 Freitag, 18. Dezember 2015 OB Ewald: Diese Ausgabe erscheint auch online Den Aufschwung stabilisieren Liebe Bürgerinnen und Bürger der Stadt Weingarten, wieder geht ein ereignis- und arbeitsrei- dem Drehorgelkongress, um nur einige ches Jahr zu Ende. Ein Thema hat im Jahr zu nennen. Nochmals herzlichen Dank an 2015 alle anderen überlagert: die Ankunft die Organisatoren. von mehr als einer Million Flüchtlingen Nach mehreren Jahren des intensiven Spa- in Deutschland. Auch wir im Rathaus rens ist der Aufschwung nach zwei Jahren wurden von dieser Herausforderung über- mit deutlichen Haushaltsüberschüssen rascht. Wir haben uns dafür entschieden, wieder nach Weingarten zurückgekehrt. diese Aufgabe als Chance zu begreifen. Der städtische Haushalt entwickelt sich Hilfreich war, dass Weingarten bereits auch im Jahr 2016 positiv. Die finanzielle viel Erfahrung mit der Integration von Aufarbeitung der Krankenhauskrise wur- Menschen aus den osteuropäischen Län- de vor wenigen Tagen erfolgreich abge- dern hat. Gemeinsam und durch einen schlossen. Neue Investitionen sind wieder In dieser Ausgabe lesen Sie: phantastischen Einsatz von vielen ehren- planbar. Diese positive Entwicklung gilt amtlichen Helferinnen und Helfern haben es in den nächsten Jahren auszubauen und SEITE 1+2: wir diese Aufgabe bisher gut gemeistert zu stabilisieren. Alles Gute! und von vielen Seiten dafür Anerkennung Mir bleibt noch, allen Bürgerinnen und erfahren. Ich bin zuversichtlich, dass wir Bürgern für Ihr Engagement in unserer Weihnachten und das Neue Jahr ste- diese Herausforderung auch in Zukunft Stadt zu danken. Ich wünsche Ihnen und hen vor der Tür. Wir wünschen Ihnen gemeinsam bewältigen werden. Denn Ihren Familien einen schwungvollen Start das Beste und laden zur Neujahrsbe- viele der Flüchtlinge werden in Deutsch- ins Neue Jahr und davor ein besinnlich- grüßung ein. -

Eugen Grimminger - Biografie Erleben – Gestalten – Stärken
Eugen Grimminger - Biografie Erleben – Gestalten – Stärken Eugen-Grimminger-Schule Eugen Grimminger: knapp 94 Lebensjahre fallen in eine Epoche, in der die Geschichte Deutschlands und Europas zweimal in kollektive Katastrophen trieb, in dem Leben der Völker und Menschen in einen Strudel von Hass, Krieg und Vernichtung gerissen wurde. Verlust, Trauma, manchmal auch persönliche Schuld und Mitschuld stehen nicht selten als Endbilanz unter den Biografien der Menschen dieser Zeit. Es gab aber in dieser Epoche der Massenschlächtereien und Massenverbrechen, die das 20. Jahrhundert vielleicht einmal im historischen Rückblick darstellen wird, immer auch Möglichkeiten und Entwicklungen des Neuanfangs, der Selbstbehauptung, ja da wo es sein musste, teilweise auch der Verweigerung und des Widerstands. Es ist für den Historiker sehr schwer, aus der Analyse von Einzelbiografien Muster zu erarbeiten, die eine Aussage darüber erlauben, wann Menschen zu Personen des Widerstandes wurden. Welche soziale Personenstruktur oder Konditionierung muss vorliegen, damit jemand Widerstand leistet? Wann sind sie zum ersten Mal in Erscheinung getreten? Und wodurch sind sie gefördert worden? Oder war alles nur „Zufall“, entstanden aus einer Konstellation, die zunächst keinem Muster folgte, von der man nicht vorhersehen konnte, welche Konsequenzen sie für die einzelne Person haben sollte? Ich möchte mit Ihnen vor dem Hintergrund dieser mehr theoretischen Überlegungen in den nächsten beiden Schulstunden die Lebensstationen eines Mannes betrachten, dessen Biografie offensichtlich so bemerkenswert ist, dass nach ihm eine Schule in Crailsheim – ihre Schule – benannt wurde. Eugen Grimminger, 1892 in Crailsheim geboren, 1986 in Schanbach gestorben Eugen Grimminger wurde am 29. Juli 1892 in Crailsheim geboren. Er war das siebente und jüngste Kind von Franz Xaver Grimminger, der sieben Jahre zuvor als Lokomotivführer nach Crailsheim versetzt worden war. -

The White Rose Free
FREE THE WHITE ROSE PDF Amy Ewing | 336 pages | 09 Oct 2015 | HarperCollins | 9780062414755 | English | United States The White Rose - A Lesson in Dissent The date was February 22, Hans Scholl and his sister Sophie, along with their best friend, Christoph Probst, were scheduled to be executed by Nazi officials that afternoon. The prison guards were so impressed with the calm and bravery of the prisoners in the face of The White Rose death that they violated regulations by permitting them to meet together one The White Rose time. Hans, a medical student at the University of Munich, was Sophie, a student, was The White Rose, a medical student, was This is the story of The White Rose. It is a lesson in dissent. It is a tale of courage, of principle, of honor. Hans and Sophie Scholl were German teenagers in the s. Like other young Germans, The White Rose enthusiastically joined the Hitler Youth. They believed that Adolf Hitler was leading Germany and the German people back to greatness. Their parents were not so enthusiastic. Their father, Robert Scholl, told his children that Hitler and the Nazis were leading Germany down a road of destruction. It is already lost. This Hitler is God's scourge on mankind, and if the war doesn't end soon the Russians will be sitting in Berlin. They concluded that, in the name of freedom and the greater good of the German nation, Hitler and the Nazis were enslaving and destroying the German people. Most Germans took the traditional position, that once war breaks out, it is the duty of the The White Rose to support the troops by supporting the government. -
Denkstätte Widerstand Weingarten
Denkstättenkuratorium NS Dokumentation Oberschwaben Denkstättenkuratorium NS Dokumentation Oberschwaben Denkstätte Widerstand Weingarten Campus Weiße Rose Denkstättenkuratorium NSWidmungshäuser Dokumentation Oberschwaben Dank der Herausgeber Der Dank der Herausgeber dieser – vor allem dem regionalen und dem studentischen Widerstand gegen das NS-Unrechts- regime gewidmeten – Schrift gilt allen MitbürgerInnen, die gestern,heute und morgen Gestaltung und Pflege des Erin- nerns an die Opfer des Nationalsozialismus stellvertretend für unser Gemeinwesen geleistet haben und leisten: auch denen, die durch Text und Bild zu dieser Gedenkarbeit beigetragen haben. Unser Dank gilt auch allen, die sich des studentischen Widerstandes in der Epoche des Stalinismus in der SBZ und frühen DDR, dem über 70 junge Menschen und Demokraten zum Opfer fielen, ehrend erinnern. Der Dank gilt auch allen Sponsoren der Erinnerungsarbeit unseres Kuratoriums. Vor allem aber gedenken wir der Opfer. Wir vergessen sie nicht und handeln in ihrem Sinne, wenn wir gegen ungerechte Gewalt und für Demokratie eintreten. Denkstättenkuratorium NS-Dokumentation Oberschwaben www.dsk-nsdoku-oberschwaben.de [email protected] Studentenwerk Weiße Rose e.V. www.studentenwerk-weisserose.de [email protected] Grußwort des Ministerpräsidenten Winfried Kretschmann Die Lebensgeschichten der Menschen, die Widerstand leisteten und sich der menschenverachtenden, unterdrückerischen Diktatur der Nationalsozialisten widersetzten, könnten unterschiedlicher nicht sein. Sie stammten aus dem Arbeiter-, dem bürgerlichen, kirchlich- religiösen, militärischen oder politischen Milieu und doch ist ihnen eines gemein: Sie alle nahmen das Risiko in Kauf und brachten den Mut auf, dem nationalsozialistischen Unrechtsregime die Ge- folgschaft zu verweigern und sich zur Wehr zu setzen. Sie machten für viele in Bedrängnis geratene Mitmenschen den Unterschied aus gegenüber der schweigenden Mehrheit der Bevölkerung, gegenüber den überzeugten Anhängern, den Mitmachern und Mitläufern.