468 Oskar Farny
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-
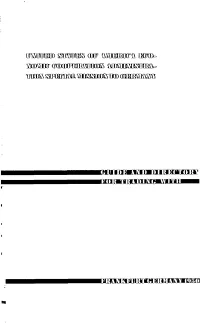
Llf Lli) $L-Rsijii.II(Ill WJIITIW&. If(Fl" -!31F Lhli Wref-1Iiq RI) (Awmw
Llf llI) $l-rsIjii.II(ill WJIITIW&. If(fl" - !31f LhLI WrEf-1iIQ RI) (aWMW LtJJIflWiIJUIJ1JXI1IJ NiIV[Efl?#iUflhl GUIDE AND DIRECTORY FOR TRADING WITH GERMANY ECONOMIC COOPERATION ADMINISTRATION -SPECIAL MISSION TO GERMANY FRANKFURT, JUNE 1950 Distributed by Office of Small Business, Economic Cooperation Administration, Wasbington 25, D.C. FOREWORD This guide is published under the auspices of the Small Bus iness Program of the'Economic Cooperation Administration. It is intended to assistAmerican business firms, particularlysmaller manufacturingand exporting enterprises,who wish to trade or expandtheirpresent tradingrelationswith Western Germany. This guide containsa summary of economic information reg ardingWestern Germany,togetherwith data concerningGerman trade practicesand regulations,particularlythose relatingto the import of goods from the United States financed withECA funds. At the end of the manual are appendicesshowing names and add resses of agencies in Western Germany concerned rodh foreign trade and tables of principalGerman exports and imports. The ECA Special Mission to Germany has endeavored to present useful, accurate,and reliableinformationin this manual. Nothing contained herein, however, should be construed to supersede or modify existing legislationor regulationsgoverning ECA procurement or trade with Western Germany. Sources of information contained herein, such as lists of Western German trade organizations,are believed to be complete, but the Mission assumes no responsibility for errors or omissions, or for the reliabilityof any agencies named. ADDENDUM The following information has been received -during the printing of this manual: 1. American businessmen interested in trading with Germany may consult the newly formed German-American Trade Promotion Company (Ge sellschaftzurFdrderungdesdeutsch-amerikanischen Handels), located at Schillerstrasse I, Frankfurt am Main, Germany. -

Heinrich Lübke (1894-1972)
Das Porträt HEINRICH LÜBKE (1894-1972) Von Rudolf Morsey I. Die in wenigen Artikeln unseres Grundgesetzes 1 fixierten Rechte und Pflichten des Bundespräsidenten hat Theodor Heuss zu Beginn seiner Amtszeit 1949 als dürres "Paragra phengespinst" bezeichnet; es müsse mit Leben - in den Worten von Heuss: "mit einem Men schentum" - gefüllt werden. 2 Diese Aufgabe haben die bisherigen sechs Amtsinhaber auf unterschiedliche Art und Weise erfüllt. Jeder von ihnen setzte andere, eigene Akzente, aber nur einer war bestrebt, von vornherein die Grenzen dieses Amtes zu sprengen: Heinrich Lübke. Entsprechende Ansätze in dieser Richtung riefen damals wie später Kritiker auf den Plan , Publizisten und Wissenschaftler. Jeder Staatsrechtslehrer hat sich irgendwann einmal auch über Amt und Kompetenzen , über "Sinn" und Grenzen des Verfassungsorgans Bundespräsi• dent geäußert. Das geschah überwiegend im Sinne einer Tradierung jenes Hindenburg Komplexes, der die Schöpfer des Grundgesetzes begleitet hatte. Sie vermachten 1949 der Bundesrepublik Deutschland eine stumpfe und keine "stählerne Spitze". Ein Staatsrechtier allerdings schätzte die Einflußmöglichkeiten des Staatsoberhaupts anders ein: Denn diese - so diagnostizierte er 1970 - "beruhen nur zum geringsten Teil auf verfassungsrechtlichen Befugnissen und sind noch seltener verfassungsrechtlich sanktioniert. Häufig beruhen sie einfach auf der selbstverständlichen Autorität seines Amtes, die er, wenn die Bundesversammlung bei seiner Wahl gut beraten ist, durch die Autorität einer integren und allgemein -

Zusammenfassung, Ergebnisseund Ausblick
VI. „Wir wollen der Sache einmal einen Auftrieb geben, wie es bisher. noch nie dagewesen ist"1. Zusammenfassung, Ergebnisse und Ausblick Die Gründung der CSU im Herbst 1945 vollzog sich im „Spannungsfeld zwischen Tradition und Neuorientierung"2. Die weitgehende territoriale Unversehrtheit und po- litisch-kulturelle Kontinuität Bayerns ermöglichte es den Frauen und Männern der er- sten Stunde, an tief verwurzelte Traditionen anzuknüpfen, gemeinsame Sprachregelun- gen zu finden und die verstreuten Zirkel und Zentren der Unionsgründung vergleichs- weise rasch zu einer landesweiten Organisation zusammenzufassen, sei es durch die Aktivierung persönlicher Kontakte aus der Zeit vor 1933 oder durch die Inanspruch- nahme der staatlich-bürokratischen Infrastruktur, die bereits wenige Monate nach Kriegsende wieder zu funktionieren begann. Daß die Einheit Bayerns größtenteils er- halten blieb, eröffnete den Gründern der CSU jedoch nicht nur viele Chancen, son- dern brachte auch unübersehbare Risiken mit sich. So drohte der in der NS-Zeit über- lagerte, aber nicht überwundene Gegensatz zwischen den Protestanten in Ober- und Mittelfranken und den Katholiken in Altbayern, Schwaben und Unterfranken ebenso wieder aufzubrechen wie der Gegensatz zwischen den radikal föderalistischen, ja teil- weise partikularistischen Kräften im Süden und Südosten Bayerns, die eine autonome bayerische Landespartei anstrebten, und der mehr gesamtdeutsch-national orientierten Bevölkerung in den Landesteilen, die erst zu Beginn des 19. Jahrhunderts an Bayern gefallen waren. Soweit die Menschen dort der CSU zuneigten, sahen sie in der neuen Partei weniger eine eigenständige Vertreterin bayerischer Interessen als einen Landes- verband der künftigen „Reichsunion". Schon im Herbst 1945 prallten die divergierenden Standpunkte hart aufeinander; sollte die „bayerische Frage" eher partikularistisch, föderalistisch oder zentralistisch gelöst werden? Hier erwies es sich als nahezu unmöglich, einen für alle Seiten akzepta- blen Kompromiß zu finden. -

60 Jahre DBV – Verbände Im DBV ■ Neue Generation Berufsstand Im Wandel Bauernpräsidenten ■ Nachgefragt
D_B_K_06_001_Titel.qxd 29.05.2008 13:19 Uhr Seite 1 6/08 DEUTSCHE BAUERN KORRESPONDENZ Monatsschrift des Deutschen Bauernverbandes dbk ■ DBV-Ehrenpräsident im Interview ■ Die Landesbauern - 60 Jahre DBV – verbände im DBV ■ Neue Generation Berufsstand im Wandel Bauernpräsidenten ■ Nachgefragt: Bewährte Allianzen PVSt • DP AG • Entgelt bezahlt Entgelt • AG DP • PVSt Deutscher Agrar-Verlag GmbH • Claire-Waldoff-Straße 7 • 10117 Berlin 10117 • 7 Claire-Waldoff-Straße • GmbH Agrar-Verlag Deutscher D_B_K_06_002_Inhalt.qxd 29.05.2008 13:18 Uhr Seite 2 Inhalt 60 Jahre DBV Klartext von DBV-Präsident Gerd Sonnleitner 3 Aktuelles Interview mit Dr. Schnieders und Dr. Born: Titelbild: Geschenk der Geschichte – Leistung der Organisation 4 Gilt für den Berufsstand wie für die Land- technik: Nicht stehen bleiben... Interview mit Ehrenpräsident Constantin Freiherr Heereman: Titelbild: John Deere 2008 „Was gut ist für die Bauern, ist gut für Deutschland“ 6 Foto Klartext: Dr. Anni Neu Fotos S.8-9: Frank Ossenbrink und Martin Bockhacker Die Landesbauernverbände im Deutschen Bauernverband 8 Der Deutsche Bauernverband und die Politik 10 Der Deutsche Bauernverband und die Märkte 12 Der Deutsche Bauernverband und die Gesellschaft 14 Der Deutsche Bauernverband und die Medien 16 Impressum: Eine neue Generation Bauernpräsidenten 18 Deutsche Bauern Korrespondenz Herausgeber: Deutscher Bauernverband e. V., Hinter den Kulissen: Zwingende Präsenz in Brüssel 21 Redaktion: Dr. Anni Neu (verantwortlich), Claire-Waldoff-Straße 7, 10117 Berlin Tel. (0 30) 3 19 04-242 Nachgefragt: Bewährte Allianzen 22 Fax: (0 30) 319 04-431 E-Mail: [email protected] Programm: Mitgliederversammlung des Deutschen Bauernverbandes 24 Verlag: Deutscher Agrar-Verlag GmbH, Claire-Waldoff-Straße 7, 10117 Berlin. -

Aktueller Begriff
Aktueller Begriff Die Ministerpräsidenten des Freistaates Bayern seit 1945 Gemäß der Verfassung des Freistaates Bayern steht an der Spitze der Staatsregierung der vom Landtag auf fünf Jahre gewählte Ministerpräsident. Er bestimmt u.a. die Richtlinien der Politik, er- nennt mit Zustimmung des Landtages die Staatsminister und die Staatssekretäre und vertritt Bay- ern nach außen. Seit 1945 gab es mit Fritz Schäffer (CSU), Wilhelm Hoegner (SPD), Hans Ehard (CSU), Hanns Seidel (CSU), Alfons Goppel (CSU), Franz Josef Strauß (CSU), Max Streibl (CSU) und Edmund Stoiber (CSU) bisher acht Ministerpräsidenten des Freistaates Bayern, davon beklei- deten Wilhelm Hoegner (SPD) und Hans Ehard (CSU) das Amt zweimal. Mit Ausnahme von Wil- helm Hoegner (SPD) gehörten alle bisherigen bayerischen Ministerpräsidenten der CSU an. Fritz Schäffer war bei Amtsantritt zwar parteilos, gehörte aber 1945/46 zu den Mitbegründern der CSU. Seit dem Jahr 1962, als die CSU erstmals nach 1946 die absolute Mehrheit der Mandate bei baye- rischen Landtagswahlen gewann, regieren alle – stets von der CSU gestellten – Ministerpräsiden- ten mit absoluten Mehrheiten. Seit den Landtagswahlen 1970 erreichte die CSU zudem fortwäh- rend auch die absolute Mehrheit der abgegeben Stimmen bei allen Landtagswahlen. Tabelle: Die bayerischen Ministerpräsidenten seit 1945 Amtszeit Name des Ministerpräsidenten Partei Lebensdaten 1945 Dr. Fritz Schäffer CSU 12.05.1888-29.03.1967 1945-1946 Dr. Wilhelm Hoegner SPD 23.09.1887-05.03.1980 1946-1954 Dr. Hans Ehard CSU 10.11.1887-18.10.1980 1954-1957 Dr. Wilhelm Hoegner SPD 23.09.1887-05.03.1980 1957-1960 Dr. Hanns Seidel CSU 12.10.1901-05.08.1961 1960-1962 Dr. -

Wir Haben Etwas Bewegt«
Ilse Brusis, Inge Wettig-Danielmeier (Hg.) »Wir haben etwas bewegt« Der Seniorenrat der Sozialdemokratischen Partei Deutschlands 110 Lebensläufe von Sozialdemokratinnen und Sozialdemokraten Mit einem Essay von Helga Grebing Unter Mitarbeit von Ada Brandes, Daniela Münkel, Dorothea Steffen, Andre Förster, Andreas Schlotmann und Klaus Wettig vorwärts buch 8 Vorwort 95 Friedrich Halstenberg 98 Fritz Heine 10 Herkunft und Mandat TOI Hermann Heinemann 103 Heinrich Hemsath Lebensläufe 105 Hermann Herberts 17 Luise Albertz 107 Luise Herklotz 20 Karl Anders 110 Albert Höft 2.3 Walter Arendt 112. Wilhelm Hoegner 2,5 Fritz Baade 115 Antje Huber 2.8 Walter Behrendt 117 Wilhelm Käber 30 Otto Bennemann 119 Wilhelm Kaisen 33 Christine Bergmann 122 Hellmut Kalbitzer 36 Willi Birkelbach 12.4 Ella Kay 39 Paul Bleiß iz6 Irma Keilhack 41 Karl Branner 12,9 Dietrich Keuning 43 Heinrich Braune 131 Heinz Kluncker 46 Ernst Breit 134 Harald Koch 49 Anke Brunn 136 Heinz Kreutzmann 52. Ilse Brusis 138 Rolf Krumsiek 54 Georg Karl Buch 141 Alfred Kubel 57 Hermann Buschfort 144 Heinz Kühn 59 Karl Buschmann 147 Adolph Kummernuss 60 Kurt Conrad 150 Georg Kurlbaum 6x Willy Dehnkamp +S2- Lucie Kurlbaum-Beyer 64 Georg Diederichs 154 Erwin Lange 67 Alfred Dobbert 156 Georg Leber 69 Adolf Ehlers 160 Lotte Lemke 71 Herbert Ehrenberg 162. Gerda Linde 74 Ilse Elsner 164 Elly Linden 76 Käthe Erler 166 Eugen Loderer 78 Josef Felder 168 Ernst Gottfried Mahrenholz 82. Rudolf Freidhof 171 Günter Markscheffel 84 Anke Fuchs !73 Anke Martiny 87 Wilhelm Gefeller 176 Franz Marx 89 Bruno Gleitze 178 Ulrike Mascher 9z Heinrich Gutermuth I8T Hedwig Meermann 183 Heidrun Merk 272 Tassilo Tröscher 185 Ludwig Metzger 274 Karl Vittinghoff 187 Alex Möller 276 Herbert Weichmann 190 John van Nes Ziegler 279 Rolf Wernstedt 192 Gerhard Neuenkirch 282 Karl Wittrock 194 Franz Neumann 284 Jeanette Wolff 197 Walther G. -

Download [PDF 8,7
„Das schönste Amt der Welt“ Die bayerischen Ministerpräsidenten von 1945 bis 1993 Staatliche Archive Bayerns Kleine Ausstellungen Nr. 13 „Das schönste Amt der Welt“ Die bayerischen Ministerpräsidenten von 1945 bis 1993 Eine Ausstellung des Bayerischen Hauptstaatsarchivs und des Archivs für Christlich-Soziale Politik der Hanns-Seidel-Stiftung mit Unterstützung der Historischen Kommission bei der Bayerischen Akademie der Wissenschaften München 1999 Staatliche Archive Bayerns – Kleine Ausstellungen hrsg. von der Generaldirektion der Staatlichen Archive Bayerns Inhalt Schriftleitung: Albrecht Liess Nr. 13: „Das schönste Amt der Welt.“ Die bayerischen Ministerpräsidenten von 1945 bis 1993. Zum Geleit................................................ 6 Eine Ausstellung des Bayerischen Hauptstaatsarchivs und des Archivs Leihgeber................................................ 11 für Christlich-Soziale Politik der Hanns-Seidel-Stiftung mit Unterstüt- zung der Historischen Kommission bei der Bayerischen Akademie der Ferdinand Kramer Wissenschaften Zur Geschichte des Amtes des Bayerischen Ministerpräsidenten 12 Katalog Karl-Ulrich Gelberg und Michael Stephan Ministerpräsident Fritz Schäffer (28. Mai bis 28. September 1945) .................................. 31 Karl-Ulrich Gelberg und Michael Stephan Bayerisches Hauptstaatsarchiv, 15. Dezember 1999 – 31. Januar 2000 Ministerpräsident Wilhelm Hoegner (28. September 1945 bis 21. Dezember 1946 und 14. Dezember 1954 bis 16. Oktober 1957) ............................................ 44 Karl-Ulrich Gelberg -

Das Staatsoberhaupt Bayerns 953
Einigkeit und Recht und Freiheit Festschrift für Karl Carstens zum 70. Geburtstag am 14. Dezember 1984 Herausgegeben von Bodo Börner Hermann Jahrreiß Klaus Stern Band 2 Staatsrecht Carl Heymanns Verlag KG • Köln • Berlin • Bonn • München U n IV (TJ r «511A ta München 1984 ISBN 3-452-19883-9 Gesetzt und gedruckt im Druckhaus Thiele & Schwarz GmbH, Kassel Gebunden von der Großbuchbinderei Ludwig Fleischmann, Fulda Inhalt BAND 1 Introductio et laudatio 1 Hermann JAHRREISS Karl Carstens und das Amt des Bundespräsidenten 5 Klaus STERN EUROPARECHT Europäische Grundrechtsperspektiven 17 Kai BAHLMANN Handlungspflichten und Zustandssicherung im Europäischen Gemein• schaftsrecht 43 Albert BLECKMANN Subventionen-Unrichtiges Europarecht? 63 Bodo BÖRNER Die Europäische Gemeinschaft und das Recht 81 Claus-Dieter EHLERMANN Zur direkten innerstaatlichen Wirkung der EG-Richtlinien: Ein Beispiel richterlicher Rechtsfortbildung auf der Basis gemeinsamer Rechtsgrundsätze 95 Ulrich EVERLING Haushaltsbefugnisse des Parlaments und Rechtsschutz 115 Hans-Joachim GLAESNER Gemeinschaftsgewalt, Besatzungsgewalt und deutsche Staatsgewalt in Berlin 125 Eberhard GRABITZ V Das Europäische Recht und die Versicherungswirtschaft 139 Ulrich HÜBNER Utopisches im Parlaments-Entwurf einer Europäischen Union 155 Hans Peter IPSEN Zwei Geschwindigkeiten. Zu den Abstimmungsergebnissen im Europäischen Parlament über den Entwurf eines Vertrages zur Gründung einer Europäi• schen Union 169 Carl Otto LENZ Die Finanzierungsgrenzen der Europäischen Gemeinschaften und ihre Erweiterung -

Rethinking the Rise of the German Constitutional Court: from Anti
Rethinking the Rise of the German Constitutional Court: From Anti-Nazism to Value Formalism Michaela Hailbronner∗ The German Constitutional Court, we often hear, draws its considerable strength from the reaction to the German Nazi past: Because the Nazis abused rights and had been elected by the people, the argument runs, it was necessary to create a strong Court to guard these rights in the future. This contribution proceeds in two steps. First, it sets out to show that this “Nazi thesis” provides an inadequate explanation for the Court’s authority and rise. The German framers did not envisage a strong, rights-protecting, counter-majoritarian court. Even where the Nazi thesis does find some application during the transitional 1950s and 1960s, its role is more complicated and limited than its proponents assume. In the second part, this paper offers an alternative way of making sense of the German Court’s rise to power. Against a comparative background, I argue that the German Court’s success is best understood as a combination between a (weak) version of transformative constitutionalism and a hierarchical legal culture with a strong emphasis on a scientific conception of law and expertise. The Court could tap into the resources of legitimacy available in this culture by formalizing its early transformative decisions, producing its own particular style, ‘Value Formalism’. Value Formalism, however, comes with costs, most notably an interpretive monopoly of lawyers shutting out other voices from constitutional interpretation. ∗ Research Fellow at the Max Planck Institute for Comparative Public Law and Public International Law, LL.M. and J.S.D. -

36. 22. 1. 1962: Fraktionsvorstandssitzung 36A.1
CDU/CSU – 04. WP Fraktionsvorstandssitzung: 22. 01. 1962 36. 22. 1. 1962: Fraktionsvorstandssitzung ACDP, VIII-001-1503/4. Zeit: 16.00 Uhr–19.30 Uhr. Anwesend: Dr. von Brentano, Arndgen, Dr. Dollinger, Schmücker, Struve, Dr. Heck, Wacher; Dr. Barzel, Bauer, Bauknecht, Brand, Burgemei- ster, Etzel, Hoogen, Dr. Kopf, Majonica, Niederalt, Dr. Pferdmenges, Dr. Pflaumbaum, Frau Dr. Rehling, Dr. Schmidt, Schütz, Dr. Vogel, Dr. Weber (Koblenz); Regierung: ohne Vertreter; Gäste: Dr. Gerstenmaier, Dr. Jaeger, Dr. Kraske, Frau Dr. Weber. 1 36 a. 1. Tagesordnung des Plenums dieser Woche a) Regierungserklärung EWG (ohne Aussprache)2, b) Große Anfrage3 und Antrag der Fraktion betr. Radioaktivität4, c) SPD-Antrag betr. Mindesturlaub.5 2. Tagesordnung des Plenums nächster Woche Aussprache EWG.6 3. Kooptationsvorschläge für den Vorstand siehe Anlagen.7 1 Maschinenschriftliche Anmerkungen zur Tagesordnung mit drei Anlagen; alle diese Dokumente tragen den Vermerk »Bonn, den 22. 1. 1962«. 2 Regierungserklärung zur gemeinsamen Agrarpolitik in der EWG vom 24. 1. 1962. 3 Große SPD-Anfrage betr. Schutz der Gesundheit gegen radioaktive Strahlung (Drs. IV/26 vom 21. 11. 1961). 4 CDU/CSU-FDP-Antrag betr. Radioaktivität der Luft und des Regens (Drs. IV/15 vom 14. 11. 1961). 5 SPD-Gesetzentwurf über Mindesturlaub für Arbeitnehmer – Bundesurlaubsgesetz – (Drs. IV/142 vom 23. 1. 1962). 6 Regierungserklärung zur gemeinsamen Agrarpolitik in der EWG vom 24. 1. 1962. 7 Anlage 1: Vorstand der CDU/CSU-Bundestagsfraktion Fraktionsvorsitzender: Heinrich von Brentano Stellvertretende -

Förderalistische Politik in Der CDU/CSU. Die
WOLFGANG BENZ FÖDERALISTISCHE POLITIK IN DER CDU/CSU DIE VERFASSUNGSDISKUSSION IM „ELLWANGER KREIS" 1947/48 Nach dem Zusammenbruch des wilhelminischen Reichs beschäftigte sich im De zember 1918 eine Expertenkommission unter dem Vorsitz von Hugo Preuß in Berlin mit dem Entwurf einer neuen Reichsverfassung. Wenig später setzten sich in Stuttgart die Regierungschefs und Minister der süddeutschen Länder zu sammen, um ihrerseits zu beraten, wie das Schlimmste zu verhindern sei, nämlich eine zentralistische Verfassungsordnung des Deutschen Reiches, auf die die Ber liner Bemühungen ihrer Meinung nach zwangsläufig hinauslaufen würden. Die Entstehungsgeschichte der Weimarer Verfassung stand dann auch im Zeichen des Widerstreits zwischen Föderalismus und Zentralismus1. Auf der einen Seite wurde mit dem Prinzip der Volkssouveränität argumentiert, mit Blick auf eine verfas sunggebende Nationalversammlung, auf ein möglichst omnipotentes zentrales Parlament und auf eine starke Reichsexekutive, auf der Gegenseite wurde der Grundsatz der Eigenstaatlichkeit der Länder zäh verteidigt: Dem Gesamtstaat sollten nur die notwendigsten Souveränitätsrechte für Legislative und Exekutive übertragen werden. Diese Antagonie zeigte sich während der ganzen Weimarer Zeit am deutlichsten in den Streitigkeiten zwischen Bayern und dem Reich. Zieht man jedoch ab, was dem Konto des partikularen Egozentrismus der bayerischen Regierungen — von Eisner bis Held — speziell anzulasten war, so blieb ein beacht licher Grundsatz-Dissens zwischen der föderal-gouvernementalistischen -

Vierteljahrshefte Für Zeitgeschichte Jahrgang 58(2010) Heft 2
161 Der Deutsche Bauernverband gilt als erzkonservativ, stur interessenorientiert und europaskeptisch – als altmodische Lobby mit Stallgeruch. Die Wirklichkeit sieht anders aus, wie der in Florenz lehrende Historiker Kiran Klaus Patel in einem zu- packenden Essay zu zeigen vermag. Der DBV entpuppte sich – trotz mancher derber Anleihen beim rechten Lager – rasch als Stütze der Bonner Demokratie, und er ver- stand es früher und besser als andere Interessenverbände, die Chancen zu nutzen, die Brüssel und der gemeinsame Agrarmarkt boten. ■■■■ Kiran Klaus Patel Der Deutsche Bauernverband 1945 bis 1990 Vom Gestus des Unbedingten zur Rettung durch Europa Der Deutsche Bauernverband (DBV) war eine der wichtigsten Interessenver- tretungen in der „alten“ Bundesrepublik. Auch in jüngster Zeit haben ihn die Konkurrenz mit dem Bundesverband Deutscher Milchviehhalter sowie globali- sierungsbedingte Agrarpreisschwankungen immer wieder in die Schlagzeilen ge- bracht. Unter Historikern gibt es allerdings bislang keinen Konsens über seine Rolle. Viele Gesamtdarstellungen zur westdeutschen Geschichte nach 1945 über- gehen ihn einfach oder streifen ihn lediglich in einem summarischen Abgesang auf die ländliche Welt1. Ein Teil der Literatur argumentiert demgegenüber, der Verband habe zwar geholfen, die Demokratie zu stabilisieren, agrarpolitische In- teressen habe er aber nur begrenzt durchsetzen können. Christoph Kleßmann etwa warnt davor, die „tatsächlichen und dauerhaften Erfolge der Agrarlobby“ zu überschätzen2. Dagegen konnte der Verband laut Gesine Gerhard agrarpolitisch großen Einfl uss nehmen. Die Demokratie habe er jedoch nicht bejaht, zumindest in den 1950er Jahren habe er sich zur „Untermauerung seiner Ziele […] traditio- neller und rechtsradikaler Bauerntumsideologien“ bedient3. Der vorliegende Beitrag bewertet – unter Einbeziehung bislang ungenutzter Archivquellen – die Geschichte des Verbandes neu und ordnet sie zugleich in die längere Geschichte agrarischer Interessenvertretung sowie in den europäischen Kontext ein.