700 Jahre Kaiser Karl IV
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

Geothermal Prospection in NE Bavaria
Geo Zentrum 77. Jahrestagung der DGG 27.-30. März 2017 in Potsdam Nordbayern Geothermal Prospection in NE Bavaria: 1 GeoZentrum Nordbayern Crustal heat supply by sub-sediment Variscan granites in the Franconian basin? FAU Erlangen-Nürnberg *[email protected] 1 1 1 1 1 2 2 Schaarschmidt, A. *, de Wall, H. , Dietl, C. , Scharfenberg, L. , Kämmlein, M. , Gabriel, G. Leibniz Institute for Applied Geophysics, Hannover Bouguer-Anomaly Introduction with interpretation Late-Variscan granites of different petrogenesis, composition, and age constitute main parts of the Variscan crust in Northern Bavaria. In recent years granites have gained attention for geothermal prospection. Enhanced thermal gradients can be realized, when granitic terrains are covered by rocks with low thermal conductivity which can act as barriers for heat transfer (Sandiford et al. 1998). The geothermal potential of such buried granites is primarily a matter of composition and related heat production of the granitoid and the volume of the magmatic body. The depth of such granitic bodies is critical for a reasonable economic exploration. In the Franconian foreland of exposed Variscan crust in N Bavaria, distinct gravity lows are indicated in the map of Bouguer anomalies of Germany (Gabriel et al. 2010). Judging from the geological context it is likely that the Variscan granitic terrain continues into the basement of the western foreland. The basement is buried under a cover of Permo- Mesozoic sediments (Franconian Basin). Sediments and underlying Saxothuringian basement (at depth > 1342 m) have been recovered in a 1390 m deep drilling located at the western margin of the most dominant gravity low (Obernsees 1) and subsequent borehole measurements have recorded an increased geothermal gradient of 3.8 °C/100 m. -

Updateliste Revision: 1.0 Landkreis Neustadt/WN Seite 1 Von 5
Info-Dokument Updateliste Revision: 1.0 Landkreis Neustadt/WN Seite 1 von 5 Datum Uhrzeit Ort Feuerwehr 15:00 Hagendorf 15:00 Reinhardsrieth 15:20 Pfrentsch 13.02.2019 Gerätehaus Waidhaus 15:20 Reichenau 15:40 FL NEW Land 2/2 (Schmidt Matthias) 16:00 Waidhaus 18:30 Eslarn 13.02.2019 Gerätehaus Eslarn 18:30 FL NEW Land 2/1 (Kleber Thomas) 15:00 Großenschwand 15:00 Kleinschwand 14.02.2019 15:20 Gerätehaus Tännesberg Woppenrieth 15:20 Tännesberg 15:20 FL NEW Land 2/3 (Demleitner Christian) 17:30 Burgtreswitz 17:50 Gaisheim 18:10 Etzgersrieth 18:10 Gröbenstädt 18:30 Heumaden 14.02.2019 Gerätehaus Moosbach 18:30 Rückersrieth 18:50 Saubersrieth 18:50 Ödpielmannsberg 19:10 Tröbes 19:10 Moosbach 15:00 Döllnitz b. Leuchtenberg 15:20 Lerau 15.02.2019 15:20 Gerätehaus Leuchtenberg Wittschau/Preppach 16:00 Michldorf 16:40 Leuchtenberg Erstellt durch: R. Höcht Freigabe durch: S Schieder am: 11.01.2019 am: 11.01.2019 Info-Dokument Updateliste Revision: 1.0 Landkreis Neustadt/WN Seite 2 von 5 15:00 Altenstadt/VOH 15:20 Böhmischbruck 15:40 Kaimling 16:00 Oberlind 19.02.2019 Gerätehaus Vohenstrauß 16:20 Roggenstein 16:40 Waldau 17:00 FL NEW Land 2 (Weig Martin) 17:20 Vohenstrauß 15:00 Lennesrieth 15:20 Oberbernrieth 20.02.2019 Gerätehaus Waldthurn 15:20 Spielberg 15:40 Waldthurn 17:30 Burkhardsrieth 17:50 Lohma 17:50 Spielhof 20.02.2019 Gerätehaus Pleystein 18:10 Miesbrunn 18:10 Vöslesrieth 18:30 Pleystein 15:00 Flossenbürg 15:40 Bergnetsreuth 21.02.2019 Gerätehaus Floß 16:00 Altenhammer 16:20 Floß 18:00 Waldkirch 18:20 Brünst 21.02.2019 18:40 Gerätehaus Georgenberg Neudorf b. -
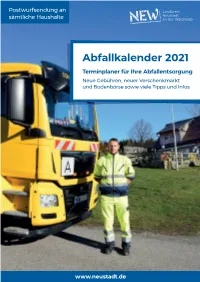
Abfallkalender 2021 Terminplaner Für Ihre Abfallentsorgung Neue Gebühren, Neuer Verschenkmarkt Und Bodenbörse Sowie Viele Tipps Und Infos
Postwurfsendung an sämtliche Haushalte Abfallkalender 2021 Terminplaner für Ihre Abfallentsorgung Neue Gebühren, neuer Verschenkmarkt und Bodenbörse sowie viele Tipps und Infos www.neustadt.de 1 Neustadt a. d. Waldnaab, im November 2020 Inhalte Branchenverzeichnis von A bis Z Hier finden Sie auf den genannten Seiten Inserate von Betrieben der Entsorgungsbranche. Diese Unternehmen tragen zur Realisierung des Abfallkalenders bei. wie in den vergangenen Jahren abschließen können. Ge- regelte, professionell organisierte und umweltgerechte Entsorgung kostet nun einmal auch zunehmend Geld! Wir liegen aber mit den Gebühren im Vergleich zu Thema Seite Thema Seite anderen Gebietskörperschaften immer noch auf einem moderaten Niveau. Zudem ist die Entsorgung eben nicht Abfall-ABC 20-29 Abbrüche 8 oben , 8 unten, 14u., 32 mehr ein einfaches Abholen und Ablagern, sondern eine Abfall-App 20 Akten- und Datenvernichtung 32 moderne Kreislaufwirtschaft, bei der die Abfälle je nach Anbieterverzeichnis 2 Altöl 12, 32 Verwertungsmöglichkeiten und Gefährlichkeit zu entsor- Ansprechpartner 5 Altreifen 7 u., 12, 14 u., 32 gen sind. Asbestabbau 8 o. Bauschutt 8 Auffüllmaterial 8 o., 14 u., 32 Ein gutes Beispiel ist das Müllkraftwerk Schwandorf, das Biotonne 36-37 Autobatterieentsorgung 5, 12, 32 Blaue Papiertonne 4, 33 seit über 38 Jahren in Betrieb ist und aus dem Rest- Autoteile (gebrauchte) 5, 32 müll des Verbandsgebietes jährlich 170.000 MWh Strom Bodenbörse 17 Autoverwertung 5, 14 u., 32 Branchenverzeichnis 2 erzeugt. Damit lassen sich über 83.000 Menschen mit Bauschutt 7 u., 8 o., 8 u., 12, 14 u., 32 Elektrizität versorgen. Mit dieser Energienutzung werden Deponie 8 Blaue Papiertonne 4, 12, 32, 33 jährlich 139 Millionen Liter Öl eingespart, was Treibhaus- Duale Systeme 31-32 gasemissionen von 8,25 Millionen Tonnen CO2-Äquiva- Containerdienste 7 u., 8 o., 11, 12, 14 o., 14 u., 32 Elektroschrott 18-19 lenten im Zeitraum von 1982 bis 2018 entspricht. -

Willibald Pirckheimer and the Nuernberg City Council
This dissertation has been microfilmed exactly as received 68-3070 SPIELVOGEL, Jackson Joseph, 1939- WILLIBALD PIRCKHEIMER AND THE NUERNBERG CITY COUNCIL. The Ohio State University, Ph.D., 1967 History, modern University Microfilms, Inc., Ann Arbor, Michigan ©Copyright by Jackson Joseph. Spielvogel 1968 WILLIBALD PIRCKHEIMER AND THE NUERNBERG CITY COUNCIL DISSERTATION Presented in Partial Fulfillment of the Requirements for the Degree Doctor of Philosophy in the Graduate School of The Ohio State University by Jackson Joseph Spielvogel, B.A., M.A. The Ohio State University 1967 Approved hy / L ( . Adtiser Department of History ACOONLEDGMENTS The research for this dissertation was completed in 1965-1966 while I was a Fulbright Graduate Fellow in Ger many. I would like to acknowledge my appreciation to the staffs of the Nuernberg Oity Library, the Nuernberg City Archives, and the Bavarian State Archives in Nuernberg. Especially deserving of gratitude are Dr. Fritz Schnelbfigl, Director of the latter institution, for his advice and helpfulness, and Marianne Alt for the multitude of services rendered. I am very grateful to Dr. Josef Pfanner, who greatly lightened the task of examining the Pirckheimer- papiere by making available to me Emil Reicke's notes and numerous copies of those papers. I am deeply indebted to ray adviser, Professor Harold J. Grimm, who first inspired in me an interest in Pirck- heimer and the "herrliche Stadt" Nuernberg, and who pro vided constant assistance in every aspect of this work. To my wife, who assisted me in innumerable ways, I owe a lasting debt of gratitude. ii VITA March 10, 1939 Born-Ellwood City, Pennsylvania 1 9 6 1 ...... -

German Historical Institute London Bulletin Vol 34 (2012), No. 2
German Historical Institute London Bulletin Volume XXXIV, No. 2 November 2012 CONTENTS Articles Artistic Encounters: British Perspectives on Bavaria and Saxony in the Vormärz (Hannelore Putz) 3 ‘De-Industrialization’: A Research Project on the Societal History of Economic Change in Britain (1970–90) (Jörg Arnold) 34 Review Article The Hidden Transcript: The Deformation of the Self in Germany’s Dictatorial Regimes (Bernd Weisbrod) 61 Book Reviews David Rollason, Conrad Leyser, and Hannah Williams (eds.), England and the Continent in the Tenth Century: Studies in Honour of Wilhelm Levison (1876–1947) (Benjamin Pohl) 73 Craig Koslofsky, Evening’s Empire: A History of the Night in Early Modern Europe (Andreas Bähr) 78 Jerrold Seigel, Modernity and Bourgeois Life: Society, Politics, and Culture in England, France and Germany since 1750 (Andreas Fahrmeir) 84 Frank Lorenz Müller, Our Fritz: Emperor Frederick III and the Pol itical Culture of Imperial Germany (Martin Kohlrausch) 89 (cont.) Contents Anne Friedrichs, Das Empire als Aufgabe des Historikers. Historio graphie in imperialen Nationalstaaten: Großbritannien und Frankreich 1919–1968 (Roger Chickering) 94 J. A. S. Grenville, The Jews and Germans of Hamburg: The De - struc tion of a Civilization 1790–1945 (Moshe Zimmermann) 97 Ian Kershaw, The End: Hitler’s Germany, 1944–45 (Lothar Kettenacker) 103 Antje Robrecht, ‘Diplomaten in Hemdsärmeln?’ Auslands korre - s pon denten als Akteure in den deutsch-britischen Beziehungen 1945–1962 (Christian Haase) 107 Conference Reports Diverging Paths? -

Seiner Exzellenz Herrn Frank-Walter STEINMEIER Bundesminister Des Auswärtigen Werderscher Markt 1 D - 10117 Berlin
EUROPEAN COMMISSION Brussels, 3.11.2016 C(2016) 6915 final PUBLIC VERSION This document is made available for information purposes only. Subject: State aid case no. SA.46343 (2016/N) – Germany – Amendment to the regional aid map for Germany (2014-2020) for the period 2017-2020 Sir, 1. PROCEDURE (1) On 28 June 2013 the Commission adopted the Guidelines on Regional State Aid for 2014-2020 (hereinafter "RAG")1. On the basis of the RAG the German authorities notified their regional aid map, which was approved by the Commission on 11 March 2014 for the period from 1 July 2014 until 31 December 20202 (hereinafter "regional aid map approved in 2014"). (2) Pursuant to section 5.6.2 of the RAG, Member States may notify amendments to their regional aid map in the context of the mid-term review in 2016. The amended regional aid maps will be in force from 1 January 2017 until 31 December 2020. 1 OJ C 209, 23.07.2013, p.1 2 Decision for State aid case State aid No. SA.37423 (2013/N) – Germany - Regional aid map 2014-2020, OJ C 280, 22.08.2014, Seiner Exzellenz Herrn Frank-Walter STEINMEIER Bundesminister des Auswärtigen Werderscher Markt 1 D - 10117 Berlin Commission européenne/Europese Commissie, 1049 Bruxelles/Brussel, BELGIQUE/BELGIË - Tel. +32 22991111 (3) The Commission published on 25 June 2016 a Communication amending Annex I to the 3 RAG (hereinafter, the "Communication") . (4) A Member State may, within the limit of its adjusted specific allocation for ‘c’ areas mentioned in paragraph 10 of the Communication, amend the list of non-predefined ‘c’ areas contained in its regional aid map for the period from 1 January 2017 to 31 December 2020. -

Radiogenic Heat Production of Variscan Granites from the Western Bohemian Massif, Germany
Journal of Geosciences, 64 (2019), 251–269 DOI: 10.3190/jgeosci.293 Original paper Radiogenic heat production of Variscan granites from the Western Bohemian Massif, Germany Lars SCHARFENBERG1,2*, Anette REGELOUS1, Helga DE WALL1 1 GeoZentrum Nordbayern, Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg, Schlossgarten 5, D-91054 Erlangen, Germany 2 Present address: Department für Geodynamik und Sedimentologie, Department für Lithosphärenforschung, Universität Wien, Althanstraße 14, A-1190 Vienna, Austria; [email protected] * Corresponding author Much of the Mid-European basement has been consolidated during the Variscan Orogeny and includes large volumes of granitic intrusions. Gamma radiation spectroscopic measurements in three study areas along the western margin of the Bohemian Massif give a record of radiogenic element concentrations in the Variscan granites. Most intrusions of the Fichtelgebirge (except for the Tin Granite) and intrusive complexes in the Bavarian Forest show Th/U ratios exceeding unity, most likely related to abundance of monazite. In contrast, some of the Oberpfalz granites located near the Saxo- thuringian–Moldanubian boundary (Flossenbürg, Steinwald and Friedenfels types) are characterized by higher uranium concentrations and thus Th/U < 1. The low Th/U ratios here are in agreement with a possible U mobilisation along the Saxothuringian–Moldanubian contact zone observed in previous studies. Heat production rates of granites in the three study areas vary between 3.9 and 8.9 µW/m3, with a mean of 4.9 µW/m3. This classifies the intrusions as moderate- to high-heat-producing granites. Considering the huge volume of granitic bodies in the Variscan crust of the Bohemian Massif, the contribution of in situ radiogenic heat production had to have a major impact and should be considered in further thermal modeling. -

251 Projektblätter
Projektblätter 251 Weiherhammer I Integriertes Ortsentwicklungskonzept Neugestaltung „Industriewanderweg“ den Beckenweiher ist nicht möglich. und Beschilderung Konzept und Präsentation Länge bisher ca. 1,7 km Ein neues, interessantes, informatives und überra- Das Angebot an klassischen Lehrpfaden im Allgemei- schendes Darstellungskonzept für den Lehrpfad und nen mit Infotafeln ist groß. Sie üben nur noch mäßigen die Beschilderung, die auch im Ort präsent sein soll, ist Reiz auf Urlaubsgäste aus und sind deswegen mit gefragt. Besonderheiten auszustatten um für Urlaubsgäste inte- Das Konzept und die Präsentation ist durch ein professi- ressant zu sein. onelles Büro für Kommunikation und Design und/ oder Künstlern zu erstellen. Status quo Ein anschauliches Beispiel bietet der Industrielehrpfad Der Lehrwanderweg am Beckenweiher und am Brand- Kaolinrevier - Hirschau-Schnaittach (www.geopark- nerkanal stellt Themen aus den Bereichen Ortsge- kaolinrevier.de). schichte (u.a. Geschichte des Hüttenwerks), Natur (u.a. Haidenaab, Biber), Naturgeschichte (Geologie, Wasser- Kunst, Natur und Technik im erfahrbaren Dialog haushalt), Kulturgeschichte und natürlich das Natur- Das Themenspektrum des Pfades kann erweitert wer- schutzgebiet „Vogelfreistätte Weiherhammer“ (mit einer den um die Bereiche Industrie und Kunst. Interaktive der größten Lachmöwenkolonien Nordbayerns) vor. Elemente oder Kunstelemente erhöhen die Attraktivität. An 12 Station werden auf einem Rundgang auf Tafeln Wissen vermittelt. Beginn des Lehrweges ist am Krie- Ausgangspunkt und Stützpunkt gerdenkmal, entferntester Punkt ist am Brandnerkanal, Im Sinne einer touristischen Attraktion und der Bele- dann führt der Weg wieder zurück. Ein Rundweg um bung der Ortsmitte ist der Beginn des neuen „Erleb- nispfades“ am Beckenweiher, in Kombination mit dem neuen Stützpunkt des Vereins „Naturpark Oberpfälzer Wald“, sinnvoll und wünschenswert. Wandern, Wissen und mehr Der Industrie- und Lehrwanderweg allein bietet noch wenig Anlass für Touristen Weiherhammer zu besu- chen. -

Kapitel B 3 Bestandsanalyse Und Bewertung Fachbereich Landschaft
Kapitel B 3 Bestandsanalyse und Bewertung Fachbereich Landschaft Teil raumgutac hten A 6 Kapitel B 3 - Fachanalyse Landschaft 3 Landschaft 3.1 Ziele des Fachbeitrags Die West-Ost-Magistrale A 6 soll wirtschaftliche Impulse setzen. Ziel des Fachbei- trags Landschaft ist es, hierbei a) eine nachhaltige Entwicklung der Flächennutzungen in der Region – insbeson- dere von Siedlung und Gewerbe – zu gewährleisten und b) naturräumliche und landschaftliche Potenziale für die Gesamtentwicklung des Raumes herauszuarbeiten. In der Analysephase werden daher zunächst die Erfordernisse für eine regionale und grenzüberschreitende Landschaftsentwicklung untersucht und Spielräume für Flächeninanspruchnahme aufgezeigt. Konkret bedeutet dies die Suche nach Räumen mit erhöhten Anforderungen an Landschaftsschutz und –entwicklung in regionaler und grenzüberschreitender Kooperation. Dabei werden folgende Untersuchungsschwerpunkte gesetzt: Großflächige Räume mit erhöhten Anforderungen an den Landschaftsschutz (Schutzgebiete) Lebensräume und Biotopverbund Gewässerentwicklung Landschaftserlebnispotenzial (auch als Grundlage touristischer Nutzung) Anforderungen / Aspekte der Landnutzung 3.2 Fachliche Planungsvorgaben 3.2.1 Landesentwicklungsprogramm Bayern (LEP) Das LEP enthält im Fachkapitel „Sicherung und Entwicklung der natürlichen Le- bensgrundlagen und nachhaltige Wasserwirtschaft“ u.a. folgende Zielsetzungen, die in besonderem Maße für die Region Oberpfalz-Nord relevant sind: Entwicklung eines Biotopverbundsystems bei Unterstützung der Kohärenz der Natura -
Linie 11 L L L Bahnhof Weiden L ZOB
Fahrwege Haltestellen A B E M l Finanzamt l Josefskirche l l ZOB Linie 11 l l l Bahnhof Weiden l ZOB Oberviechtach - Weiden Haltestelle Finanzamt 8 = nur an Schultagen Wies Faszinatour, 92637 Weiden, Tel. 0961/670320 Std Montag - Freitag Samstag Sonn- und Feiertag Std 4 4 5 5 6 6 8 7 32 7 8 8 9 9 10 10 11 11 12 12 13 13 14 14 15 15 16 16 17 17 18 18 19 19 20 20 21 21 22 22 23 23 0 0 Fallen 24.12. und 31.12. auf Werktage, Verkehr wie Samstag. Fahrplan gültig ab 15.10.2018 Fahrwege Haltestellen A B C D E F l l l l Finanzamt l l l l Kepler Gymnasium l l l l l l Weiden/Waldhäusl Linie 11 l l l l l l Abzw. Muglhof l l l l Trebsau l Bechtsrieth/B22 l l l l l Bechtsrieth/Kriegerdenkmal l l l l l Bechtsrieth/Schule l l l l l Irchenrieth/Gerberstr. l l l l l Irchenrieth/Post Weiden - Oberviechtach l l l l l Irchenrieth/Kirche l Irchenrieth/Lebenshilfe l l l l Irchenrieth/Grohmann l l l l l l Michldorf/B22 l l l l l Burgmühle l l l l l Sargmühle Haltestelle l l Leuchtenberg/Jugendherberge l l Leuchtenberg/Ort l l Leuchtenberg/B22 Finanzamt l l l l Leuchtenberg/Ringelbrunnen l l Leuchtenberg/Ort l l Leuchtenberg/Jugendherberge 8 = nur an Schultagen l l l l Wieselrieth 9 = nur an schulfreien Tagen l l l l Straßenkreuzung 13 = Bus fährt bis Leuchtenberg l l l Bernrieth 14 = Bus fährt bis Tännesberg l l l l Döllnitz/B22 l Döllnitz/Ort X = nur Ausstieg l Wittschau l l l Fischerhammer l l l Woppenrieth l l Kleinschwand Weg l l l Großenschwand l l l Tännesberg l l l Tännesberg/Schützenheim Wies Faszinatour, 92637 Weiden, Tel. -

10117 Berlin EUROPEAN
EUROPEAN COMMISSION Brussels, 11.03.2014 C(2014) 1293 final PUBLIC VERSION This document is made available for information purposes only. Subject: State aid No. SA.37423 (2013/N) – Germany Regional aid map 2014-2020 Sir, 1. PROCEDURE (1) On 28 June 2013 the Commission adopted the Guidelines on Regional State Aid for 2014-20201 (hereinafter "RAG"). Pursuant to paragraph 178 of the RAG, each Member State should notify to the Commission, following the procedure of Article 108(3) of the Treaty on the Functioning of the European Union, a single regional aid map applicable from 1 July 2014 to 31 December 2020. In accordance with paragraph 179 of the RAG, the approved regional aid map is to be published in the Official Journal of the European Union, and will constitute an integral part of the RAG. (2) By letter dated 27 September 2013, registered at the Commission on 30 September 2013 (2013/096223), the German authorities duly notified a proposal for a regional aid map applicable for the period from 1 July 2014 to 31 December 2020. (3) On 25 October 2013, the Commission requested additional information (2013/107411), which was provided by the German authorities on 21 November 2013 (2013/116246). (4) On 17 December 2013, the Commission addressed a second request for additional information (2013/127201), to which the German authorities replied on 7 January 2014 (2014/000951). 1 OJ C 209, 23.07.2013, p.1 Seiner Exzellenz Herrn Frank-Walter STEINMEIER Bundesminister des Auswärtigen Werderscher Markt 1 D - 10117 Berlin Commission européenne, B-1049 Bruxelles / Europese Commissie, B-1049 Brussel - Belgium. -

Linie 11 L ZOB
Fahrwege Haltestellen A B M l ZOB l l Bahnhof Weiden Linie 11 l ZOB Oberviechtach - Weiden Haltestelle ZOB 8 = nur an Schultagen 9 = nur an schulfreien Tagen Wies Faszinatour, 92637 Weiden, Tel. 0961/670320 Std Montag - Freitag Samstag Sonn- und Feiertag Std 4 4 5 5 6 6 8 8 9 8 7 25 25 28 37 7 8 8 9 26 9 10 10 11 11 12 12 13 13 14 14 15 15 16 16 17 17 18 18 19 19 20 20 21 21 22 22 23 23 0 0 Fallen 24.12. und 31.12. auf Werktage, Verkehr wie Samstag. Fahrplan gültig ab 15.10.2018 Fahrwege Haltestellen A B C D E F l ZOB l l l l l Bahnhof Weiden l l l l l ZOB Linie 11 l l l l Josefskirche l l l l Finanzamt l l l l Kepler Gymnasium l l l l l l Weiden/Waldhäusl l l l l l l Abzw. Muglhof l l l l Trebsau l Bechtsrieth/B22 Weiden - Oberviechtach l l l l l Bechtsrieth/Kriegerdenkmal l l l l l Bechtsrieth/Schule l l l l l Irchenrieth/Gerberstr. l l l l l Irchenrieth/Post l l l l l Irchenrieth/Kirche l Irchenrieth/Lebenshilfe Haltestelle l l l l Irchenrieth/Grohmann l l l l l l Michldorf/B22 l l l l l Burgmühle ZOB l l l l l Sargmühle l l Leuchtenberg/Jugendherberge l l Leuchtenberg/Ort 8 = nur an Schultagen l l Leuchtenberg/B22 9 = nur an schulfreien Tagen l l l l Leuchtenberg/Ringelbrunnen 13 = Bus fährt bis Leuchtenberg l l Leuchtenberg/Ort 14 = Bus fährt bis Tännesberg l l Leuchtenberg/Jugendherberge l l l l Wieselrieth X = nur Ausstieg l l l l Straßenkreuzung l l l Bernrieth l l l l Döllnitz/B22 l Döllnitz/Ort l Wittschau l l l Fischerhammer l l l Woppenrieth Wies Faszinatour, 92637 Weiden, Tel.