Nr. 52A Rede Hans Ehards in Der Sitzung Des
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

30Years 1953-1983
30Years 1953-1983 Group of the European People's Party (Christian -Demoeratie Group) 30Years 1953-1983 Group of the European People's Party (Christian -Demoeratie Group) Foreword . 3 Constitution declaration of the Christian-Democratic Group (1953 and 1958) . 4 The beginnings ............ ·~:.................................................. 9 From the Common Assembly to the European Parliament ........................... 12 The Community takes shape; consolidation within, recognition without . 15 A new impetus: consolidation, expansion, political cooperation ........................................................... 19 On the road to European Union .................................................. 23 On the threshold of direct elections and of a second enlargement .................................................... 26 The elected Parliament - Symbol of the sovereignty of the European people .......... 31 List of members of the Christian-Democratic Group ................................ 49 2 Foreword On 23 June 1953 the Christian-Democratic Political Group officially came into being within the then Common Assembly of the European Coal and Steel Community. The Christian Democrats in the original six Community countries thus expressed their conscious and firm resolve to rise above a blinkered vision of egoistically determined national interests and forge a common, supranational consciousness in the service of all our peoples. From that moment our Group, whose tMrtieth anniversary we are now celebrating together with thirty years of political -
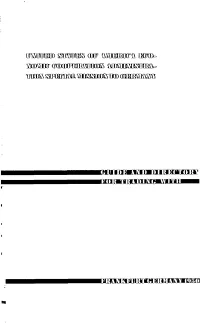
Llf Lli) $L-Rsijii.II(Ill WJIITIW&. If(Fl" -!31F Lhli Wref-1Iiq RI) (Awmw
Llf llI) $l-rsIjii.II(ill WJIITIW&. If(fl" - !31f LhLI WrEf-1iIQ RI) (aWMW LtJJIflWiIJUIJ1JXI1IJ NiIV[Efl?#iUflhl GUIDE AND DIRECTORY FOR TRADING WITH GERMANY ECONOMIC COOPERATION ADMINISTRATION -SPECIAL MISSION TO GERMANY FRANKFURT, JUNE 1950 Distributed by Office of Small Business, Economic Cooperation Administration, Wasbington 25, D.C. FOREWORD This guide is published under the auspices of the Small Bus iness Program of the'Economic Cooperation Administration. It is intended to assistAmerican business firms, particularlysmaller manufacturingand exporting enterprises,who wish to trade or expandtheirpresent tradingrelationswith Western Germany. This guide containsa summary of economic information reg ardingWestern Germany,togetherwith data concerningGerman trade practicesand regulations,particularlythose relatingto the import of goods from the United States financed withECA funds. At the end of the manual are appendicesshowing names and add resses of agencies in Western Germany concerned rodh foreign trade and tables of principalGerman exports and imports. The ECA Special Mission to Germany has endeavored to present useful, accurate,and reliableinformationin this manual. Nothing contained herein, however, should be construed to supersede or modify existing legislationor regulationsgoverning ECA procurement or trade with Western Germany. Sources of information contained herein, such as lists of Western German trade organizations,are believed to be complete, but the Mission assumes no responsibility for errors or omissions, or for the reliabilityof any agencies named. ADDENDUM The following information has been received -during the printing of this manual: 1. American businessmen interested in trading with Germany may consult the newly formed German-American Trade Promotion Company (Ge sellschaftzurFdrderungdesdeutsch-amerikanischen Handels), located at Schillerstrasse I, Frankfurt am Main, Germany. -

Rethinking the Rise of the German Constitutional Court: from Anti
© The Author 2014. Oxford University Press and New York University School of Law. All rights reserved. For permissions, please e-mail: [email protected] Rethinking the rise of the German Constitutional Court: From anti- Nazism to value formalism Downloaded from https://academic.oup.com/icon/article-abstract/12/3/626/763768 by guest on 26 July 2019 Michaela Hailbronner* The German Constitutional Court, we often hear, draws its considerable strength from the reaction to the German Nazi past: Because the Nazis abused rights and had been elected by the people, the argument runs, it was necessary to create a strong Court to guard these rights in the future. This contribution proceeds in two steps. First, it sets out to show that this “Nazi thesis” provides an inadequate explanation for the Court’s authority and rise. The German framers did not envisage the strong, rights-protecting, counter-majoritarian court it has become today. Even where the Nazi thesis does find some application, during the transitional 1950s and 1960s, its role is more complicated and more limited than its proponents assume. Second, this article offers an alternative way of making sense of the German Court’s rise to power. Against a comparative background, I argue that the German Court’s success is best understood as a combination between a (weak) version of trans- formative constitutionalism and a hierarchical legal culture with a strong emphasis on a scientific conception of law and expertise. The Court could tap into the resources of legiti- macy available in this culture by formalizing its early transformative decisions, producing its own particular style, “value formalism.” Value formalism, however, comes with costs, most notably an interpretive monopoly of lawyers shutting out other voices from constitu- tional interpretation. -

Kurzbiographien Der Im Buch Untersuchten Parteivorsitzenden
Kurzbiographien der im Buch untersuchten Parteivorsitzenden Kurzbiographien enu *** Konrad Adenauer (1876-1967) trat 1906 dem Zentrum bei und tibernahm nach einigen Erfahrungen als Beigeordneter der Stadt K61n von 1917-33 das Amt des Oberbtirgermeisters. Nach seiner Absetzung und anschlieBend politi scher Zuruckhaltung im Nationalsozialismus wurde er 1946 Vorsitzender der neu gegrundeten COU in der britischen Besatzungszone. Seine Arbeit als Prasident des Parlamentarischen Rates 1948/49 war eine Weichenstellung, die den Weg zum Kanzleramt 6ffnete, das er von 1949-63 innehatte. 1951-55 amtierte er zu gleich als AuBenminister. Vorsitzender der COU Oeutschlands war er von ihrer Grundung 1950-66. *** Ludwig Erhard (1897-1977) arbeitete als promovierter Okonom bis zum Kriegsende an verschiedenen Wirtschaftsinstituten. 1945/46 wurde er bayeri scher Wirtschaftsminister. AnschlieBend bereitete er 1947 als Leiter der Exper tenkommission "Sonderstelle Geld und Kredit" die Wahrungsreform mit vor und wurde im Jahr darauf zum Oirektor der Wirtschaft der Bizone gewahlt. 1949-63 amtierte er als Wirtschaftsminister der Regierung Adenauer. 1963-66 trat er dessen Nachfolge als Bundeskanzler an. Oer COU trat er aller Wahrscheinlich keit nach erst 1963 bei. 1966/67 amtierte er als deren Parteivorsitzender. Bis zu seinem Tod 1977 blieb Erhard Bundestagsabgeordneter. *** Kurt Georg Kiesinger (1904-1988) war 1933-45 Mitglied der NSOAP. Ab 1940 arbeitete der gelernte Jurist in der Rundfunkabteilung des ReichsauBenmi nisteriums, deren stellvertretender Abteilungsleiter er 1943 wurde. Nach der Internierung 1945/46 tibernahm er im folgenden Jahr das Amt des Landesge schaftsfuhrers der COU Stidwtirttemberg-Hohenzollern. 1949-59 war er ein aktives Mitglied des Bundestages, 1950-57 Vorsitzender des Vermittlungsaus schusses und 1954-58 Vorsitzender des Ausschusses fur Auswartige Angelegen heiten. -

Download Als PDF-Datei
Beiträge zum Parlamentarismus 19 Band 19 Wolfgang Reinicke Landtag und Regierung im Widerstreit. Der parlamentarische Neubeginn in Bayern 1946–1962 Herausgeber Bayerischer Landtag Maximilianeum Max-Planck-Straße 1 81675 München Postanschrift: Bayerischer Landtag 81627 München Telefon +49 89 4126-0 Fax +49 89 4126-1392 [email protected] www.bayern.landtag.de zum Parlamentarismus Beiträge Dr. Wolfgang Reinicke (geb. 1974 in Jena) ist wissenschaftlicher Mitarbeiter am Haus der Bayerischen Geschichte in Augsburg. Er hat an zahlreichen Ausstellungsprojekten mitgewirkt, leitet das Projekt Zeitzeugen und ist Mitglied im Projektteam für das neue Museum der Bayerischen Geschichte in Regensburg. München, November 2014 Bayerischer Landtag Landtagsamt Referat Öffentlichkeitsarbeit, Besucher Maximilianeum, 81627 München www.bayern.landtag.de ISBN-Nr. 978-3-927924-34-5 Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet unter http://dnb.d-nb.de abrufbar. Landtag und Regierung im Widerstreit. Der parlamentarische Neubeginn in Bayern 1946–1962 Inaugural-Dissertation zur Erlangung der Doktorwürde der Philosophischen Fakultät I der Julius-Maximilians-Universität Würzburg vorgelegt von Wolfgang Reinicke M.A. aus München 3 Erstgutachter: Professor Dr. Dirk Götschmann Zweitgutachter: Professor Dr. Dietmar Grypa Tag des Kolloquiums: 6. Februar 2013 4 Inhaltsverzeichnis Vorwort 12 1 Einleitung -

Ungeschützte Hordgrenze
Einzelpreis S 2.— Erscheinung sort Uns PB D. D« Verlagspostamt Urte 2 QtQtrn Dee oudtttnötutföjt« emtrjftmamifdiaft 2. Stpttmbtt folgt DER DREIZEHNTE Von Gustav Putz Ungeschützte Hordgrenze Der dreizehnte August dieses Jahres ist zum Lostag geworden: das Ulbricht-Regime Tschechen kümmern sich nicht um die österreichische Souveränität — Schwachbesetxte Posten ohne moderne Nachrichtenmittel der sogenannten Deutschen Demokrati- schen Republik hat an diesem Tage der LINZ. Seit ein vollbewaffneter und mit scharfer Munition ausgerüste- obwohl sie rein zivile Aufgaben haben, aber das Massenflucht ihrer Bürger durch die Ab- fer frischer Düsenjäger seelenruhig in Aspern gelandet ¡st und ¡ÄÄSi^ ÄT^S^«£ riegelung und Abmauerung der Sektoren- von den österreichischen Behörden ohne viel Schwierigkeiten die Rück- °"* Zoiiwachabfeìlungsinspekforen zoiiwach- grenze ein Ende gesetzt. In den Tagen und Wochen vorher war die Fluchtbewegung flugerlaübnis erhalten hat, mehrenden die Verletzungen des öster- ÏÏÏÏÏÏSLTimZÎÏ Ütfí ins Gigantische angewachsen, eine Reak- reichischen Luftraumes durch tschechische Flugzeuge. Mindestens drei- geführt hat, ist der Sache nicht ged¡*nt, sondern tion des DDR-Volkes auf die kriegerische 9 der Auf benkreij der Zoltwache Sprache des Ostblocks. Aehnliche Anzei- mal — zuletzt am Montag dieser Woche — wurden im Räume von ^ÄJ "* 9° chen einer Kriegspanik traten auch in dfer Hohenau bis Reichenthal im Mühlviertel Einflüge tschechischer Flieger ES wird notwendig sein, dai} sich die Pariom.n- CSSR auf, wenngleich es dort nur wenige fìinwnnrifrAÌ ffì«tn<*<t*llt farier mlf den Sidi«rheltsv«rhaHnlss«n an der Mutige gibt, die den Sprung über die einwanaTrei TeStgeSTeilT. Nordgienz« Österreichs einmal Intensiv betchäf- Grenze wagen. Chruschtschow und seine tl2 n und dle 99 p Diese Einflüge und der Durchbruch eines schweren, gepanzerten Lastwagens durch schlölie2* n u d •*9h"»"9 *« entsprechenden Enf- Genossen hatten durch ihre Kriegsdrohun- schlölien u "d "•*>""•" veranlassen. -

2 Fraktionsvorsitzende Und Parlamentarische Geschäftsführer Geschäftsführer
ARCHIVALIE CDU/CSU-Fraktion im Deutschen Bundestag Seite: 102 Karton/AO Signatur: 08-001 Datum 2 Fraktionsvorsitzende und Parlamentarische Geschäftsführer Geschäftsführer 2.1 Fraktionsvorsitzende 2.1.1 Heinrich von Brentano Fraktionsvorsitzender 1949 - 1955 sowie 1961 - 1964. 292/4 - Brentano, Heinrich von 01.11.1949 - 03.12.1949 Hier: Bundeshauptstadt, Sitz: Zuschriften von Wählern und der Deutschen Wählergemeinschaft zur Abstimmung über den Sitz der Bundeshauptstadt 303/3 - Brentano, Heinrich von 03.11.1949 - 10.09.1955 Hier: Südweststaat: Informationsmaterial, Eingaben und Stellungnahmen von CDU-Gremien zur Badener Frage; Gutachten von Paul Zürcher zum Entwurf eines Neugliederungsgesetzes (1951); Informationsmaterial zu dem Rücktritt von Wilhelm Eckert; Ausarbeitung von Leo Wohleb; Schriftwechsel u.a. mit: Adenauer, Konrad Wuermeling, Franz-Josef Müller, Gebhard 292/3 - Brentano, Heinrich von 1950 Hier: Regierungsbauten Schriftwechsel zur Ausstattung, Kostenaufstellung 301/1 - Brentano, Heinrich von 1950 - 1951 Hier: Neuordnung der Eisen- und Stahlindustrie und des Kohlebergbaus: Schriftwechsel, Informationsmaterial 292/7 - Brentano, Heinrich von 1952 Hier: Verwaltungsrat der Deutschen Bundesbahn: Besprechungen, Schriftwechsel. 296/1 - Brentano, Heinrich von 1954 Hier: Bildung eines Koordinierungsausschusses: Schriftwechsel Paul Bausch/Rudolf Vogel; Ausarbeitung von Otto Lenz 313/3 - Brentano, Heinrich von 1954 Hier: Bundesministerium für Vertriebene, Flüchtlinge und Kriegsgeschädigte: Interfraktioneller Schriftwechsel mit Theodor -

UID Jg. 11 1957 Nr. 47, Union in Deutschland
POSTVERLAGS ORT BONN BONN • 21. NOV. 1957 UNION NR. 47 • 11. JAHRGANG INFORMATIONSDIENST der Christlich-Demokratischen und Christlich-Sozialen Union Der Westen schläft nicht Reaktion auf „Sputnik": Verstärkte Ausbildung von Technikern " Eine der Folgerungen nach dem Auftauchen des sowjetischen „Sputniks" war schulen 80 000 Ingenieure in die Produk- im Westen die Überprüfung der Ausbildungsprogramme und -methoden. tion entlassen werden. Die Gesamtzahl Die Erfahrungen mil den Völkern englischer Sprache lassen sicher einen der ausgebildeten Ingenieure soll bis von Chruschtschow wohl kaum vorausgeahnten * gewaltigen Anstieg der 1960 auf 200 000 jährlich steigen. amerikanischen und britischen Anstrengungen beim Aufbau der Wissen- schaft und Technik erwarten. Umfassende Erziehungsreformen sind geplant. 9 Die Zahl der sowjetischen Studenten betrug 1955/56 schon 1,87 Million. Demgegenüber lag zwar die Zahl der Stu- Dabei wird aber jetzt schon der ent- Entscheidend ist für die USA eine um- denten in den USA höher, aber von 1926 scheidende Unterschied zur Sowjetunion fassende Erziehungsreform und eine be- bis 1954 waren in den USA 9 v. H. aller deutlich: der Westen wird als Antwort trächtliche Steigerung der Zahl der jähr- Studenten Ingenieure, in der UdSSR aber auf die wissenschaftliche und technolo- lich die Hochschulen und Ausbildungs- 25,6 v. H. gische Herausforderung keine technischen institute verlassenden Wissenschaftler und wissenschaftlichen Roboter heranbil- und Fachkräfte aller Art. # In der angewandten und theoretischen den, sondern wissenschaftlich und tech- $ In der Sowjetunion werden heute Wissenschaft der Sowjetunion arbei- nisch geschulte Menschen, weit mehr Wissenschaftler und Inge- teten 1954 etwa 72 000 Wissenschaftler, in den USA aber nur 46 000, in Groß- So schreibt die „New York Times": nieure ausgebildet als im gesamten Westen. -

Abendland Von Vanessa Conze
Abendland von Vanessa Conze Mit der Rede vom "Abendland" wird eine vorwiegend deutsche Europa-Diskussion beschrieben, die zwischen dem Ende des Ersten Weltkriegs und dem Anfang der sechziger Jahre Wirksamkeit entfaltete. In zwei Wellen formte sie in der Zwischenkriegszeit und in den fünfziger Jahren als "hegemoniale Integrationsideologie" einen christlich-katholisch ge- prägten Konservatismus. Die dabei anzutreffenden primär diachronen ideengeschichtlichen Transferleistungen müssen jedoch um einen Blick auf die Jahre des "Dritten Reiches" ergänzt werden, in denen sich die Protagonisten des katholi- schen Europadenkens in großem Maße auf die Ideen und Ordnungsvorstellungen des Nationalsozialismus einließen. INHALTSVERZEICHNIS 1. Entstehung des Begriffs "Abendland" in der Romantik 2. Die Abendland-Idee nach dem Ersten Weltkrieg 3. Die Abendland-Idee zwischen 1930 und 1945 4. Die Abendländische Idee nach dem Zweiten Weltkrieg 5. Anhang 1. Quellen 2. Literatur 3. Anmerkungen Indices Zitierempfehlung Entstehung des Begriffs "Abendland" in der Romantik Der Begriff "Abendland"1 entstand im 16. Jahrhundert im Kontext von Renaissance, Humanismus und Reformation als Gegenbegriff zum Ideal des Orients bzw. zu Martin Luthers (1483–1546) (ᇄ Medien Link #ac) Begriff des Morgenlan- des (Neues Testament 1522). Im deutschen Sprachgebrauch findet sich der Begriff "Abendland" erstmals 1529 als Lehnsübersetzung ("Abendlender") des Begriffs "Okzident" in Caspar Hedios (1494–1552) (ᇄ Medien Link #ad) Chro- nica. Obwohl sich der Begriff zunächst nur geographisch auf das westliche Europa bezog, lud er sich zunehmend kultu- rell auf. Ÿ1 Das heutige Begriffsverständnis entwickelte sich in der Romantik.2 Hier entstand eine spezifisch deutsche Tradition, in der der Topos vom "Abendland" – in der Forschung nicht zu Unrecht als "Kampfbegriff"3 bezeichnet – zum Teil ideolo- gisch stark besetzt war. -

Journal of European Integration History Revue D
Umschlag_JoEIH_01_8mm 30.11.2004 8:34 Uhr Seite 1 JOURNAL OF EUROPEAN INTEGRATION HISTORY The purpose of The Journal of European Integration History is to encourage the JOURNAL OF EUROPEAN analysis and understanding of different aspects of European integration, espe- ISTORY cially since 1945, in as wide a perspective as possible. The Journal publishes the H INTEGRATION HISTORY conclusions of research on diplomatic, military, economic, technological, social and cultural aspects of integration. Numbers devoted to single themes as well as to diverse subjects are published in English, French or German. Each number includes reviews of important, relevant publications. EVUE D’HISTOIRE DE NTEGRATION R I REVUE D’HISTOIRE DE L’INTÉGRATION EUROPÉENNE L’INTÉGRATION EUROPÉENNE L’objectif de la Revue d’histoire de l’intégration européenne est de promouvoir l’ana- lyse et la compréhension des différents aspects de l’intégration européenne UROPEAN E particulièrement depuis 1945, mais sans exclusive. La Revue publie les résultats des recherches sur les aspects diplomatiques, militaires, économiques, technologiques, ZEITSCHRIFT FÜR GESCHICHTE DER sociaux et culturels de l’intégration. Les numéros à thème ou ceux ouverts à diverses perspectives sont publiés dans l’une des langues suivantes: anglais, français, alle- EUROPÄISCHEN INTEGRATION mand. Chaque numéro comprend des comptes rendus d’ouvrages importants. OURNAL OF J edited by the ZEITSCHRIFT FÜR GESCHICHTE DER Groupe de liaison des professeurs d’histoire contemporaine EUROPÄISCHEN INTEGRATION auprès de la Commission européenne Die Zeitschrift für Geschichte der europäischen Integration bietet ein Forum zur Erforschung des europäischen Integrationsprozesses in allen Aspekten: den poli- tischen, militärischen, wirtschaftlichen, technologischen, sozialen und kulturellen. Ihren Schwerpunkt bilden Beiträge zu den konkreten Einigungsprojekten seit 1945, doch werden auch Arbeiten zu den Vorläufern und Vorbereitungen publiziert. -

Download (1198Kb)
EUROPEAN PARLIAMENT 1953-1978 EUROPEAN PARLIAMENT 25 YEARS CHRISTIAN-DEMOCRATIC GROUP 1953-1978 2 Foreword ............................................................................... Constitution declaration of the Christian-Democratic Group (1953 and 1958) The beginnings ..................................................................... From the Common Assembly to the European Parliament The Community takes shape; consolidation within, recognition without ..................................................................... A new impetus: consolidation, expansion, political cooperation .................................................................... On the road to European Union ....................................................... · ·. On the threshold of direct elections and of a second enlargement ............................................................ List of members of the Christian-Democratic Group ....................................... 3 Foreword With just one year to go before direct elections to the European Parliament, we can now look back on more than 25 years work by the Christian-Democratic Group in the Common Assembly and in the European Parliament. On 11 September 1952, just one day after the Common Assembly met for the first time, the Christian-Democratic delegates from the six countries formed an unofficial alliance and elected Emanuel M.J.A. Sassen, from the Netherlands, as their chairman. But the ECSC Treaty had made no provision for political groups and it was not until 1953 that they acquired a -

UID Jg. 11 1957 Nr. 38, Union in Deutschland
POSTVERLAGSORT BONN NK.38 .1 JAHRGANG UNION BONN 18. SEPT. «957 INFORMATIONSDIENST der Christlich-Demokratischen und Christlich-Sozialen Union Unser Erfolg - Unsere Verpflichtung! Bisher der größte Wahlerfolg einer demokratischen Partei in Deutschland So verteilten sich die Stimmen bei den drei Bundestagswahlen ne- 1949 1953 1957 Zweitstimmen >nf uf ein ZZLsott 1957 Liebe Freunde! Wir waren am Sonntagabend troh CDU/CSU 31 v. H. 45,2 v. H. 50,18 v.H. 14 998 754 und stolz, als wir aus dem Lautspre-' eher des Rundfunks die erste Bestäti- SPD 29,2 v. H. 28,8 v. H. 31,75 v.H. 9 490 726 gung unseres Erfolges erhielten. Froh + KP 5.7 v. H. 2,2 v. H. und stolz, aber nicht übermütig! Da- -f GVP 1.2 v.H. vor hat uns schon die Irische Erinne- 34,9 v. H. 32,2 v. H. rung an die hinter uns liegenden Monate bewahrt, in denen wir in FDP 11,9 v.H. 9,5 v. H. 7,7 v. H. 2 304 846 zäher und harter Arbeit den Wahl- eriolg der Union vorbereiten hallen. BHE 5,9 v. H. 4,59 v. H. 1 373 001 Er ist uns wahrhaftig nicht in den Schoß gefallen, und wir empfinden DP 4 v.H. 3.3 v. H. 3,36 v. H. 1 006 350 alle, daß er der CDU/CSU mehr als je die Verpflichtung auferlegt, ihn mit DRP 1.8 v.H. 1,1 v.H. 1,12 v.H. 307 310 Mäßigung und Klugheit zu Nutzen des ganzen Volkes zu verwenden.