Abendland Von Vanessa Conze
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-
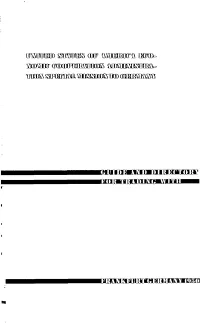
Llf Lli) $L-Rsijii.II(Ill WJIITIW&. If(Fl" -!31F Lhli Wref-1Iiq RI) (Awmw
Llf llI) $l-rsIjii.II(ill WJIITIW&. If(fl" - !31f LhLI WrEf-1iIQ RI) (aWMW LtJJIflWiIJUIJ1JXI1IJ NiIV[Efl?#iUflhl GUIDE AND DIRECTORY FOR TRADING WITH GERMANY ECONOMIC COOPERATION ADMINISTRATION -SPECIAL MISSION TO GERMANY FRANKFURT, JUNE 1950 Distributed by Office of Small Business, Economic Cooperation Administration, Wasbington 25, D.C. FOREWORD This guide is published under the auspices of the Small Bus iness Program of the'Economic Cooperation Administration. It is intended to assistAmerican business firms, particularlysmaller manufacturingand exporting enterprises,who wish to trade or expandtheirpresent tradingrelationswith Western Germany. This guide containsa summary of economic information reg ardingWestern Germany,togetherwith data concerningGerman trade practicesand regulations,particularlythose relatingto the import of goods from the United States financed withECA funds. At the end of the manual are appendicesshowing names and add resses of agencies in Western Germany concerned rodh foreign trade and tables of principalGerman exports and imports. The ECA Special Mission to Germany has endeavored to present useful, accurate,and reliableinformationin this manual. Nothing contained herein, however, should be construed to supersede or modify existing legislationor regulationsgoverning ECA procurement or trade with Western Germany. Sources of information contained herein, such as lists of Western German trade organizations,are believed to be complete, but the Mission assumes no responsibility for errors or omissions, or for the reliabilityof any agencies named. ADDENDUM The following information has been received -during the printing of this manual: 1. American businessmen interested in trading with Germany may consult the newly formed German-American Trade Promotion Company (Ge sellschaftzurFdrderungdesdeutsch-amerikanischen Handels), located at Schillerstrasse I, Frankfurt am Main, Germany. -

Rethinking the Rise of the German Constitutional Court: from Anti
© The Author 2014. Oxford University Press and New York University School of Law. All rights reserved. For permissions, please e-mail: [email protected] Rethinking the rise of the German Constitutional Court: From anti- Nazism to value formalism Downloaded from https://academic.oup.com/icon/article-abstract/12/3/626/763768 by guest on 26 July 2019 Michaela Hailbronner* The German Constitutional Court, we often hear, draws its considerable strength from the reaction to the German Nazi past: Because the Nazis abused rights and had been elected by the people, the argument runs, it was necessary to create a strong Court to guard these rights in the future. This contribution proceeds in two steps. First, it sets out to show that this “Nazi thesis” provides an inadequate explanation for the Court’s authority and rise. The German framers did not envisage the strong, rights-protecting, counter-majoritarian court it has become today. Even where the Nazi thesis does find some application, during the transitional 1950s and 1960s, its role is more complicated and more limited than its proponents assume. Second, this article offers an alternative way of making sense of the German Court’s rise to power. Against a comparative background, I argue that the German Court’s success is best understood as a combination between a (weak) version of trans- formative constitutionalism and a hierarchical legal culture with a strong emphasis on a scientific conception of law and expertise. The Court could tap into the resources of legiti- macy available in this culture by formalizing its early transformative decisions, producing its own particular style, “value formalism.” Value formalism, however, comes with costs, most notably an interpretive monopoly of lawyers shutting out other voices from constitu- tional interpretation. -

Journal of European Integration History Revue D
Umschlag_JoEIH_01_8mm 30.11.2004 8:34 Uhr Seite 1 JOURNAL OF EUROPEAN INTEGRATION HISTORY The purpose of The Journal of European Integration History is to encourage the JOURNAL OF EUROPEAN analysis and understanding of different aspects of European integration, espe- ISTORY cially since 1945, in as wide a perspective as possible. The Journal publishes the H INTEGRATION HISTORY conclusions of research on diplomatic, military, economic, technological, social and cultural aspects of integration. Numbers devoted to single themes as well as to diverse subjects are published in English, French or German. Each number includes reviews of important, relevant publications. EVUE D’HISTOIRE DE NTEGRATION R I REVUE D’HISTOIRE DE L’INTÉGRATION EUROPÉENNE L’INTÉGRATION EUROPÉENNE L’objectif de la Revue d’histoire de l’intégration européenne est de promouvoir l’ana- lyse et la compréhension des différents aspects de l’intégration européenne UROPEAN E particulièrement depuis 1945, mais sans exclusive. La Revue publie les résultats des recherches sur les aspects diplomatiques, militaires, économiques, technologiques, ZEITSCHRIFT FÜR GESCHICHTE DER sociaux et culturels de l’intégration. Les numéros à thème ou ceux ouverts à diverses perspectives sont publiés dans l’une des langues suivantes: anglais, français, alle- EUROPÄISCHEN INTEGRATION mand. Chaque numéro comprend des comptes rendus d’ouvrages importants. OURNAL OF J edited by the ZEITSCHRIFT FÜR GESCHICHTE DER Groupe de liaison des professeurs d’histoire contemporaine EUROPÄISCHEN INTEGRATION auprès de la Commission européenne Die Zeitschrift für Geschichte der europäischen Integration bietet ein Forum zur Erforschung des europäischen Integrationsprozesses in allen Aspekten: den poli- tischen, militärischen, wirtschaftlichen, technologischen, sozialen und kulturellen. Ihren Schwerpunkt bilden Beiträge zu den konkreten Einigungsprojekten seit 1945, doch werden auch Arbeiten zu den Vorläufern und Vorbereitungen publiziert. -

HISTORISCH-POLITISCHE MITTEILUNGEN Archiv Für
Böhlau, Beenken, Historisch-Politische-Mitteilungen, 2. AK I 1 HISTORISCH-POLITISCHE 2 3 MITTEILUNGEN 4 5 6 Archiv für 7 8 Christlich-Demokratische Politik 9 10 11 12 13 Im Auftrag der 14 Konrad-Adenauer-Stiftung e.V. 15 herausgegeben von 16 Günter Buchstab und Hans-Otto Kleinmann 17 18 19 20 21 22 8. Jahrgang 23 2001 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 BÖHLAU VERLAG KÖLN WEIMAR WIEN 42 Böhlau, Beenken, Historisch-Politische-Mitteilungen, 2. AK II 1 HISTORISCH-POLITISCHE MITTEILUNGEN 2 Archiv für Christlich-Demokratische Politik 3 4 8. Jahrgang 2001 5 Im Auftrag der 6 Konrad-Adenauer-Stiftung e.V. 7 herausgegeben von 8 9 Dr. Günter Buchstab und Prof. Dr. Hans-Otto Kleinmann 10 Redaktion: Dr. Felix Becker 11 Gedruckt mit Unterstützung der Bundesrepublik Deutschland 12 Anschrift: 13 Konrad-Adenauer-Stiftung e.V. 14 15 Wissenschaftliche Dienste 16 Archiv für Christlich-Demokratische Politik 17 Rathausallee 12 18 53757 Sankt Augustin bei Bonn 19 Tel 02241 / 246 210 20 21 Fax 02241 / 246 669 22 e-mail: [email protected] 23 internet: www.kas.de/geschichte/html 24 25 Verlag: 26 Böhlau Verlag GmbH & Cie, Ursulaplatz 1, D-50668 Köln 27 e-mail: [email protected] 28 29 Die Zeitschrift »HISTORISCH-POLITISCHE MITTEILUNGEN/Archiv 30 für Christlich-Demokratische Politik« erscheint einmal jährlich mit einem 31 Heftumfang von ca. 260 Seiten. Der Preis beträgt DM 38,–. Ein Abonnement 32 verlängert sich automatisch um ein Jahr, wenn die Kündigung nicht zum 33 1. Dezember erfolgt ist. -

Inhaltsverzeichnisÿ
Iÿ Inhaltsverzeichnisÿ 1ÿGründungÿundÿAnfänge 1 1.1ÿArbeitsgemeinschaftÿderÿCDU/CSU 1 1.2ÿZonenausschußÿderÿCDUÿfürÿdieÿbritischeÿZone 4 1.3ÿAltesÿArchivÿ1945ÿ-ÿ1960 6 1.3.1ÿGründungÿderÿBundesrepublik 6 1.3.2ÿCDU 10 1.3.3ÿParteien 20 1.3.4ÿKirchen 26 1.3.5ÿBundesländer 28 1.3.6ÿSowjetischeÿBesatzungszoneÿ/ÿDDR 34 1.3.7ÿStaaten 37 1.3.8ÿInternationaleÿKonferenzenÿundÿVerträge 39 1.3.9ÿPolitikfelderÿAÿbisÿZ 41 1.3.10ÿSachthemenÿAÿbisÿZ 67 2ÿBundesparteitageÿderÿCDUÿ1950ÿ-ÿ1990ÿundÿParteitageÿderÿCDUÿDeutschlands 75 1990ÿ- 2.1ÿBundesparteitageÿderÿCDUÿ1950ÿ-ÿ1990 79 2.1.1ÿDerÿ1.ÿBundesparteitagÿGoslarÿ20.-22.10.1950 79 2.1.2ÿDerÿ2.ÿBundesparteitagÿKarlsruheÿ18.-21.10.1951 82 2.1.3ÿDerÿ3.ÿBundesparteitagÿBerlinÿ17.-19.10.1952 84 2.1.4ÿDerÿ4.ÿBundesparteitagÿHamburgÿ18.-22.04.1953 85 2.1.5ÿDerÿ5.ÿBundesparteitagÿKölnÿ28.-30.05.1954 88 2.1.6ÿDerÿ6.ÿBundesparteitagÿStuttgartÿ26.-29.04.1956 90 2.1.7ÿDerÿ7.ÿBundesparteitagÿHamburgÿ11.-15.05.1957 92 2.1.8ÿDerÿ8.ÿBundesparteitagÿKielÿ18.-21.09.1958 93 2.1.9ÿDerÿ9.ÿBundesparteitagÿKarlsruheÿÿ26.-29.04.1960 95 2.1.10ÿDerÿ10.ÿBundesparteitagÿKölnÿ24.-27.04.1961 96 2.1.11ÿDerÿ11.ÿBundesparteitagÿDortmundÿ02.-05.06.1962 98 2.1.12ÿDerÿ12.ÿBundesparteitagÿHannoverÿ14.-17.03.1964 99 2.1.13ÿDerÿ13.ÿBundesparteitagÿDüsseldorfÿ28.-31.03.1965 103 2.1.14ÿDerÿ14.ÿBundesparteitagÿBonnÿ21.-23.03.1966 105 2.1.15ÿDerÿ15.ÿBundesparteitagÿBraunschweigÿ22.-23.05.1967 106 2.1.16ÿDerÿ16.ÿBundesparteitagÿBerlinÿ04.-07.11.1968 109 2.1.16.1ÿBereichÿLeitung 110 2.1.16.2ÿBereichÿStabsorgane 112 2.1.16.3ÿBereichÿPolitik 112 -

Historical Association of Deutsche Bank
Report for theYear 1977 Deutsche Bank Aktiengesellsc t~aft Deutsche Bank at a glance 1977 1976 Business volume .................. DM 78.7 bn. DM 67.8 bn. Balance sheet total ................. DM 78.6 bn. DM 67.4bn. Funds from outside sources ............ DM 72.4 bn. DM 62.0 bn. Total credit extended ................ DM 45.3 bn. DM 41.7 bn. Own funds ...................... DM 3,450.0 m. DM 3,100.0 m. Earnings on business volume ........... Earnings on services ................ Staff and other aperating expenses ........ Taxes ......................... Net income for the year ............... Transfers to disclosed reserves .......... Total dividend payment ............... Dividend per share of DM 50 par value ...... Shareholders ..................... Staff ......................... Customers (excl. banks) .............. Offices ........................ Group Business volume .................. DM 124.5 bn. DM 105.9 bn. Balance sheet total ................. DM 124.2 bn. DM 105.2 bn. Funds from outside sources ............ DM 115.7 bn. DM 97.9 bn. Total credit extended ................ DM 83.7 bn. DM 73.7 bn. Own funds ...................... DM 4,003.0 m. DM 3,522.4 m. Staff ......................... 40,614 40,772 Offices ........................ 1,279 1,281 Contents Deutsche Bank at a glance .................................. 2 Agenda for the Ordinary General Meeting ........................ 5 Supervisory Board .......................................... 7 Advisory Board ............................................ 8 Board of Managing Directors -

Abendland by Vanessa Conze
Abendland by Vanessa Conze The term Abendland (Occident) refers to a primarily German discussion about Europe, which was particularly active from the end of the First World War to the early 1960s. A Catholic Christian conservatism formed as a "hegemonic integrative ideology" in two waves, in the interwar period and in the 1950s. However, to fully understand the primarily diachronic transfer of ideas involved in the development of the concept, it is necessary to consider the "Third Reich" period, during which many exponents of a Catholic idea of Europe came around to National Socialist ideas and concepts of order. TABLE OF CONTENTS 1. The Emergence of the Concept of Abendland in Romanticism 2. The Abendland Idea after the First World War 3. The Abendland Idea between 1930 and 1945 4. The Abendland Idea after the Second World War 5. Appendix 1. Sources 2. Literature 3. Notes Indices Citation The Emergence of the Concept of Abendland in Romanticism The term "Abendland"1 emerged in the 16th century in the context of the Renaissance, humanism and the Reformation as the opposing term to the ideal of the Orient and to Martin Luther's (1483–1546) (➔ Media Link #ac) concept of the Morgenland (New Testament 1522). The term "Abendland" appeared first in German in 1529 as a calque ("Abendlender") of the term "Occident" in Caspar Hedio's (1494–1552) (➔ Media Link #ad) Chronica. While the term was initially a purely geographical term referring to western Europe, it acquired an increasing amount of cultural connotations. ▲1 The present-day understanding of the term developed during the period of romanticism.2 A specifically German tradition emerged during this period, in which the topos of Abendland – which has been described in academic literature as a "Kampegriff"3 (combative term) with some justification – at times became very ideologically loaded. -

Nr. 52A Rede Hans Ehards in Der Sitzung Des
24. Mai 1952 351 Nr. 52a Rede Hans Ehards in der Sitzung des Landesvorstands der Christlich-Sozialen Union am 24. Mai 1952 in München BayHStA, NL Ehard 12011 Das Ansehen der CSU in und außerhalb Bayerns ist derzeit schwer angeschlagen. Lesen Sie die Zeitungen und hören Sie die Bevölkerung! [Geld zu erhalten ist häu- fig schwer. Haltung der Industrie. Finanzierung] der BP]2 Es kommt dazu: Wenn in Bayern etwas passiert, was gar nicht schicklich, dann ist die Menge überglück- lich: In Bayern selbst wird es wirklich aufgebläht und außerhalb maßlos übertrie- ben. Gegensatz anderswo: z. B. Stuttgart - Frankfurt! Uber allen Gipfeln ist Ruh3! [•] Und wir haben diesmal selbst dafür gesorgt, den Wirbel möglichst zu verstär- ken. Wenn wir aber CSU bleiben und uns erhalten und durchsetzen wollen, müs- sen wir4 den Mut haben, das zu erkennen und Abhilfe zu suchen. Eines ist sicher: Wir können die Krise nicht überwinden, wenn wir gar nichts tun und warten, bis wir nicht mehr Herr unserer freien Entschlüsse sind. Bevor man sich entschließt, muß man versuchen, die Situation klar zu erkennen. [•] Heutige Situation auf Regierungsebene: Sie werden mir zugeben müssen: Ich habe mich bis zur äußerst möglichen Grenze vor ein Kabinettsmitglied und vor einen Parteifreund gestellt. Als die Sache mit den Vorwürfen des Juda Weißmann5 bekannt wurde, habe ich mich sofort bemüht, den Sachverhalt aufzuklären, aber gleichzeitig zu verhüten, daß die Sache entstellt und politisch propa- [•] gandi- stisch in der Öffentlichkeit herumgezogen wurde. Damals vor den Gemeinde- wahlen, aber auch zum Nachteil der CSU und Bayerns. Auch heute noch meine Überzeugung: Die Sache Ohrenstein hätte man ge- räuschloser und besser liquidieren können. -

CSU-Landesgruppe – 1.–6
CSU-LG – 01.–06. WP Archivalien CSU-Landesgruppe – 1.–6. Wahlperiode (1949–1972) Verzeichnis der Archivalien und mündlichen Auskünfte Archiv für Christlich-Soziale Politik, München (ACSP) Protokolle der CSU-Landesgruppe im Deutschen Bundestag (LG-Protokolle) Akten der CSU-Landesgruppe im Deutschen Bundestag (LG-Akten) Protokolle der CSU-Fraktion im Bayerischen Landtag (LTF-Protkolle) Akten der CSU-Fraktion im Bayerischen Landtag (LTF-Akten) CSU-Landesversammlungen/Parteitage (PT) CSU-Landesausschüsse/Parteiausschüsse (PA) Landesvorstand, Parteivorstand, Präsidium (PVo/Präs) Infodienst der CSU-Landesgruppe im Deutschen Bundestag (Infodienst) Film-Video-Sammlung (FVS) Nachlass Rudolf Birkl Nachlass Hermann Höcherl Nachlass Richard Jaeger Nachlass Fritz Schäffer Nachlass Franz Josef Strauß Archiv für Christlich-Demokratische Politik, Sankt Augustin (ACDP) Protokolle der CDU/CSU-Fraktion im Deutschen Bundestag 1969-1972 (08-001) Protokolle des CDU-Bundesvorstandes 1969-1972 (07-001) Nachlass Hans Globke (01-070) Nachlass Heinrich Krone (01-028) Nachlass Werner Marx (01-356) Nachlass Josef Rösing (01-113) Teilnachlass Ludwig Erhard (01-554) Nachlass Kurt Georg Kiesinger (01-226) Teilnachlass Hans Schuberth (01-397) Bayerische Staatsbibliothek, München (BStB) Nachlass Karl Schwend Bayerisches Hauptstaatsarchiv, München (BayHStA) Nachlass Anton Pfeiffer Nachlass Hans Ehard Ministerium für Unterricht und Kultus (MK) Bayerische Staatskanzlei (StK) Bevollmächtiger des Freistaates Bayern beim Bund Copyright © 2017 KGParl 1 CSU-LG – 01.–06. WP Archivalien -

01-369 Hermann Ehlers
01-369 Hermann Ehlers ARCHIV FÜR CHRISTLICH-DEMOKRATISCHE POLITIK DER KONRAD-ADENAUER-STIFTUNG E.V. 01 – 369 HERMANN EHLERS SANKT AUGUSTIN 2014 I Inhaltsverzeichnis 1 Persönliches 1 1.1 Persönliche Korrespondenz 1 1.2 Tod von Hermann Ehlers und Kondolenzschreiben 2 1.3 Veröffentlichungen 4 1.3.1 Sonntagsspiegel 4 1.3.2 Chronologische Ablage der Veröffentlichungen (ohne Sonntagsspiegel) 5 1.3.3 Thematisch Sammlungen von Veröffentlichungen 13 1.4 Korrespondenz 15 2 Bundestagspräsident 18 2.1 Deutschlandpolitik 20 2.2 Niedersachsen 22 2.3 Kirchenangelegenheiten 22 3 Wahlen 24 4 CDU 25 5 Kirche 28 5.1 Bekennende Kirche / Kirche während des 3. Reiches 28 5.2 Evangelische Kirche in Deutschland (EKD) 29 5.3 Kirchliche Jugendarbeit 31 6 Andere Verbände 33 7 Presseausschnitte zu Hermann Ehlers 34 Sachbegriff-Register 36 Ortsregister 41 Personenregister 43 Biographische Angaben: 1904 10 01 geboren in Berlin-Schöneberg (Vater: Hermann Ehlers, Postbeamter; Mutter: Adelheid Ehlers, geb. Rabe) 1919 Anschluß an den Bibelkreis höherer Schulen 1922 Abitur in Berlin-Steglitz Studium der Rechts- und Staatswissenschaften in Berlin und Bonn 1923 Eintritt in den Verein Deutscher Studenten (VDSt) 1924 einige Monate freiwilliger Dienst bei der Reichswehr 1929 Promotion zum Dr. jur. ("Wesen und Wirkungen eines Reichslandes Preußen") Referendariat in Neukölln und Frankfurt (Oder) 1930 - 1933 Mitglied der Reichsleitung des Bundes deutscher Bibelkreise 1931 Große juristische Staatsprüfung 1931 Justitiar der Notgemeinschaft der Inneren Mission der Evangelischen Kirche der Altpreußischen Union in Berlin 1933 - 1934 Rechtsberatungsbeauftragter der Bezirksverwaltung Berlin-Steglitz 1934 - 1936 juristischer Hilfsarbeiter bei Rechtsanwalt und Notar Horst Holstein, zuständig für kirchenrechtliche Angelegenheiten 1934 - 1936 Mitglied der Leitung der Bekennenden Kirche in der Altpreußischen Union 1936 - 1939 Richter in Berlin auf Betreiben der NSDAP aus dem Justizdienst entlassen, danach Anwaltvertreter 1937 17. -

Verzeichnis Der Briefe
Verzeichnis der Briefe Nr. Datum Adressat/Dokument 1 18.3.1951 Bundesminister für Wirtschaft, Professor Dr. Ludwig Erhard, Bonn 2 18.3.1951 Hoher Kommissar der Vereinigten Staaten von Amerika, John J. McCloy, Bad Homburg 3 19.3.1951 Bundesminister für Wirtschaft, Professor Dr. Ludwig Erhard, Bonn 4 19.3.1951 Bundesminister für gesamtdeutsche Fragen, Jakob Kaiser, Bonn 5 23.3.1951 Nordrhein-westfälischer Innenminister, Dr. Adolf Flecken, Neuss 6 28.3.1951 Oberbürgermeister Theodor Bleek, Kassel-Wilhelmshöhe 7 30.3.1951 Justizrat Dr. Heinrich Schrömbgens, Karlsruhe 8 2.4.1951 Dr. Paul Silverberg, Lugano 9 3.4.1951 Präsident des Senats der Hansestadt Bremen, Wilhelm Kaisen, Bremen 10 3.4.1951 Reichskanzler a. D. Dr. Joseph Wirth, Luzern 11 5.4.1951 Hoher Kommissar der Französischen Republik, Botschafter Andre François-Poncet, Bad Godesberg 12 5.4.1951 Bundespräsident Professor Dr. Theodor Heuss, Bonn 13 5.4.1951 Wilhelm Johnen, Jülich 14 5.4.1951 Regierungspräsident Wilhelm Warsch, Köln-Lindenthal 15 [6.]4.1951 Vorsitzender der CDU/CSU-Fraktion des Deutschen Bundestages, Dr. Heinrich von Brentano, Bonn 16 6.4.1951 Vorstandsmitglied des Deutschen Gewerk- schaftsbundes, Hans vom Hoff, Düsseldorf 17 9.4.1951 Bundesminister für Wirtschaft, Professor Dr. Ludwig Erhard, Bonn 18 9.4.1951 Wilhelm Johnen, Jülich 19 14.4.1951 Französischer Außenminister, Robert Schuman, Paris 20 [18.4.1951] Simone Patrouilles, Paris 21 18.4.1951 Französischer Außenminister, Robert Schuman, Paris 22 20.4.1951 Bundestagsabgeordneter Dr. Friedrich Holzapfel, Bonn 23 21.4.1951 Ria Reiners, Mönchengladbach 24 23.4.1951 Vorsitzender der SPD-Fraktion des Deutschen Bundestages, Dr. -
Németország Második Világháború Utáni Államépítése, Alkotmányjogi Helyzete, És Az Újraegyesítés
Szigeti Magdolna Németország második világháború utáni államépítése, alkotmányjogi helyzete, és az újraegyesítés 1 Tartalomjegyzék Elıszó 4. oldal I. Németország és az európai egyensúly 6. oldal II. A gyıztes hatalmak céljai 12. oldal III. Németország felosztása 16. oldal IV. A két német állam kialakulása 22. oldal IV. 1. Egységes Németország helyett két Németország 22. oldal IV. 2. A Német Szövetségi Köztársaság megalakulása 25. oldal IV. 3. A Német Demokratikus Köztársaság megalakulása 29. oldal IV. 4. Berlin 33. oldal IV. 5. A „Saarland” 42. oldal IV. 6. Az NSZK, az Alaptörvény 45. oldal IV. 7. Az NSZK állami szervei, és a megszálló hatalmak 62. oldal IV. 8. Az NDK, az 1949-es alkotmány 70. oldal IV. 9. Az NDK állami szervei, és a megszálló hatalom 76. oldal V. A hidegháború elsı évei 82. oldal VI. A szövetségi kormány államépítési törekvései 1955-1969 között 88. oldal VII. 1. Az NDK Ulbricht vezetése alatt 101. oldal VII. 2. Az 1968-as kelet-német alkotmány 106. oldal VIII. A két német állam viszonya a szociál-liberális koalíció idején 113. oldal IX. A kelet-német kommunista hatalom összeomlása 129. oldal IX. 1. Határnyitás Magyarországon 130. oldal IX. 2. Helyi választások az NDK-ban 131. oldal IX. 3. A nyugtalanság idıszaka 133. oldal IX. 4. AZ NDK fennállásának 40. évfordulója 136. oldal IX. 5. Honecker bukása 139. oldal IX. 6. A kiutazásról szóló törvény 144. oldal IX. 7. A fal megnyitása 146. oldal X. A német egyesítéshez vezetı út 148. oldal X. 1. Kísérletek az NDK megtartására 150. oldal X. 2. Kohl kancellár 10 pontja 153. oldal X.