Konzert Weihnachts- Oratorium 1-3 2003
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb

Load more
Recommended publications
-

3Biography Long
Biography The tenor Marcus Ullmann was born in Olbernhau near Dresden. He started singing as a member of the famous Dresden Kreuzchor at the age of ten, thereafter studying with Hartmut Zabel and Margret Trappe-Wiel at the Hochschule für Musik in Dresden. Later he studied with Dietrich Fischer-Dieskau in Berlin and with Marga Schiml in Karlsruhe. Graduating with distinction, he soon was a guest singer at the German Opera Houses Staatstheater Mainz and Semperoper Dresden. The following engagements included roles at the Teatro La Fenice, Opera House Rome, Teatro Communale Firence and Los Angeles Opera. He also appeared as Nero in Monteverdi's "L'incoronazione di Poppea" at the Boston Early Music Festival. He has performed as a concert singer widely throughout Europe, in North and South America, in Africa and in Japan. Conductors with whom he has worked in a range of repertoire include Frieder Bernius, Ivor Bolton, Riccardo Chailly, Marcus Creed, Enoch zu Guttenberg, Ludwig Güttler, Sigiswald Kuijken, Kent Nagano, Hans- Christoph Rademann, Helmuth Rilling and Peter Schreier. He often sang with the Dresden Kreuzchor, the Windsbach Knabenchor and the Thomanerchor Leipzig. As a recitalist, Marcus Ullmann has been a guest at such festivals as the Schubertiade Schwarzenberg, the European Music Festival Stuttgart, Kuhmo in Finland, the West Cork Chamber Music Festival, the Moritzburg Chamber Music Festival and many others both in Germany and internationally. In the summer of 2012 he performed Dvorak`s „Cypresses“ at the Salzburger Festspiele with great success. He has also given recitals at the Wigmore Hall London, the Concertgebouw Amsterdam, the Opera House Cairo, as well as the Musashino Shimin Bunka Kaikan Hall in Tokyo. -

Samedi 19 Janvier Orchestre Philharmonique De Radio France
Roch-Olivier Maistre, Président du Conseil d’administration Laurent Bayle, Directeur général Samedi 19 janvier Orchestre Philharmonique de Radio France | Samedi 19 janvier | Samedi Dans le cadre du cycle Terres promises Du mardi 8 au samedi 19 janvier 2008 Vous avez la possibilité de consulter les notes de programme en ligne, 2 jours avant chaque concert, à l’adresse suivante : www.cite-musique.fr Orchestre Philharmonique de Radio France France Philharmonique de Radio Orchestre OPRF 1901.indd 1 14/01/08 14:24:52 Cycle Terres promises Du marDi 8 au SameDi 19 janVier De l’exode biblique à la découverte de l’amérique par Christophe Colomb, MARDI 8 JANVIER, 20H de la célébration du « nouveau monde » par Dvorák à l’exploration d’autres ailleurs musicaux : autant de terres promises, littérales ou métaphoriques. Georg Friedrich Haendel Israel in Egypt L’exode biblique raconte l’esclavage des juifs en Égypte avant qu’ils ne traversent, sous la conduite de moïse, la mer rouge et le désert du Sinaï pour aller vers The King’s Consort la Terre promise. Dans son oratorio créé à Londres en 1739, Haendel donne Matthew Halls, direction à entendre la plainte des juifs, peint les plaies que Dieu inflige à l’Égypte qui les opprime et conclut son œuvre par le cantique de moïse. JEUDI 10 JANVIER, 20H en exergue au beau livre-disque qu’il a réalisé avec montserrat Figueras, La Capella reial de Catalunya et l’ensemble Hespèrion XXi (Christophorus Colombus. Paradis Christophe Colomb, Paradis perdus perdus , alia Vox, 2006), jordi Savall citait ces mots du poète espagnol jorge manrique, contemporain de Christophe Colomb : « Ce monde était bon, si nous Hespèrion XXI savions en faire bon usage. -

Messe in H-Moll BWV 232
Carus 83.211 Johann Sebastian Bach Messe in h-Moll BWV 232 Mechthild Bach Daniel Taylor Marcus Ullmann Raimund Nolte Kammerchor Stuttgart Barockorchester Stuttgart Frieder Bernius Johann Sebastian Bach (1685–1750) Messe in h-Moll BWV 232 Mechthild Bach, Soprano · Daniel Taylor, Alto Marcus Ullmann, Tenore · Raimund Nolte, Baritono Kammerchor Stuttgart · Barockorchester Stuttgart Frieder Bernius CD 1 CD 2 Kyrie Credo 1 Kyrie eleison I (Coro SSATB) 9:32 1 Credo in unum Deum (Coro) 1:57 2 Christe eleison (Soli S I, S II) 4:21 2 Patrem omnipotentem (Coro) 2:00 3 Kyrie eleison II (Coro) 2:30 3 Et in unum Dominum (Soli S I, A) 4:31 4 Et incarnatus est (Coro) 3:19 Gloria 5 Crucifixus (Coro SATB) 2:55 4 Gloria in excelsis Deo (Coro) 1:37 6 Et resurrexit (Coro) 3:33 5 Et in terra pax (Coro) 4:36 7 Et in Spiritum Sanctum (Solo B) 4:33 6 Laudamus te (Solo S II) 4:08 8 Confiteor (Coro) 3:49 7 Gratias agimus tibi (Coro) 2:23 9 Et exspecto (Coro) 2:01 8 Domine Deus (Soli S I, T) 5:31 9 Qui tollis (Coro) 2:53 Sanctus 10 Qui sedes (Solo A) 4:31 10 Sanctus (Coro SSAATB) 4:54 11 Quoniam tu solus Sanctus (Solo B) 4:21 11 Osanna (Coro SATB/SATB) 2:36 12 Cum Sancto Spiritu (Coro) 3:45 12 Benedictus (Solo T) 4:04 50:14 13 Osanna (Coro SATB/SATB) 2:36 Agnus Dei 14 Agnus Dei (Solo A) 5:47 15 Dona nobis pacem (Coro SATB) 2:32 51:14 Total time: 101:28 Recorded by Tritonus Musikproduktion GmbH Cover: Max Ackermann: aus Im Garten der Hesperiden Ev. -

Naxos Catalog (May
CONTENTS Foreword by Klaus Heymann . 3 Alphabetical List of Works by Composer . 5 Collections . 95 Alphorn 96 Easy Listening 113 Operetta 125 American Classics 96 Flute 116 Orchestral 125 American Jewish Music 96 Funeral Music 117 Organ 128 Ballet 96 Glass Harmonica 117 Piano 129 Baroque 97 Guitar 117 Russian 131 Bassoon 98 Gypsy 119 Samplers 131 Best Of series 98 Harp 119 Saxophone 132 British Music 101 Harpsichord 120 Timpani 132 Cello 101 Horn 120 Trombone 132 Chamber Music 102 Light Classics 120 Tuba 133 Chill With 102 Lute 121 Trumpet 133 Christmas 103 Music for Meditation 121 Viennese 133 Cinema Classics 105 Oboe 121 Violin 133 Clarinet 109 Ondes Martenot 122 Vocal and Choral 134 Early Music 109 Operatic 122 Wedding Music 137 Wind 137 Naxos Historical . 138 Naxos Nostalgia . 152 Naxos Jazz Legends . 154 Naxos Musicals . 156 Naxos Blues Legends . 156 Naxos Folk Legends . 156 Naxos Gospel Legends . 156 Naxos Jazz . 157 Naxos World . 158 Naxos Educational . 158 Naxos Super Audio CD . 159 Naxos DVD Audio . 160 Naxos DVD . 160 List of Naxos Distributors . 161 Naxos Website: www.naxos.com Symbols used in this catalogue # New release not listed in 2005 Catalogue $ Recording scheduled to be released before 31 March, 2006 † Please note that not all titles are available in all territories. Check with your local distributor for availability. 2 Also available on Mini-Disc (MD)(7.XXXXXX) Reviews and Ratings Over the years, Naxos recordings have received outstanding critical acclaim in virtually every specialized and general-interest publication around the world. In this catalogue we are only listing ratings which summarize a more detailed review in a single number or a single rating. -

77Th Baldwin-Wallace College Bach Festival
Baldwin-Wallace College Bach Festival Celebrating 77 years of exceptional music The Oldest Collegiate Bach Festival in the Nation Annotated Program April 17–19, 2009 OUR SPONSORS The Adrianne and Robert Andrews Bach Festival Fund in honor of Amelia & Elias Fadil neighborhoods and are vital to our children’s success. To learn more, visit www.cacgrants.org. On the cover: The Kulas Musical Arts Building in the 1940s. SEVENTY -SEVENTH ANNU A L BACH FESTIVAL THE OLDEST CO LLEGIATE BACH FESTIVAL IN THE NATI O N Annotated Program APRIL 17–19, 2009 #BMEXJO8BMMBDF$PMMFHF Baldwin-Wallace College, founded in 1845, was among the first colleges to admit students without regard to race or gender. That spirit of inclusiveness and innovation has flourished and evolved into a personalize approach to education: one that stresses individual growth as students learn to learn, respond to new ideas, adapt to new situations and prepare for the certainty of change. An independent, coeducational college affiliated with the United Methodist Church, B-W enrolls 3,000 undergraduate students as well as 600 part- time evening/weekend and 800 graduate students. The average undergraduate class size is 19. %JTUJODUJWFMZ#8 Baldwin-Wallace is one of the few liberal arts colleges in the nation l The College regularly appears 2VJDLUP*OOPWBUF with an internationally respected among “America’s Best Colleges” l Conservatory of Music. It also (in the category of Regional B-W was one of the first colleges is recognized as one of the early Universities) and “Best Values” in in the country to endow a chair leaders of adult education, having the annual survey of U.S. -

Kirchenmusik Evangelische Kirche Zum Erlöser - Konstantin-Basilika Januar Bis Juni 2018
Kirchenmusik Evangelische Kirche zum Erlöser - Konstantin-Basilika Januar bis Juni 2018 1 I EDITORIAL SEITE 3 ÜBERSICHT JANUAR – JUNI 2018 SEITE 4 VERANSTALTUNGEN SEITE 5 MUSIKALISCH GESTALTETE GOTTESDIENSTE SEITE 20 IHRE HILFE ZÄHLT SEITE 22 CD-EINSPIELUNGEN SEITE 23 DISPOSITION DER SCHUKE-ORGEL SEITE 24 DISPOSITION DER EULE-ORGEL SEITE 25 AUF EINEN BLICK SEITE 26 Kirchenmusik Evangelische Kirche zum Erlöser – Konstantin-Basilika Januar bis Juni 2018 Bildnachweise: Roland Halbe Fotografie / Evangelische Kirchengemeinde Trier / ekkt.de Der Abdruck des übrigen Bildmaterials erfolgt mit Einwilligung der jeweiligen Interpreten und Ensembles. 2 E Sehr geehrte Freundinnen und Freunde der Kirchenmusik, vielen Dank für Ihr Interesse an den kirchenmusi- kalischen Veranstaltungen des Jahres 2018 in der Ev. Kirchengemeinde Trier. Diese sind von großer Vielfalt geprägt und reichen von musikalisch be- sonders gestalteten Gottesdiensten durch unsere gemeindlichen Gruppen (Caspar-Olevian-Chor, Kinderchor, Posaunenchor, Blockfl ötenkreis) über Kammerkonzerte und Chorkonzerte des Trierer Bachchores bis zu zahlreichen Orgelkonzerten. Die seit dem Reformationstag 2016 monatlich stattfi ndende Reihe von Evensongs wird im Jahr 2018 fortgesetzt, ebenso die samstäglichen Orgelvespern. Mit der selten zu hörenden, konzeptionell sehr interessanten und ausgesprochen klangschönen „Lukas-Passion (1728)“ von Georg Philipp Telemann sowie einer festlichen Bach-Kantate am Ostersonntag wird die diesjährige Passi- ons- und Osterzeit kirchenmusikalisch besonders ausgestaltet. Die Konzerte des Int. Orgelsommers 2018 fi nden Sie im zweiten Halbjahrespro- gramm, welches ab Ende Juni in der Basilika verfügbar sein wird. Im Namen des Presbyteriums der Ev. Kirchengemeinde Trier und auch ganz per- sönlich lade ich Sie herzlich ein, teilzunehmen am kirchenmusikalischen Leben in der Ev. Kirche zum Erlöser, der Konstantin-Basilika – als Gottesdienst- oder Kon- zertbesucher oder als aktiv Mitwirkende in einem unserer Ensembles. -

Ullmann, Marcus Tenor
Ullmann, Marcus Tenor Biografie deutsch Marcus Ullmann wurde in Olbernhau, in der Nahe von Dresden geboren. Er kam als Knabe im Dresdner Kreuzchor schon frühzeitig mit Musik in Berührung, studierte auch in Dresden an der Musikhochschule bei Hartmut Zabel, später bei Margret Trappe-Wiel, sowie in Berlin bei Dietrich Fischer-Dieskau. Nach seinem Studium, das er in den Bereichen Lied, Konzert und Oper mit Auszeichnung abschloss, war er an verschiedenen Opernbühnen Deutschlands tätig und widmete sich gleichzeitig dem Konzert- und Liedgesang, dem er nach und nach immer mehr Platz einräumte. So kam es auch vor allem auf diesem Gebiet zu Auftritten bei der Salzburger Mozartwoche, der Schubertiade Feldkirch, dem Festival Oude Musik Utrecht, der Settimane Bach Mailand, dem Prager Frühling, den Dresdner Musikfestspielen, dem Bachfest Leipzig und dem Savonlinna Festival in Finnland, um nur einige zu nennen. Er konzertierte mit zahlreichen renommierten Orchestern, wie dem Washington Symphony Orchestra, dem Houston Philharmonic Orchestra, dem Israel Philharmonic Orchestra, der Dresdner Staatskapelle, den Münchner Philharmonikern, dem Gewandhausorchester Leipzig, unter Dirigenten wie Helmuth Rilling, Jesus Lopez Cobos, Sylvain Cambreling, Marcus Creed, Enoch zu Guttenberg, Karl-Friedrich Beringer, Ivor Bolton, Kent Nagano, Sir Neville Mariner und nicht zuletzt auch Peter Schreier, mit dem ihn eine besonders enge Zusammenarbeit verbindet. Unter seinen zahlreichen CD-Einspielungen sind besonders die As-Dur-Messe von Schubert unter Peter Schreier, das Mozart-Requiem unter Frieder Bernius sowie das Weihnachtsoratorium von Bach unter Helmuth Rilling hervorzuheben. Im Februar 2001 gab er sein Debüt mit zwei Liederabenden (Alexander Schmalcz, Klavier) in der Master Serie der Wigmore Hall London und sang das erste Mal bei den Salzburger Festspielen im Juli unter Ivor Bolton. -

Diskografie Des Gewandhausorchesters Leipzig Bach, Johann Sebastian B B
Diskografie des Gewandhausorchesters Leipzig Bach, Johann Sebastian B B Bach, Johann Sebastian u "Kommt, ihr Töchter, helft mir klagen" aus der Matthäuspassion BWV 244 Rudolf + Erhard Mauersberger Annelies Burmeister Dresdner Kreuzchor Thomanerchor Leipzig Aufnahmejahr: 1970; Art: 0182592ART, Stereo, DDD u Brandenburgische Konzerte BWV 1046-1051 Riccardo Chailly Aufnahmejahr: 2007; DECCA: 4782191, Stereo, DDD u Johannes-Passion BWV 245 Günther Ramin Agnes Giebel Ernst Häflinger Marga Höffgen Hans-Olaf Hudemann Franz Kelch Thomanerchor Leipzig Aufnahmejahr: 1954; Leipzig Classics: 0032912BC, Mono, ADD Hans-Joachim Rotzsch Theo Adam Arleen Augèr Siegfried Lorenz Heidi Rieß Peter Schreier Thomanerchor Leipzig Armin Ude Aufnahmejahr: 1975+1976; RCA Classics: 74321491812, Stereo, ADD Georg Christoph Biller Henryk Böhm Ruth Holton Matthias Rexroth Gotthold Schwarz Thomanerchor Leipzig Marcus Ullmann Aufnahmejahr: 2007; Rondeau: ROP4024-25, Stereo, DDD © Thomas Tauber (www.tauber-leipzig.de) - 05.05.2021 Seite 2 Bach, Johann Sebastian B u Kantate BWV 1 "Wie schön leuchtet der Morgenstern" Georg Christoph Biller Christoph Genz Gotthold Schwarz Thomaner (1) Thomanerchor Leipzig Aufnahmejahr: 2010; Rondeau: ROP4046, Stereo, DDD u Kantate BWV 3 "Ach Gott, wie manches Herzeleid" Georg Christoph Biller Martin Petzold Gotthold Schwarz Thomaner (2) Thomanerchor Leipzig Aufnahmejahr: 2009; Rondeau: ROP4046, Stereo, DDD u Kantate BWV 4 "Christ lag in Todesbanden" Günther Ramin Karl Richter Thomanerchor Leipzig Ekkehard Tietze Aufnahmejahr: 1950 (??); -

Mozart US 25/11/05 1:19 Pm Page 12
557728bk Mozart US 25/11/05 1:19 pm Page 12 Tu suscipe pro animabus illis, accept these for those souls quarum hodie memoriam facimus whose memory we recall today: fac eas, Domine, de morte transire ad vitam, make them, Lord, cross from death to life. MOZART quam olim Abrahae promisisti as you once promised to Abraham et semini ejus. and his seed. # V. Sanctus (Chorus) # V. Holy, holy, holy (Chorus) Requiem Sanctus, sanctus, sanctus Dominus Deus Sabaoth, Holy, holy, holy Lord God of Sabaoth. pleni sunt coeli et terra gloria tua. Heaven and earth are full of your glory. Osanna in excelsis. Hosanna in the highest. Allan • Buter • Ullmann • Snell $ VI. Benedictus (Soloists & Chorus) $ VI. Blessed is he (Soloists and Chorus) GewandhausKammerchor Benedictus, qui venit in nomine Domini. Blessed is he who comes in the name of the Lord. Osanna in excelsis. Hosanna in the highest. Leipziger Kammerorchester % VII. Agnus Dei (Chorus) % VII. Lamb of God (Chorus) Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, Lamb of God, that takes away the sins of the Morten Schuldt-Jensen dona eis requiem. world, grant them rest. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, Lamb of God, that takes away the sins of the dona eis requiem sempiternam. world, grant them eternal rest. VIII. Communio VIII. Communion ^ Lux Aeterna (Soprano and Chorus) ^ Let eternal light (Soprano and Chorus) Lux aeterna luceat eis, Domine, Let eternal light shine upon them, O Lord, cum sanctis tuis in aeternum, with your saints for ever, quia pius es. for you are merciful. Requiem aeternam dona eis, Eternal rest grant to them, O Lord, Domine, et lux perpetua luceat eis and let perpetual light shine upon them, cum sanctis tuis in aeternum. -

Johann Sebastian Bach Johannes-Passion BWV 245
Thomanerchor Leipzig Johann Sebastian Bach Johannes-Passion BWV 245 Thomanerchor Leipzig Gewandhausorchester Ruth Holton · Matthias Rexroth · Marcus Ullmann Gotthold Schwarz · Henryk Böhm Thomaskantor Georg Christoph Biller Johann Sebastian Bach * 21.3.1685, Eisenach; † 28.7.1750, Leipzig 1723–1750 Thomaskantor – Thomas Cantor Johannes-Passion St. John Passion BWV 245 Thomanerchor Leipzig St. Thomas’s Boys Choir Leipzig Gewandhausorchester Gewandhaus Orchestra Ruth Holton Soprano Matthias Rexroth Altus Marcus Ullmann Tenore Porträt von Gotthold Schwarz Basso Johann Sebastian Bach; Henryk Böhm Basso Gemälde (1746) von Elias Gottlob Haußmann Georg Christoph Biller (1695–1774) Thomaskantor – Thomas Cantor Portrait of Johann Sebastian Bach; made in 1746 by Elias Gottlob Haussmann (1695–1774) ROP4024/25 , 2007 Compact Disc 1 .................................................................................................................. 33:54 9 9. Aria Ich folge dir gleichfalls, mein Heiland, mit Freuden ............................ 3:51 Sopran Flauto traverso I/II, Basso continuo 1 1. Coro Herr, unser Herrscher ............................................................................... 8:18 10 10. Recitativo Derselbe Jünger war dem Hohenpriester bekannt .............................. 3:12 Chor Flauto traverso I/II, Oboe I/II, Violino I/II, Viola, Basso continuo Evangelist, Magd, Basso continuo Petrus, Jesus, Diener 2 Recitativo ................................................................................................................... -
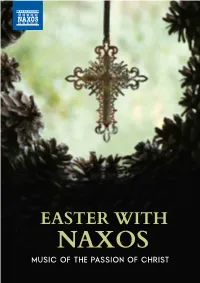
EASTER with NAXOS MUSIC of the PASSION of CHRIST Easter with Naxos
EASTER WITH NAXOS MUSIC OF THE PASSION OF CHRIST Easter with Naxos The events of Christ’s Passion have been marked in artistic triumphs over the centuries, not least in music which has a treasure trove of works devoted to the sequence of the action. Just as the Easter story moves from darkness to light, so the works describing it represent the full spectrum of genres and resources. In this catalogue – which also includes titles from Naxos’ affiliated labels – you’ll find masterpieces representative of all musical styles: from Bach’s Passion settings to the Requiems of Mozart, Dvořák and Verdi, plus the more contemporary utterances of works. You’ll also see recordings of instrumental music, such as Messiaen’s L’Ascension, Gubaidulina’s Sieben Worte, and Haydn’s Seven Last Words in its piano version. CONTENTS Naxos Titles Listing by Composer...................................................................................................3 Collections ................................................................................................................15 Audiovisual Products ................................................................................................16 Affiliated Labels Belvedere .................................................................................................................17 Capriccio ..................................................................................................................18 Dynamic ...................................................................................................................23 -

2009, Layout 1
Marcus Ullmann, Tenor ________________________________________________________________________________ Der lyrische Tenor Marcus Ullmann stammt aus Dresden und erhielt seine ers- te musikalische Ausbildung als Chorknabe des berühmten Dresdner Kreuzcho- res. Er studierte zunächst in Dresden bei Hartmut Zabel und Margret Trappe- Wiel, und ging anschließend nach Berlin zu Dietrich Fischer-Dieskau und nach Karlsruhe zu Marga Schiml. Nach seinem Studium, das er in den Bereichen Lied, Konzert und Oper mit Auszeichnung abschloss, führten ihn Gastengagements an das Staatstheater Mainz, die Semperoper Dresden, des weiteren an das Teatro la Fenice, das Teatro dell'Opera di Roma, das Teatro Comunale Firenze und an die Los Ange- les Opera, wo er große Erfolge mit verschiedenen Mozartpartien, mit Haydns "Schöpfung" und "Jahreszeiten", sowie Bachs "Johannespassion" und "h-moll- Messe" feierte. Er konzertierte in allen wichtigen Musikzentren Europas, Nord- und Südameri- ka und Japans. Regelmäßig ist er unter den Dirigenten Frieder Bernius, Ivor Bolton, Marcus Creed, Enoch zu Guttenberg, Martin Haselböck, Christoph Pop- pen, Hans-Christoph Rademann, Helmuth Rilling und Peter Schreier zu hören. Daneben ist er häufig beim Dresdner Kreuzchor, dem Windsbacher Knaben- chor und dem Thomanerchor Leipzig zu Gast. Marcus Ullmann gab Liederabende bei vielen verschiedenen Kammermusikfes- tivals, so in Kuhmo und Moritzburg, wie auch im Rahmen des West Cork Chamber Music Festivals, der Schubertiade Schwarzenberg und des Europäi- schen Musikfestes Stuttgart. Mit namhaften Pianisten musizierte er ebenfalls in der Wigmore Hall London, im Concertgebouw Amsterdam, im Opernhaus Kairo und in Tokyo. Eine besonders intensive Zusammenarbeit verbindet ihn derzeit vor allem mit Martin Stadtfeld, Alexander Schmalcz und Camillo Radi- cke. Zahlreiche Rundfunk- und Fernsehmitschnitte, sowie eine umfangreiche Diskographie belegen die Vielseitigkeit des außergewöhnlichen Tenors.