Die Gemeindewappen Des Bezirks Zurzach
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

Ordonnance Sur La Protection Des Sites De Reproduction De Batraciens D
451.34 Ordonnance sur la protection des sites de reproduction de batraciens d’importance nationale (Ordonnance sur les batraciens, OBat) du 15 juin 2001 (Etat le 1er janvier 2014) Le Conseil fédéral suisse, vu l’art. 18a, al. 1 et 3, de la loi fédérale du 1er juillet 1966 sur la protection de la nature et du paysage (LPN)1, arrête: Art. 1 Inventaire fédéral 1 L’inventaire fédéral des sites de reproduction de batraciens d’importance nationale (inventaire des sites de reproduction de batraciens) comprend les objets énumérés dans les annexes 1 et 2. 2 L’annexe 1 comprend les objets fixes, l’annexe 2 les objets itinérants. Art. 2 Objets fixes Les objets fixes comprennent le plan d’eau de reproduction et des surfaces naturelles et quasi naturelles attenantes (secteur A) ainsi que d’autres habitats terrestres et cor- ridors de migration des batraciens (secteur B). Les secteurs A et B sont précisés si nécessaire dans la description des objets (annexe 3). Art. 3 Objets itinérants 1 Les objets itinérants comprennent des zones d’exploitation de matières premières, en particulier des gravières et des carrières d’argile et de pierres, incluant des plans d’eau de reproduction dont l’emplacement peut se modifier au cours du temps. 2 Si les plans d’eau de reproduction ne peuvent plus être déplacés, le Département fédéral de l’environnement, des transports, de l’énergie et de la communication (DETEC) propose au Conseil fédéral que l’objet itinérant soit: a. remplacé par un nouvel objet itinérant équivalent; b. désigné comme objet fixe, ou c. -

Landschaftsqualitätsprojekt LQP Gemeindeverband Zurzibietregio
Landschaftsqualitätsprojekt LQP Gemeindeverband ZurzibietRegio Projektbericht 30. September 2015 / Version: 11. April 2016 (vom Bund bewilligt mit Auflagen, 19.01.2016) Trägerschaft: Gemeindeverband ZurzibietRegio Unterstützung: Kanton Aargau; Landwirtschaft Aargau / Abteilung Landschaft und Gewässer Projektverfasser: creato, Genossenschaft für kreative Umweltplanung, Ennetbaden creato Genossenschaft für kreative Umweltplanung Limmat auw eg 9 5408 Ennet baden 056 203 40 30 Trägerschaft Gemeindeverband ZurzibietRegio Peter Nyffeler, Vorstand ZurzibietRegio und Vorsitz Landschaftskommission Zurzibiet Regio, Rathaus, 5330 Bad Zurzach [email protected] / 056 249 170 08 Begleitpersonen Kanton Departement Bau, Verkehr und Umwelt Abteilung Landschaft und Gewässer ALG, Sektion Natur und Landschaft Sebastian Meyer Departement Finanzen und Ressourcen Landwirtschaft Aargau, Direktzahlungen & Beiträge Louis Schneider Auftragnehmer creato Genossenschaft für kreative Umweltplanung Felix Naef / Emil Hänni Limmatauweg 9, 5408 Ennetbaden [email protected] / 056 442 04 11 Abkürzungen BDB: Biodiversitätsbeiträge BFF: Biodiversitätsförderflächen BLW: Bundesamt für Landwirtschaft DZV: Direktzahlungsverordnung des Bundesrates Labiola: Kantonales Programm und Richtlinie für Bewirtschaftungsverträge Landwirtschaft – Biodiversität – Landschaft LaKo: Landschaftskommission, Arbeitsgruppe o.ä. LBV: Landwirtschaftliche Begriffsverordnung des Bundesrates LEP: Landschafts-Entwicklungs-Programm LN: Landwirtschaftliche Nutzfläche LQ: Landschaftsqualität LQB: Landschaftsqualitätsbeiträge -

Schwerpunkt Köhlerfest Wislikofen 06/2019
06/2019 Baldingen Böbikon Kaiserstuhl Mellikon Rekingen Rümikon Wislikofen www.verwaltung2000.ch schwerpunkt Köhlerfest Wislikofen 06/2019 impressum. Auflage 1320 Herausgeber Verwaltung2000 Redaktion Gemeindeschreiber Verwaltung2000 Druck Druckerei Bürli Döttingen Papier FSC Fotos Verwaltung2000 Erscheinung Der Strichpunkt wird elf Tage nach Redaktionsschluss per Post an die Haushaltungen verteilt. Das Mitteilungsblatt «Strichpunkt» erscheint mit 9 bis 10 Nummern jährlich und beinhaltet Informationen der Gemeinden Baldingen, Böbikon, Kaiserstuhl, Mellikon, Rekingen, Rümikon, Wislikofen. Es ist zudem das offizielle Publikationsorgan der Gemeinden Baldingen, Böbikon, Kaiserstuhl und Rümikon. anlieferung der beiträge. Texte als Worddatei abfassen, Bildmaterial als JPG mit 300 dpi Auflösung anliefern. Bitte achten Sie darauf, Ihre Beiträge möglichst kurz zu fassen, die Redaktion behält sich vor, aus Platzgründen Beiträge zu kürzen. redaktionsschluss redaktion. 2019. Gemeindebüro Verwaltung2000 • Ausgabe 07/2019: 16.09.2019 Alte Dorfstrasse 1 • Ausgabe 08/2019: 28.10.2019 5332 Rekingen 056 265 00 30 [email protected] www.verwaltung2000.ch termine. 23.08.2019 Beratung in Rekingen / Böbikon Mütter-Väter-Beratungsstelle Ba / Bö / Me / Re / Rü 23.08.2019 Jugendtreff in Böbikon Jugendtreff Baldingen-Böbikon 23.08.2019 Nostalghia Festival der Stille 24.08.2019 Le fils des étoiles Festival der Stille 23.08.2019 Feierabendtreffen Forstbetrieb Region Kaiserstuhl Forstbetrieb Region Kaiserstuhl 23.08.2019 Jugendtreff in Siglistorf Jugendtreff -

Rümiker Herbstmarkt 2019 Herzlich Willkommen!
07/2019 Baldingen Böbikon Kaiserstuhl Mellikon Rekingen Rümikon Wislikofen www.verwaltung2000.ch RÜMIKER HERBSTMARKT 2019 SAMSTAG, 28. SEPTEMBER 2019 IM WINKEL RÜMIKON 14.00 - 01.00 UHR HERBSTMARKT: 14.00 - 19.00 UHR FLOHMARKT: 14.00 - 19.00 UHR FESTWIRTSCHAFT: 14.00 - 01.00 UHR HERZLICH WILLKOMMEN! schwerpunkt Herbstmarkt Rümikon 07/2019 impressum. Auflage 1320 Herausgeber Verwaltung2000 Redaktion Gemeindeschreiber Verwaltung2000 Druck Druckerei Bürli Döttingen Papier FSC Fotos Verwaltung2000 Erscheinung Der Strichpunkt wird elf Tage nach Redaktionsschluss per Post an die Haushaltungen verteilt. Das Mitteilungsblatt «Strichpunkt» erscheint mit 9 bis 10 Nummern jährlich und beinhaltet Informationen der Gemeinden Baldingen, Böbikon, Kaiserstuhl, Mellikon, Rekingen, Rümikon, Wislikofen. Es ist zudem das offizielle Publikationsorgan der Gemeinden Baldingen, Böbikon, Kaiserstuhl und Rümikon. anlieferung der beiträge. Texte als Worddatei abfassen, Bildmaterial als JPG mit 300 dpi Auflösung anliefern. Bitte achten Sie darauf, Ihre Beiträge möglichst kurz zu fassen, die Redaktion behält sich vor, aus Platzgründen Beiträge zu kürzen. redaktionsschluss redaktion. 2019. Gemeindebüro Verwaltung2000 • Ausgabe 08/2019: 28.10.2019 Alte Dorfstrasse 1 • Ausgabe 09/2019: 13.12.2019 5332 Rekingen 056 265 00 30 [email protected] www.verwaltung2000.ch termine. 27.09.2019 Beratung in Rekingen / Böbikon Mütter-Väter-Beratungsstelle Ba / Bö / Me / Re / Rü 27.09.2019 Jugendtreff in Wislikofen Jugendtreff Raindrops (Me / Rü / Wi) 28. + 29.09.2019 -
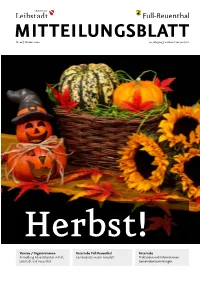
2020-08 Mitteilungsblatt Oktober 2020
MITTEILUNGSBLATT Nr. 08 | Oktober 2020 30. Jahrgang | erscheint 10x pro Jahr Herbst! Vereine / Organisationen Ratsstube Full-Reuenthal Ratsstube Anmeldung Adventsfenster in Full, Gemeinderat wieder komplett Traktanden und Informationen Leibstadt und Reuenthal Gemeindeversammlungen Sehr geehrte Leserinnen und Leser Oh wie ruhig war die Zeit während des Lockdowns. Vorher ein gefüllter Terminkalender und auf einmal wurde es ganz ruhig. Bis auf die Gemeinderatssitzungen und einige Verpflichtungen auf der Gemeinde gab es keine Termine mehr. Jetzt ist wieder alles beim alten. Nicht abgehaltene oder verschobene Sitzungen wer- den nachgeholt und der Terminkalender füllt sich wieder. Es wird auch schon wieder schwierig, einen gemeinsamen Termin zu finden. Ich frage mich, ob die Zeit wirklich schon da ist, trotz Corona bereits wieder Klima- oder Asyldemonstrationen durchzu- führen. Sind die Aktivisten, die Polizei und die Medien wieder unterbelastet? Es gibt aber auch viel Erfreuliches zu berichten, unter anderem konnte die Oberdorf- strasse fertiggestellt werden und ist nun wieder uneingeschränkt befahrbar. Andere Projekte wurden ebenfalls weiter vorangetrieben und ich schätze jeweils die Begeg- nungen und Gespräche mit Ihnen. Nehmen Sie sich etwas Zeit für die schönen Sachen im Leben. Ich wünsche Ihnen eine schöne Herbstzeit. Hanspeter Erne Gemeindeammann Gemeinsame Website Die Gemeinden Leibstadt und Full-Reuenthal planen zusammen einen neuen Internetauftritt. Dabei soll eine gemeinsame «Landing Page» geschaffen werden, in welcher die gemeinsamen Inhalte abgelegt werden mit je einem Abzweiger auf die spezifischen Websites von Leibstadt und Full-Reuenthal. Die Auftragsvergabe ist inzwischen an die Firma Innovative Web AG (i-web) erfolgt. Eine Arbeitsgruppe ist momentan mit der i-web daran, das Projekt zu erarbeiten. Zu einer neuen Website gehören auch ansprechende Fotos. -

Baden Nord 2021 Hoch
Netzplan Region Baden Nord Surbtal, Studenland und Zurzibiet Basel Bad. Bahnhof Schaffhausen Rietheim Bahnhof Waldshut (D) Badstrasse Bahnhof Rietheim Feldblumenweg Rhein Fliederweg Salzstrasse Tulpenweg Parkhotel Uf Raine Koblenz Dorf Bad Zurzach Koblenz 3 Leibstadt 147 563 4 Baslerstrasse 2 1 Koblenz Thermalbad 360 358 Bahnhof RehaClinic Bad Zurzach Bahnhof Turmhotel Klingnau Seesteg Zurzacher Hof 1 Regibad 2 Höfli 358 Rümikon Laufenburg 149 562 3 4 Rümikon AG Mandach 148 Döttingen Promenade Rümikon Schlüsselstrasse Rainächer Bahnhof Schulhaus Brugg 376 Bahnhof Rhein Mellikon riumph 354 355 Oberflecken T Chessel Döttingen Rathaus Tierpark Dachsweg 355 Passhöhe FriedhofRekingen Rekingen Mellikon Wislikofen Döttingen Ochsen Chunte Rekingen Dorf Tegerfelden Dorf Baldingen Wislikofen Fisibach 353 360 Mellstorf PSI West Bachstrasse 358 Hochbrücke Dorf Fisibach 357 Schulhaus 376 Tegerfelden Kirche dorf dorf 562 Siglistorf Würenlingen 354 PSI Ost Post 565 Böbikon Gemeindehaus Unterendingen Dorf Kaiserstuhl AG Bären 352 Siglistorf Siglistorf Altersheim Endingen Zentrum Bahnhof Sonne Oberdorf BöbikonBöbikon Schulhaus Dorfplatz Endingen Baldingen ObeBaldingenr Unter Kuhgässli Breite- Stumpen Endingen Baldingen Mitteldorf Kaiserstuhl Lochacker Bülach Gemeindehaus Gewerbegebiet 515 Brugg 360 Weissen- Würenlingen 355 stein Schöntal Israelitischer 352 565 Untersiggenthal Friedhof 353 Kreuzhof Kirchdorf Unterlengnau 357 eiber Schneisingen Siggenthal- 565 Würenlingen Dorf Lengnau Schneisingen Schneisingen Bahnhof Untersiggenthal Mühleweg Landstrasse -

Teilprojekt Prüfung Zusammenschluss Der Gemeinden Bad Zurzach, Baldingen, Böbikon, Fisibach, Kaiserstuhl, Mellikon, Rekingen, Rietheim, Rümikon, Wislikofen
Begegnung mit der Bevölkerung 2 Rheintal+; Teilprojekt Prüfung Zusammenschluss der Gemeinden Bad Zurzach, Baldingen, Böbikon, Fisibach, Kaiserstuhl, Mellikon, Rekingen, Rietheim, Rümikon, Wislikofen © Copyright by JC Kleiner GmbH Projektorganisation © Copyright by JC Kleiner GmbH Homepage www.rheintalplus.ch Umfrage bei der Bevölkerung Anzahl Einwohner und Beschäftigte Ein- Ein- Entwick- pro Beschäf- wohner wohner lung Jahr tige 2014 2007 2017 2007-2017 2007-2017 Bad 4’058 4’284 + 226 + 0.5% 3’209 Zurzach Baldingen 275 261 - 14 - 0.5% 44 Böbikon 185 174 - 11 - 0.5% 67 Fisibach 369 480 + 111 + 2.7% 117 Kaiserstuhl 404 422 + 18 + 0.4% 117 Mellikon 257 234 - 23 - 0.8% 110 Rekingen 959 929 - 30 - 0.3% 373 Rietheim 705 756 + 51 + 0.7% 144 Rümikon 200 323 + 123 + 5.6% 69 Wislikofen 331 341 + 10 + 0.3% 151 Total 7‘743 8‘204 + 461 + 0.54% 4‘401 Behörden und Verwaltung Gemeindeversammlung versus Einwohnerrat Gemeindeversammlung + Mitspracherecht / direkte Demokratie + Informationen direkt vom Gemeinderat + Gemeinderat spürt den Puls der Bevölkerung - Gefahr einer tiefen Stimmbeteiligung Gemeindeversammlung versus Einwohnerrat Einwohnerrat + Wachsendes Interesse, mögliche Plattform für Politnachwuchs - Abschwächung direkte Demokratie - Verlust der Gemeindeversammlung - Hohe Kosten (+ ca. 300’000.-) Gemeindeversammlung versus Einwohnerrat Haltung und Argumentation der Facharbeitsgruppe 1 (FAG1) Die FAG1 hält nach einer ausführlichen Chancen- und Risikoanalyse ganz klar an der Organisation mit Gemeindeversammlung fest. Dörferrat - Gesetzliche Vorgaben nicht ideal - Ausstattung mit Kompetenzen schwierig - Wahl durch Einwohner der Ortsteile nicht möglich - Nicht praxistauglich Haltung und Argumentation der FAG 1 Die ursprünglich erhofften Auswirkungen eines Dörferrates sind aufgrund der gesetzlichen Vor- gaben nicht sinnvoll umsetzbar. Die FAG1 spricht sich daher gegen die Einfüh- rung eines Dörferrates aus. -

Amtliches Gemeindeverzeichnis Der Schweiz Liste Officielle Des Communes De La Suisse Elenco Ufficiale Dei Comuni Della Svizzera
Amtliches Gemeindeverzeichnis der Schweiz Ausgabe 2006 Liste officielle des communes de la Suisse Edition 2006 Elenco ufficiale dei Comuni della Svizzera Edizione 2006 Bundesamt für Statistik BFS Office fédéral de la statistique OFS Ufficio federale di statistica UST Neuchâtel, 2006 Die vom Bundesamt für Statistik (BFS) La série «Statistique de la Suisse» publiée herausgegebene Reihe «Statistik der Schweiz» par l’Office fédéral de la statistique (OFS) gliedert sich in folgende Fachbereiche: couvre les domaines suivants: 0 Statistische Grundlagen und Übersichten 0 Bases statistiques et produits généraux 1 Bevölkerung 1 Population 2 Raum und Umwelt 2 Espace et environnement 3 Arbeit und Erwerb 3 Vie active et rémunération du travail 4 Volkswirtschaft 4 Economie nationale 5 Preise 5 Prix 6 Industrie und Dienstleistungen 6 Industrie et services 7 Land- und Forstwirtschaft 7 Agriculture et sylviculture 8 Energie 8 Energie 9 Bau- und Wohnungswesen 9 Construction et logement 10 Tourismus 10 Tourisme 11 Verkehr und Nachrichtenwesen 11 Transports et communications 12 Geld, Banken, Versicherungen 12 Monnaie, banques, assurances 13 Soziale Sicherheit 13 Protection sociale 14 Gesundheit 14 Santé 15 Bildung und Wissenschaft 15 Education et science 16 Kultur, Informationsgesellschaft, Sport 16 Culture, société de l’information, sport 17 Politik 17 Politique 18 Öffentliche Verwaltung und Finanzen 18 Administration et finances publiques 19 Kriminalität und Strafrecht 19 Criminalité et droit pénal 20 Wirtschaftliche und soziale Situation 20 Situation économique -

VERZEICHNIS DER GEMEINDE- UND KIRCHENSTEUERFÜSSE Für Das Jahr 2019 (Steuerfuss Kanton 112 %)
DEPARTEMENT FINANZEN UND RESSOURCEN Kantonales Steueramt 11. Juni 2019 VERZEICHNIS DER GEMEINDE- UND KIRCHENSTEUERFÜSSE für das Jahr 2019 (Steuerfuss Kanton 112 %) Gemeinde Steuerfuss Kirche Kirche Kirche Kirche 1 Kirche 2 ev.-ref. röm.-kt. christ-kt. Aarau 97 15 18 23 20 Aarburg 121 25 19 18 Abtwil 115 17 20 23 Ammerswil 105 18 19 23 Aristau 109 17 23 23 Arni (AG) 86 14 13 22 Auenstein 93 20 19 22 Auw 108 17 19 23 Bad Zurzach 115 23 25 22 Baden 92 18 18 22 Baldingen 107 19 28 22 Beinwil (Freiamt) 103 17 26 23 Beinwil am See 102 18 17 23 Bellikon 89 20 20 22 Bergdietikon 87 15 17 22 Berikon 89 20 17 22 Besenbüren 113 17 27 23 Bettwil 107 16 22 23 Gemeinde Steuerfuss Kirche Kirche Kirche Kirche 1 Kirche 2 ev.-ref. röm.-kt. christ-kt. Biberstein 92 15 18 23 Birmenstorf (AG) 94 21 20 22 Birr 117 19 20 22 Birrhard 115 19 20 22 Birrwil 90 21 17 23 Böbikon 112 23 28 22 Boniswil 107 16 19 23 Boswil 101 17 20 23 21 Bottenwil 116 17 18 18 Böttstein 102 21 21 22 23 Bözberg 96 20 20 22 25 Bözen 118 23 25 22 Bremgarten (AG) 94 20 23 22 23 Brittnau 119 21 18 18 Brugg 97 16 20 22 16 19 Brunegg 99 19 19 23 Buchs (AG) 108 20 18 23 Bünzen 110 17 27 23 Burg (AG) 122 21 17 23 Büttikon 96 18 18 23 Buttwil 102 17 21 23 Densbüren 117 23 18 23 Dietwil 104 17 23 23 Dintikon 98 18 18 23 Dottikon 97 18 20 23 Döttingen 110 21 21 22 2 von 9 Gemeinde Steuerfuss Kirche Kirche Kirche Kirche 1 Kirche 2 ev.-ref. -

Protokoll Der Einwohnergemeindeversammlung Vom Freitag, 18
G E M E I N D E M E L L I K O N Protokoll der Einwohnergemeindeversammlung vom Freitag, 18. November 2016, 20.00 bis 20.55 Uhr im Mehrzweckgebäude Mellikon Vorsitz: Rolf Laube, Gemeindeammann Protokoll: Karin Engel, Gemeindeschreiberin Stimmenzähler: Jacques Fuchs und Mary Scherrer Zahl der Stimmberechtigten: 170 Anwesend: 36 Sämtliche Beschlüsse, welche mit weniger als 34 Stimmen gefasst werden, unterstehen dem fakultativen Referendum. Gemeindeammann Rolf Laube: Henri Frédéric Amiel, ein Schweizer Philosoph, sagte einmal: „Wer absolute Klarheit will, bevor er einen Entschluss fasst, wird sich nie entschliessen.“ Mit diesem kleinen Gedankenanstoss möchte ich euch im Namen des Gemeinderates, der Ge- meindeschreiberin Karin Engel und der Leiterin Finanzen Eliane Keller herzlich begrüssen zur diesjährigen Wintergemeindeversammlung. Heute Abend muss ich Gemeinderat Hansruedi Anderfuhren entschuldigen. Der Vorsitzende stellt fest, dass die Unterlagen den Stimmberechtigten rechtzeitig zugestellt worden sind und die zugehörigen Akten öffentlich aufgelegen haben. Die Traktandenliste ist in der Vorlage für die heutige Versammlung abgedruckt. Die Versammlung wird zu Protokollzwe- cken aufgezeichnet. Seit der letzten Gemeindeversammlung wurden in Mellikon drei Geburten verzeichnet: Am 16. Juni Ari Fuchs, am 23. August Eline Mina Knecht und am 7. November Amanda Noélia Biland. Den stolzen Eltern wird herzlich gratuliert. 382 Freitag, 18. November 2016 Die Traktandenliste enthält folgende Geschäfte: 1. Protokoll 2. Budget 2017 3. Verschiedenes 1 011.70 EGV, Traktandenliste, Vorlage für Gemeindeversammlung, Protokol- le, Einladungen Protokoll Gemeindeammann Rolf Laube: Das Protokoll konnte in der Aktenauflage und auf der Homepa- ge eingesehen oder in Papierform beim Gemeindebüro in Rekingen bezogen werden. Gemeindeammann Rolf Laube bedankt sich bei Gemeindeschreiberin Karin Engel für das Pro- tokoll. -
Tickets & Prices
Tickets & prices Valid from 11.12.2016 to 9.12.2017 GET ON BOARD. GET AHEAD. 3 Networked and interconnected Find your bearings Get in, get around, get there Table of contents The Zürcher Verkehrsverbund (Zurich Transport Network – ZVV) ZVV fares from zone to zone 6 is an umbrella organisation that covers all operators of public ZVV product range 7 transport within the canton of Zurich. “Networked mobility” is the ZVV NetworkPass 8–10 defining credo of ZVV: an interconnecting system of trains, trams, Ticket inspections 11 buses and boats that makes it easy to change from one mode ZVV BonusPass 12 of transport to another when travelling around. A dense route ZVV Annual Travelcard with Mobility 13 network, the regular interval timetable and efficient connecting Day passes 14 services all get you to your destination quickly, safely, punctually Multiple day passes 14/15 and relaxed. Single tickets 16 Multiple-journey tickets 17 Public holidays in the ZVV network area are: Zone upgrades 18 1 and 2 January, Good Friday, Easter Monday, Ascension Day, First-class upgrades 19 Whit Monday, 1 May, 1 August, 25 and 26 December. Local network tickets 20 Short-distance tickets 20 Subject to change. Bicycles on board 21 Special price reductions 22/23 ZVV 9 O’Clock Pass 24–27 Albis day pass 28 ZürichCARD 29 Night supplement 30/31 ZSG boat surcharge 31 Z-Pass 32 For destinations elsewhere in Switzerland 33 National tickets 34 ZVV timetable 35/36 ZVV-Contact, www.zvv.ch 37 ZVV ticket sales locations 38 Ticket machines 39 Screen functions at a glance 40 ZVV -

Jahresbericht Spitalverein Leuggern 2020
Spitalverein Leuggern Jahresbericht 2020 Inhaltsverzeichnis Seite Mitgliederbeiträge 2 Spenden 2 Bericht des Präsidenten Andreas Edelmann 3 Bilanz 4 Erfolgsrechnung 5 Anhang der Jahresrechnung 6 Antrag über die Verwendung des Bilanzgewinnes 8 Veränderungen Fondsvermögen 8 Revisionsbericht 9 Spitalvereinsbehörden 10 Mitgliederbeiträge 2020 Mitgliederbeiträge 579 Mitglieder per 31. 12. 2020 CHF 11 090.00 Spenden 2020 Amstutz Robert, Villigen CHF 80.00 Knecht Sabine, Mellikon CHF 30.00 Kolb Sophie, Mellikon CHF 30.00 Huber Agnes und René, Gippingen CHF 60.00 Meier Hans-Peter, Leuggern CHF 80.00 Schneider Anita, Klingnau CHF 80.00 Vögeli-Kalt Erich, Leuggern CHF 20.00 Saxer Hilde und Jules, Baden CHF 50.00 Leutwyler Edith, Bad Zurzach CHF 10.00 Märki Walter, Leuggern CHF 80.00 Quilez Sonja, Döttingen CHF 30.00 Saladin Maria, Kleindöttingen CHF 30.00 Mühlebach Guido, Bad Zurzach CHF 20.00 Brügger Rolf, Koblenz CHF 20.00 Kalt Peter, Leuggern CHF 30.00 Bächli Heidi, Full CHF 30.00 Baumgartner Eduard, Tegerfelden CHF 10.00 Böhler Regula, Gippingen CHF 30.00 Keller Rudolf, Mandach CHF 30.00 Brachs Kurt, Gippingen CHF 30.00 Baumgartner Heinz, Tegerfelden CHF 80.00 Hügli Gilbert, Full CHF 30.00 Vögele Urs, Kleindöttingen CHF 20.00 Vögele Emma, Hettenschwil CHF 30.00 Zimmermann Yvonne, Klingnau CHF 30.00 Birchmeier Georg, Döttingen CHF 80.00 Mutter Alfred, Kleindöttingen CHF 80.00 Wiederkehr Lidwina und Werner, Rekingen CHF 60.00 Pfaffen Ursula, Frick CHF 30.00 Biedermann Erika, Kleindöttingen CHF 30.00 Merlo Margrit, Leuggern CHF 80.00 Kramer Xaver, Leibstadt CHF 30.00 Für die wertvolle Unterstützung danken wir allen Spenderinnen und Spendern sowie natürlich unseren Mitgliedern recht herzlich.