Luther-Kantate
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-
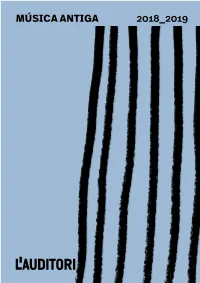
Música Antiga 2018 2019
MÚSICA ANTIGA 2018_2019 La Temporada de Música Antiga proposa, una vegada més, una programació equilibrada que ens portarà a L’Auditori alguns dels millors conjunts i artistes internacionals, les produccions locals de més alta qualitat i projectes amb un component de risc i innovació que els fan únics. Amb tots ells gaudirem de noves i excitants versions dels grans clàssics, descobrirem joies oblidades del repertori antic, coneixerem autors desconeguts fins ara al nostre país i comprovarem la bona salut de la interpretació amb criteris històrics. Els grans conjunts internacionals ompliran, una temporada més, la Sala 1 Pau Casals. La italiana Accademia Bizantina representarà Marc’Antonio e Cleopatra de Johann Adolph Hasse, un dels compositors escènics més importants i reeixits del segle XVIII. Els britànics TEMPORADA 2018_2019 Arcangelo ens portaran el magníficStabat Mater de Giovanni Battista Pergolesi. Els francesos Ensemble Pygmalion, en el seu debut a Barcelona, interpretaran els emocionants motets de Johann Sebastian Bach. I el formidable RIAS Kammerchor alemany ens proposarà un suggeridor programa que combina, en un concert sense precedents, el Rèquiem de Tomás Luis de Victoria i l’estrena mundial del Rèquiem de Bernat Vivancos. Jordi Savall completarà la programació de grans conjunts amb la seva Capella Reial de Catalunya, que es manté, una temporada més, com a grup resident a L’Auditori. Sota el nom d’El So Original, Savall interpretarà obres mestres de grans noms del repertori barroc i clàssic, com són els d’Antonio Vivaldi, Johann Sebastian Bach i Ludwig van Beethoven. Un altre projecte de casa, el Bach Zum Mitsingen, ens aproparà al tresor de les cantates de Johann Sebastian Bach amb la soprano austríaca Miriam Feuersinger i els participants de la Beca Bach. -

Download Booklet
4.K Der Herr lebet Der Herr lebet Der Herr lebet – Kantate zum 1. Ostertag TVWV 1:284 Kantate zum 1. Ostertag Cantata for Easter Day für Sopran, Alt, Bass, Chor, 2 Trompeten, Pauken, Streicher und B.c. Coro Coro 1 Coro (Orchester-Tutti) 2:09 Der Herr lebet und gelobet sei mein Hort, The Lord lives and praised be my refuge, 2 Aria – Basso (Orchester-Tutti) 6:56 der Herr lebet! the Lord lives! 3 Recitativo – Alto (Orgel) 0:44 Und gelobet sei mein Hort, und der Gott And praised be my refuge, and may the 4 Aria – Soprano (Streicher und B.c.) 5:28 meines Heils müsse erhaben werden. God of my salvation be exalted. 5 Coro („Der Anfangsspruch“) 2:12 Aria Aria Nun jauchzet, ihr Himmel! Die Höll ist Now rejoice, ye heavens! Hell is conquered, Ehr und Dank sey Dir gesungen – Kantate zum Michaelisfest TVWV 1:413 bezwungen, for Christ has won and Satan has lost. für Bass, Chor, 2 Trompeten, Pauken, Streicher und B.c. denn Christus gewinnet und Satan verliert. Man’s enemy has suffered loss, now Jesus Der Menschenfeind besteht mit Schanden, has risen from the dead, 6 Choral (Streicher und B.c.) 1:08 weil Jesus davon auferstanden, leading Hell’s kingdom captive. 7 Aria – Basso (Orchester-Tutti) 7:48 das Höllenreich gefangen führt. 8 Recitativo – Basso (Orgel) 0:32 9 Aria – Basso (Orchester-Tutti) 7:16 Recitativo Recitativo bl Choral (Tutti) 1:49 O Heiland, gib auch mir die Kraft zum O Saviour, give me too the power to rise Auferstehn! again! Denn blieb ich noch in Sünden liegen, so For if I lay in sin, I would lose the fruit of Der Geist giebt Zeugnis – Kantate zum 1. -
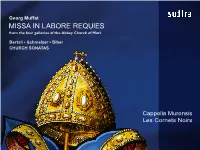
Digibooklet Muffat: Missa in Labore Requies
Georg Muffat MISSA IN LABORE REQUIES from the four galleries of the Abbey Church of Muri Bertali • Schmelzer • Biber CHURCH SONATAS Cappella Murensis Les Cornets Noirs GEORG MUFFAT Missa in labore requies a 24 Kyrie 5:55 Gloria 14:08 Credo 16:26 Sanctus 3:17 Benedictus 2:24 Agnus Dei 3:50 ANTONIO BERTALI Sonata a 13 4:10 HEINRICH IGNAZ FRANZ BIBER Sonata VI a 5 5:13 JOHANN HEINRICH SCHMELZER Sonata XII a 7 4:23 HEINRICH IGNAZ FRANZ BIBER Sonata VIII a 5 5:23 ANTONIO BERTALI Sonata Sancti Placidi a 14 6:10 CAPPELLA MURENSIS Soprano solo: Miriam Feuersinger • Stephanie Petitlaurent Alto solo: Alex Potter • William Purefoy Tenore solo: Hans Jörg Mammel • Manuel Warwitz Basso solo: Markus Flaig • Lisandro Abadie Soprano ripieno: Lia Andres • Penelope Monroe Alice Borciani • Caroline Rilliet Alto ripieno: David Feldman • Bernhard Schafferer Roman Melish • Victor de Souza Soares Tenore ripieno: Cory Knight • Richard Resch Dan Dunkelblum • Michel Mulhauser Basso ripieno: Marcus Niedermeyr • Valerio Zanolli Ismael Arróniz • Erwin Schnider TROMPETENCONSORT INNSBRUCK Tromba: Andreas Lackner • Thomas Steinbrucker Martin Sillaber • Gerd Bachmann • Georg Pranger Timpani: Michael Juen LES CORNETS NOIRS Cornetto/Cornettino: Gebhard David • Bork-Frithjof Smith Trombone: Simen van Mechelen • Detlef Reimers • Fernando Günther Violino: Amandine Beyer • Cosimo Stawiarski Viola da gamba: Brian Franklin • Brigitte Gasser Christoph Prendl • Patrick Sepec Violone in G: Matthias Müller • Tore Eketorp • Leonardo Bortolotto Arciliuto: Matthias Spaeter Organo: Markus Märkl • Tobias Lindner • Michael Behringer David Blunden • Nicoleta Paraschivescu musical director: Johannes Strobl Georg Muffat – Salzburg becomes a European centre of high baroque music When Georg Muffat arrived at the Court of Salzburg in 1678, engaged as court organist by Prince Archbishop Max Gandolph Graf Kuenburg (r. -

NEWSLETTER Editor: Francis Knights
NEWSLETTER Editor: Francis Knights Volume v/1 (Spring 2021) Welcome to the NEMA Newsletter, the online pdf publication for members of the National Early Music Association UK, which appears twice yearly. It is designed to share and circulate information and resources with and between Britain’s regional early music Fora, amateur musicians, professional performers, scholars, instrument makers, early music societies, publishers and retailers. As well as the listings section (including news, obituaries and organizations) there are a number of articles, including work from leading writers, scholars and performers, and reports of events such as festivals and conferences. INDEX Interview with Bruno Turner, Ivan Moody p.3 A painted villanella: In Memoriam H. Colin Slim, Glen Wilson p.9 To tie or not to tie? Editing early keyboard music, Francis Knights p.15 Byrd Bibliography 2019-2020, Richard Turbet p.20 The Historic Record of Vocal Sound (1650-1829), Richard Bethell p.30 Collecting historic guitars, David Jacques p.83 Composer Anniversaries in 2021, John Collins p.87 v2 News & Events News p.94 Obituaries p.94 Societies & Organizations p.95 Musical instrument auctions p.96 Conferences p.97 Obituary: Yvette Adams, Mark Windisch p.98 The NEMA Newsletter is produced twice yearly, in the Spring and Autumn. Contributions are welcomed by the Editor, email [email protected]. Copyright of all contributions remains with the authors, and all opinions expressed are those of the authors, not the publisher. NEMA is a Registered Charity, website http://www.earlymusic.info/nema.php 2 Interview with Bruno Turner Ivan Moody Ivan Moody: How did music begin for you? Bruno Turner: My family was musical. -

Mein Herz, Was Bist Du So Betrübt, Da Dich Doch Gott Durch Christum Liebt?“ AUS „DER FRIEDE SEI MIT DIR“ BWV 158 PROGRAMM
Abonnement Ein Abend mit … Montag 27.01.2020 20.00 Uhr · Kleiner Saal MIRIAM FEUERSINGER Sopran STEPHAN MACLEOD Bariton PETRA MÜLLEJANS Violine ROEL DIELTIENS Violoncello ANDREAS STAIER Cembalo „… Mein Herz, was bist du so betrübt, da dich doch Gott durch Christum liebt?“ AUS „DER FRIEDE SEI MIT DIR“ BWV 158 PROGRAMM Johann Sebastian Bach (1685–1750) Kleines Präludium für Cembalo D-Dur BWV 936 „Der Friede sei mit Dir“ – Kantate BWV 158 REZITATIV „DER FRIEDE SEI MIT DIR“ ARIE MIT CHORAL „WELT, ADE, ICH BIN DEIN MÜDE“ REZITATIV UND ARIOSO „NUN, HERR, REGIERE MEINEN SINN“ CHORAL „HIER IST DAS RECHTE OSTERLAMM“ „Vergiss mein nicht“ – Zwei Geistliche Lieder aus „Schemellis Gesangsbuch“ BWV 505 und BWV 504 „Ich habe genug“ und „Schlummert ein, ihr matten Augen“ – Rezitativ und Arie aus der Kantate „Ich habe genug“ BWV 82 „Komm, süßer Tod“ – Geistliches Lied aus „Schemellis Gesangsbuch“ BWV 478 Sarabande aus der Suite für Violoncello solo c-Moll BWV 1011 „Willkommen will ich sagen, wenn der Tod ans Bette tritt“ – Arie aus der Kantate „Wer weiß, wie nahe mir mein Ende“ BWV 27 „Gib dich zufrieden und sei stille“ – Geistliches Lied aus „Schemellis Gesangsbuch“ BWV 460 Courante aus der Französischen Suite für Cembalo c-Moll BWV 813 „Komm, mein Jesus, und erquicke / Ja, ich komme und erquicke“ – Duett aus der Kantate „Ich hatte viel Bekümmernis“ BWV 21 PAUSE Cantabile, ma un poco Adagio aus der Sonate für Violine und Cembalo G-Dur BWV 1019a „Es kann mir fehlen nimmermehr“ – Rezitativ mit Choral aus der Kantate „Ich hab in Gottes Herz und Sinn“ BWV 92 „Wer nur den lieben Gott lässt walten“ – Choralvorspiel BWV 691 „Das Stürmen von den Winden“ – Arie aus der Kantate „Ich hab in Gottes Herz und Sinn“ BWV 92 „Auch mit gedämpften, schwachen Stimmen“ – Arie aus der Kantate „Schwingt freudig euch empor“ BWV 36 PREMIUMPARTNER Mobiltelefon ausgeschaltet? Vielen Dank! Cell phone turned off? Thank you! Wir machen darauf aufmerksam, dass Ton- und/oder Bildaufnahmen unserer Auf- führungen durch jede Art elektronischer Geräte strikt untersagt sind. -

Musicalische Exequien
BERNVOCAL Leitung: Fritz Krämer bernvocal.ch Heinrich Schütz (1 585–1 672) Musicalische Exequien PROGRAMM Fr 1 3.1 1 .201 5 20.00 Bern, Nydeggkirche Sa 1 4.1 1 .201 5 20.00 Biel, Stadtkirche So 1 5.1 1 .201 5 1 7.00 Fribourg, Couvent des Capucins PRO G RAM M Herr, nun lässest du deinen Diener in Frieden fahren SWV 432 LUKAS 2, 29–32 Das ist je gewisslich wahr SWV 277 1 . TIMOTHEUS 1 , 1 5 Unser Wandel ist im Himmel SWV 390 PHILIPPER 3, 20–21 Herzlich lieb hab ich dich, o Herr SWV 387 [MARTIN SCHALLING] Gutes und Barmherzigkeit werden mir folgen SWV 95 PSALM 23, 6 Michael Praetorius (1 571 –1 621 ): Ballet (aus Terpsichore) Musicalische Exequien I. Konzert in Form einer deutschen Begräbnis-Missa SWV 279 Nacket bin ich von Mutterleibe kommen HIOB 1 , 21 Nacket werde ich wiederum dahin fahren HIOB 1 , 21 Herr Gott, Vater im Himmel [KYRIE I] Christus ist mein Leben PHILIPPER 1 , 21 ; JOHANNES 1 , 29 Jesu Christe, Gottes Sohn [CHRISTE] Leben wir, so leben wir dem Herren RÖMER 1 4, 8 Herr Gott, heiliger Geist [KYRIE II] Also hat Gott die Welt geliebt JOHANNES 3, 1 6 Auf dass alle, die an ihn gläuben JOHANNES 3, 1 6 Er sprach zu seinem lieben Sohn [MARTIN LUTHER 1 523] Das Blut Jesu Christi 1 . JOHANNES 1 , 7 Durch ihn ist uns vergeben [LUDWIG HELMBOLD 1 575] Unser Wandel ist im Himmel PHILIPPER 3, 20–21 Es ist allhier ein Jammertal [JOHANN LEON 1 592–98] Wenn eure Sünde gleich blutrot wäre JESAJA 1 , 1 8 Sein Wort, sein Tauf, sein Nachtmahl [LUDWIG HEMBOLD 1 575] Gehe hin, mein Volk JESAJA 26, 20 Der Gerechten Seelen sind in Gottes Hand WEISHEIT 3, 1 –3 Herr, wenn ich nur dich habe PSALM 73, 25 Wenn mir gleich Leib und Seele verschmacht PSALM 73, 26 Er ist das Heil und selig Licht [MARTIN LUTHER 1 524] Unser Leben währet siebenzig Jahr PSALM 90, 1 0 Ach, wie elend [JOHANNES GIGAS 1 566] Ich weiss, dass mein Erlöser lebt HIOB 1 9, 25–26 Weil du vom Tod erstanden bist [NIKOLAUS HERMAN 1 560] Herr, ich lasse dich nicht 1 . -

Matthäus-Passion
Gründonnerstag, 18. April 2019, 19.30 Uhr Karfreitag, 19. April 2019, 18.00 Uhr Johann Sebastian Bach Matthäus-Passion Miriam Feuersinger, Sopran Margot Oitzinger, Alt Georg Poplutz, Tenor (Evangelist und Arien) Joel Frederiksen, Bass (Jesus) Peter Kooij, Bass Basler Münsterkantorei Capriccio Barockorchester Annedore Neufeld, Leitung Konzert mit Kollekte (Dauer ca. 3 Std., kurzer Unterbruch zwischen den beiden Werk-Teilen) Partitur-Handschrift von Johann Sebastian Bach (ca. 1736) mit Text in roter Tinte für den Evangelisten Quelle: • Hans Conrad Fischer: Johann Sebastian Bach. Sein Leben in Bildern und Dokumenten. Hänssler, Holzgerlingen 2000 Die Matthäus-Passion Die Matthäus-Passion, wie wir sie heute kennen – ein monumentales Werk für Solisten, zwei Chöre und zwei Orchester – stellt einen Höhepunkt protestanti- scher Kirchenmusik dar und zählt zu unseren bedeutendsten Kulturschätzen. Das Werk stellt die Leidensgeschichte Jesu aus dem Matthäus-Evangelium, Kapi- tel 26 und 27, ins Zentrum, also die Ereignisse vom Zeitpunkt des Beschlusses des Hohen Rates, Jesus zu töten (Mt 26,1), über Gefangennahme, Kreuzigung und Tod bis zur Grablegung Christi (Mt 27,66). Bach liess die Passionserzählung des Evangelisten Matthäus von seinem wich- tigsten Librettisten Christian Friedrich Henrici alias Picander mit lyrischen Texten ergänzen. Damit wird die eigentliche Handlung umrahmt vom Prolog, in dem sich zwei Chöre auf dem Weg nach Golgatha fassungslose Klagen zurufen, und dem Epilog «Wir setzen uns mit Tränen nieder» – Trauer und Trost zugleich – nach dem Tode Christi. Wie in antiken Tragödien sind in die eigentliche Passions- geschichte Arien und chorische Einlagen und zusätzlich dreizehn alte, den dama- ligen Kirchgängern geläufige Choräle eingewoben. Bach steigert durch diesen Rahmen die Dramatik und setzt Chöre wie Zuhörer als eigentlich Mitwirkende mitten in den Schauplatz um Jerusalem und den Berg Golgatha hinein. -

22 December 2017 Page 1 of 10
Radio 3 Listings for 16 – 22 December 2017 Page 1 of 10 SATURDAY 16 DECEMBER 2017 5:13 AM Schubert©s last sonata, perhaps his greatest achievement in the Schubert, Franz (1797-1828) form, has a feeling of tranquility and ease - the ease of a SAT 01:00 Through the Night (b09hqkn5) Overture to the opera "Des Teufels Lustschloss" (The Devil©s composer who is relaxed in his ability to express his ideas and Jonathan Swain presents a concert of chamber music by Schubert, Pleasure Palace ) emotions. This sonata was to be Schubert©s last, and the flow and Shostakovich and Dvorak Polish National Radio Symphony Orchestra in Katowice, majesty of the first movement spring from the hymn-like breadth Jonathan Swain presents a concert of chamber music by Schubert, Miroslaw Blaszczyk (conductor) of the opening theme. Shostakovich and Dvorak from the Royal Danish Music Conservatory in Copenhagen 5:23 AM 10.35am Critics' Choice Part 2 Scarlatti, Alessandro (1660-1725) Andrew McGregor and his three guests Natasha Loges, Elin 1:01 AM Toccata per cembalo Manahan Thomas and Andrew Mellor continue to share and Schubert, Franz (1797-1828) Rinaldo Alessandrini (harpsichord, Franciscus Debbonis, Roma discuss the merits of their favourite discs of 2017. Allegro in A minor, D 947, (Lebenssturme) for piano duet 1678) Wu Han (piano), Alessio Bax (piano) LAST LEAF 5:31 AM TRAD. ARR. DANISH STRING QUARTET: Despair Not, O 1:17 AM Urbaitis, Mindaugas (b.1952) Heart; Polska from Dorotea; Minuet No.60; á Rùmeser; Drùmte Shostakovich, Dmitry (1906-1975) Lacrimosa mig en -

Cantates De Bach Miriam Feuersinger
MÚSICA ANTIGA 2018_2019 CANTATES DE BACH MIRIAM FEUERSINGER 20 de gener DE 2019 SALA 2 ORIOL MARTORELL auditori.cat CANTATES DE BACH GENER 2019 MIRIAM FEUERSINGER Diumenge 20 a les 19 h Solistes de la BECA BACH - Fundación Salvat · Ensemble BZM · Miriam Feuersinger, PROGRAMA soprano · Daniel Tarrida, orgue i direcció · Pau Jorquera, direcció JOHANN SEBASTIAN BACH Eisenach 1685 – Leipzig 1750 Du wahrer Gott und Davids Sohn, BWV 23 18’ I. Ària-Duet (soprano, contralt): Du wahrer Gott und Davids Sohn II. Recitatiu (tenor): Ach! gehe nicht vorüber III. Cor: Aller Augen warten, Herr IV. Coral: Christe, du Lamm Gottes Sie werden euch in den Bann tun, BWV 44 18’ I. Ària-Duet (tenor, baix): Sie werden euch in den Bann tun II. Cor: Es Kömmt aber die Zeit III. Ària (contralt): Christen müssen auf der Erden IV. Coral (tenor): Ach Gott, wie manches Herzeleid V. Recitatiu (baix): Es sucht der Antichrist VI. Ària (soprano): Es ist und bleibt der Christen Trost VII. Coral: So sei nun, Seele, deine PAUSA 15’ Mein Herze schwimmt im Blut, BWV 199 25’ I. Recitatiu (soprano): Mein Herze schwimmt im Blut II. Ària-Recitatiu (soprano): Stumme Seufzer, stille Klagen III. Recitatiu (soprano): Doch Gott muss mir genädig sein Els temps i la durada del concert són aproximats i la durada Els temps IV. Ària (soprano): Tief gebückt und voller Reue V. Recitatiu (sorpano): Auf diese Schmerzensreu VI. Coral (soprano): Ich, dein betrübtes Kind VII. Recitatiu (soprano): Ich lege mich in diese Wunden VIII. Ària (soprano): Wie freudig ist mein Herz Weinen, Klagen, Sorgen, Zagen, BWV 12 (2n moviment) 5’ II. -
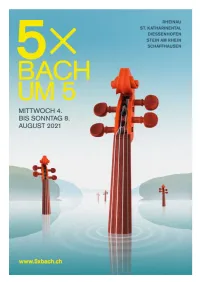
Kantate I (Text: Ab S
Kantate I (Text: ab S. 4) Mi. 4. August 2021, 17.00 Uhr, Klosterkirche Rheinau Johann Sebastian Bach (1685–1750) «Gott ist unsre Zuversicht» BWV 197 Gregorio Allegri (1582–1652) «Miserere» Zürcher Barockorchester Vokalconsort inFlumine Soli (Bach): Miriam Feuersinger, Sopran – Margot Oitzinger, Alt – Peter Kooij, Bass Rezitation (Allegri): Florian Cramer, Tenor Annedore Neufeld, Leitung Kantate II (Text: ab S. 9) Do. 5. August 2021, 17.00 Uhr, Klosterkirche St. Katharinental Johann Sebastian Bach (1685–1750) «Erfreut euch, ihr Herzen» BWV 66 Giovanni Battista Pergolesi (1710–1736) «Domine, ad adiuvandum me festina» Schaffhauser Barockensemble Vokalconsort inFlumine Soli (Bach): Margot Oitzinger, Alt – Georg Poplutz, Tenor – Peter Kooij, Bass Solo (Pergolesi): Mirjam Wernli, Sopran Annedore Neufeld, Leitung Kantate III (Text: ab S. 12) Fr. 6. August 2021, 17.00 Uhr, Stadtkirche Diessenhofen Johann Sebastian Bach (1685–1750) «Ich habe genug» BWV 82 Johann Christoph Graupner (1683–1760) «Furcht und Zagen» GWV 1102 Capricornus Consort Basel Miriam Feuersinger, Sopran 2 Kantate IV (Text: ab S. 15) Sa. 7. August 2021, 17.00 Uhr, Stadtkirche St. Georg Stein am Rhein Johann Sebastian Bach (1685–1750) «Nach dir, Herr, verlanget mich» BWV 150 Giovanni Battista Pergolesi (1710–1736) «Confitebor tibi Domine» Bodensee Barockorchester Vokalconsort inFlumine Soli (Bach): Carmela Konrad, Sopran – Tobias Knaus, Alt – Georg Poplutz, Tenor – Markus Flaig, Bass Soli (Pergolesi): Miriam Feuersinger, Sopran – Barbara Erni, Alt Annedore Neufeld, Leitung Kantate V (Text: ab S. 18) So. 8. August 2021, 17.00 Uhr, St. Johann Schaffhausen Johann Sebastian Bach (1685–1750) «Herz und Mund und Tat und Leben» BWV 147 Johann Christian Bach (1735–1782) «Magnificat» Bodensee Barockorchester Vokalconsort inFlumine Soli (J.S. -

2022 Bachfest
www.bachfestleipzig.de BACH– We Are Family BACHFEST LEIPZIG 09.–19. JUNI 2022 Bachfest der Neuen Bachgesellschaft BACH – We Are FAMILY 2 Festivalhöhepunkte / Festival Highlights 4 Choralkantaten / Chorale Cantatas 20 Buchungsbedingungen / Booking terms and conditions 26 Veranstaltungsorte / Venues 28 Impressum / Imprint 29 BACH – We Are FAMILY Am Anfang stand die Vision, ein Bachfest zu feiern, wie es die weitver- It all began with the dream of holding a Bachfest similar to the kind of zweigte Musikerfamilie Bach einst in Thüringen zu feiern pflegte. celebration the much-ramified Bach family of musicians would once Einmal im Jahr traf sie sich an einem bestimmten Ort, um gemeinsam have held in Thuringia. Once a year, they met at a certain place to feast, zu schmausen, zu singen und zu musizieren. sing and make music. Heute ist die Bach-Familie eine globale. Überall auf der Welt gibt es Today, the Bach family is a global one. All over the world, there are Menschen, die ihre Liebe zu Johann Sebastian Bach gemeinsam leben: people who live out their love of Johann Sebastian Bach together – in in Bach-Chören und Bach-Gesellschaften. Die älteste unter ihnen, Bach choirs and Bach societies. The oldest of all of these, the Neue die Neue Bach-Gesellschaft, feiert 2022 ihr jährliches Bachfest wieder Bach-Gesellschaft, will be celebrating its annual Bach Festival with us mit uns zusammen. again in 2022. Aber um unsere Vision Realität werden zu lassen, haben wir auch alle But to make our dream reality, we have also invited all the other ›family übrigen ›Familienmitglieder‹ nach Leipzig eingeladen, also sämtliche members‹ – that is, all the Bach associations around the globe – to Bach-Vereinigungen, die wir auf dem Globus fanden, über 250 an Leipzig: more than 250 in number. -

TON KOOPMAN DIETERICH BUXTEHUDE Opera Omnia XIX
TON KOOPMAN DIETERICH BUXTEHUDE Opera Omnia XIX pagepage 5656 page 1 CC72258 VOCAL WORKS 9 CCC72258C72258 - Booklet+++.inddBooklet+++.indd SpreadSpread 1 vanvan 2828 - Pagina'sPagina's (56,(56, 1)1) 33-6-14-6-14 115:185:18 In memoriam Bruno ce dont les choeurs, et en particuliers les jeunes choeurs, étaient musicalement capables. Toutes ses Grusnick (1900-1992) publications furent testées avec son “Lübecker Sing- und Spielkreis” avant d’être imprimées. En tant que connaisseur et admirateur de Schütz Après que la guerre et la captivité l’eurent forcé qui était familier avec le répertoire polychoral du de suspendre ses activités, il publia, dans les début de l’époque baroque, Bruno Grusnick vint années 1950, beaucoup de cantates de Buxtehude de Berlin à Lübeck en 1928. Il y découvrit le genius à un rythme rapproché. Grusnick développa à ce loci, Dieterich Buxtehude, dont l’importance moment ses recherches sur la datation des œuvres comme compositeur de musique vocale n’était de la collection de Gustav Düben à Uppsala; il pas encore connue. Encouragé par l’organiste de prépara aussi l’édition des oeuvres de certains cathédrale Wilhelm Stahl et le musicologue André contemporains de Buxtehude. Pirro, il fi t, à partir de 1931, plusieurs voyages à Uppsala. Brûlant d’enthousiasme pour les A l’automne 1986, il fi t son dernier voyage à Uppsala, trésors reposant cachés dans les bibliothèques, il où, une fois encore, il se plongea avec passion dans commença immédiatement à publier les cantates les manuscrits. Dans sa 90ème année il préparait de Buxtehude à un rythme régulier et rapide, encore la publication d’une partition de la cantate conjointement avec quelques concertos du grand Nun danket alle Gott de Buxtehude.