Gegen Nazis Sowieso
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-
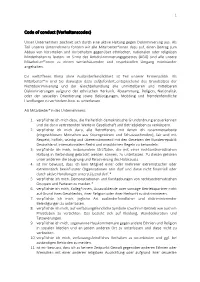
Code of Conduct (Verhaltenscodex)
1 Code of conduct (Verhaltenscodex) Unser Unternehmen zeichnet sich durch eine aktive Haltung gegen Diskriminierung aus. Als Teil unseres Unternehmens fordern wir alle Mitarbeiter*innen dazu auf, einen Beitrag zum Abbau von Vorurteilen und Vorbehalten gegenüber ethnischen, nationalen oder religiösen Minderheiten zu leisten. Im Sinne des Antidiskriminierungsgesetzes (AGG) sind alle unsere Mitarbeiter*innen zu einem wertschätzenden und respektvollen Umgang miteinander angehalten. Ein weltoffenes Klima ohne Ausländerfeindlichkeit ist Teil unserer Firmenpolitik. Als Mitarbeiter*in sind Sie deswegen dazu aufgefordert, entsprechend des Grundsatzes der Nichtdiskriminierung und der Gleichbehandlung alle unmittelbaren und mittelbaren Diskriminierungen aufgrund der ethnischen Herkunft, Abstammung, Religion, Nationalität oder der sexuellen Orientierung sowie Belästigungen, Mobbing und fremdenfeindliche Handlungen zu verhindern bzw. zu unterlassen. Als Mitarbeiter*in des Unternehmens 1. verpflichte ich mich dazu, die freiheitlich demokratische Grundordnung anzuerkennen und die darin vertretenden Werte in Gesellschaft und Betriebsleben zu verkörpern. 2. verpflichte ich mich dazu, alle Betroffenen, mit denen ich zusammenarbeite (eingeschlossen Menschen aus Krisengebieten und Schutzsuchenden), fair und mit Respekt, höflich, würdig und übereinstimmend mit den Gesetzen der Bundesrepublik Deutschland, internationalem Recht und ortsüblichen Regeln zu behandeln. 3. verpflichte ich mich, insbesondere Straftaten, die mit einer rechtsextremistischen Haltung -

Verfassungsschutzbericht 2008
Senatsverwaltung für Inneres und Sport 1 Verfassungsschutz- bericht Senatsverwaltung für Inneres und Sport Abteilung Verfassungsschutz 1 Verfassungsschutzbericht 2008 Erreichbarkeit des Berliner Verfassungsschutzes Senatsverwaltung für Inneres und Sport, Abteilung Verfassungsschutz Adresse: Klosterstraße 47, 10179 Berlin Postanschrift: Postfach 62 05 60, 10795 Berlin Internet: www.verfassungsschutz-berlin.de E-Mail: [email protected] Vermittlung: (030) 90 129-0 Fax: (030) 90 129-844 Kontakttelefon: (030) 90 129-440 Pressestelle: (030) 90 129-565 Vertrauliches Telefon: (030) 90 129-400 Deutsch / Englisch (030) 90 129-401 Türkisch (030) 90 129-402 Arabisch Herausgeber: Senatsverwaltung für Inneres und Sport Abteilung Verfassungsschutz Redaktion: Arbeitsgruppe Öffentlichkeitsarbeit Druck: Mercedes-Druck, Berlin Redaktionsschluss: April 2009 Abdruck gegen Quellenangabe gestattet, Belegexemplar erbeten. Hinweis: Dieser Verfassungsschutzbericht erwähnt nicht alle Beobach- tungsobjekte des Berliner Verfassungsschutzes. VERFASSUNGSSCHUTZBERICHT BERLIN 2008 III VORWORT In diesem Frühjahr hat in Deutschland eines der wichtigsten Terrorismusverfahren begonnen: Vor dem Oberlandesgericht in Düsseldorf müssen sich die Angeklagten der so genannten Sauerlandgruppe verantworten. Sie hatten mehrere Bombenanschläge auf amerikanische Einrichtungen in Deutschland geplant und waren im September 2007 festgenommen worden. Seitdem war klar, dass der „home grown terrorism“ auch ein deutsches Problem ist. Das Verfahren wird nochmals eindrücklich -

LANDTAG RHEINLAND-PFALZ Antwort
LANDTAG RHEINLAND-PFALZ Drucksache 12/4 7 2 7 12. Wahlperiode zu Drucksache 12/4436 27. 04. 1994 Antwort des Ministeriums des Innern und für Sport auf die Große Anfrage der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN -Drucksache 12/4436- Rechtsextremismus in Rheinland-Pfalz - nationales und internatio nales faschistisches Netzwerk Die Große Anfrage vom 18. Februar 1994 hat folgenden Wortlaut: Die Zahl ausländerfeindlicher und antisemitischer Straftaten nimmt entgegen den offiziellen Annahmen von 1993 in der Bundesrepublik weiter zu. Selbst der Verfassungsschutz des Landes Rheinland-Pfalz, der noch 1990 von einem ,.beachtlichen Rückgang"' des Rechtsextre mismus spricht, erkennt heute die Realität dieser "besonderen Herausforderung.. an. Einige wenige repressive Maßnahmen, wie Verbote rechtsextremistischer Gruppierungen und Parteien nach vorheriger Ankündigung, belegen die strukturelle Hilflosigkeit der politisch Verantwortlichen. Diese sind nicht bereit, eine umfassende Aufarbeitung von Rechtsextre~ mismus und Ausländerfeindlichkeit zur Basis ihres politischen Handeins zu machen. Allein die wirtschafdichen und gesellschaftlichen Folgen der Wiedervereinigung Deutschlands 1989 reichen als Erklärung für die explosive Entwicklung nicht aus. Der politische und gesellschaftliche Aufstieg rechtsextremer Parteien und Organisationen im Nachkriegsdeutschland hat eine Geschichte, die so alt ist, wie die Bundesländer selbst. Unter anderem haben es deren Entscheidungsträger seit jeher verstanden, gegen den realen gesell schaftlichen Wandel bewährte Mechanismen -

Verfassungsschutzbericht 2018 (PDF)
Verfassungsschutzbericht des Landes Brandenburg 2018 Mit dem vorliegenden Jahresbericht 2018 unterrichtet die Verfassungsschutzbehörde des Landes Brandenburg in Erfüllung ihres gesetzlichen Auftrages die Öffentlichkeit. Der Ver- fassungsschutz versteht sich als Frühwarnsystem zum Schutz der freiheitlichen demokra- tischen Grundordnung. Das diesjährige Titelbild steht dafür. Die Farbradierung „Potsdamer Stadtschloss“ des Malers Christian Heinze entstand 1996 im Rahmen des Zyklus „Spu- rensuche“. Es verarbeitet den historischen Grundriss des ehemaligen Stadtschlosses, das nach seinem Wiederaufbau seit 2013 Sitz des Landtages Brandenburg ist. Unweit dieser historischen Stelle befand sich bereits im Jahr 993, am Ufer der Havel, eine slawische Fes- tung, die vor feindlichen Angriffen schützen sollte. Verfassungsschutzbericht des Landes Brandenburg 2018 Impressum Herausgeber: Ministerium des Innern und für Kommunales des Landes Brandenburg (MIK) Henning-von-Tresckow-Straße 9 – 13 | 14467 Potsdam Internet: mik.brandenburg.de Redaktion: MIK | Abteilung Verfassungsschutz, Referat 52 Internet: www.verfassungsschutz.brandenburg.de E-Mail: [email protected] Telefon: 0331 866-2699 Fax: 0331 866-2599 Layout und Druck: LGB (Landesvermessung und Geobasisinformation Brandenburg) Heinrich-Mann-Allee 103 | 14473 Potsdam Auflage: 2.500 Redaktionsschluss: 26.04.2019 Diese Informationsschrift wird kostenlos im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit des Ministe- riums des Innern und für Kommunales des Landes Brandenburg herausgegeben. Sie darf -

20180613 Verfassungsschutzbericht 2017
Themenübersicht 01 Der Verfassungsschutz in Niedersachsen 02 Rechtsextremismus 03 Linksextremismus 04 Islamismus 05 Extremismus mit Auslandsbezug 06 Prävention 07 Scientology-Organisation (SO) 08 Spionageabwehr / Proliferation Elektronische / Angriffe 09 Geheimschutz 10 Wirtschaftsschutz 11 Politisch motivierte Kriminalität (PMK) 12 Anhang 2 Inhaltsverzeichnis 1. Der Verfassungsschutz in Niedersachsen 1.1 Verfassungsschutz und Demokratie 7 1.2 Gesetzliche Grundlagen 8 1.3 Hauptaufgaben des Verfassungsschutzes 8 1.4 Organisation 9 1.5 Informationsgewinnung 9 1.6 Kontrolle 9 1.7 Verfassungsschutz als Nachrichtendienst 10 1.8 Beschäftigte 10 1.9 Haushalt 10 1.10 Mitwirkungsaufgaben des Verfassungsschutzes 10 1.11 Gemeinsames Informations- und Analysezentrum Polizei und Verfassungsschutz Niedersachsen (GIAZ – Niedersachsen) 11 1.12 Informationsverarbeitung 12 1.13 Auskunftsersuchen von Bürgerinnen und Bürgern 12 1.14 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit 13 1.15 Kontaktdaten 13 1.16 Anmerkungen zum Inhalt des Verfassungsschutzberichtes 14 2. Rechtsextremismus 2.1 Mitglieder-Potenzial 16 2.2 Einführung 18 2.3 Aktuelle Entwicklungen im Rechtsextremismus 19 2.4 Subkulturell geprägte Rechtsextremisten / Rechtsextremistische Musikszene 21 2.5 Neonazistische Szene 28 2.6 Identitäre Bewegung Deutschland (IBD) 35 2.7 Nationaldemokratische Partei Deutschlands (NPD) 40 2.8 Die Rechte 44 2.9 Europäische Aktion (EA) 49 2.10 Freistaat Preußen / Stimme des Reiches (SdR) 55 2.11 Verein Gedächtnisstätte e. V. 59 2.12 Reichsbürger und Selbstverwalter 62 3. Linksextremismus -

LANDTAG RHEINLAND-PFALZ Große Anfrage
LANDTAG RHEINLAND-PFALZ Drucksache 12144 3 6 12. Wahlperiode 18. 02. 1994 Große Anfrage der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN Rechtsextremismus in Rheinland-Pfalz - nationales und internationales faschistisches Netzwerk Die Zahl ausländerfeindlicher und antisemitischer Straftaten nimmt entgegen den offiziellen Annahmen von 1993 in der Bundesrepublik weiter zu. Selbst der Verfassungsschutz des Landes Rheinland-Pfalz, der noch 1990 von einem ,.beachtlichen Rückgang" des Rechtsextremismus spricht, erkennt heute die Realität dieser ,.besonderen Herausforderung" an. Einige wenige repressive Maßnahmen, wie Verbote rechtsextremistischer Gruppierungen und Parteien nach vorheriger Ankündigung, belegen die strukturelle Hilflosigkeit der politisch Verantwortlichen. Diese sind nicht bereit, eine umfassende Aufarbeitung von Rechtsextremismus und Ausländerfeindlichkeit zur Basis ihres politischen Handeins zu machen. Allein die wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Folgen der Wiedervereinigung Deutschlands 1989 reichen als Erklärung für die explosive Entwicklung nicht aus. Der politische und gesellschaftliche Aufstieg rechtsextremer Parteien und Organisationen im Nachkriegsdeutschland hat eine Geschichte, die so alt ist, wie die Bundesländer selbst. Unter anderem haben es deren Entscheidungsträger seit jeher verstanden, gegen den realen gesellschaftlichen Wandel bewährte Mechanismen nach dem Sündenbockprinzip in Gang zu setzen, die ein Problem durch ein anderes ersetzen: Rechtsextremistische Tendenzen lassen sich in der Bundesrepublik in verschiedenen -

Materialsammlung Zu Agnes Miegel Inhaltsverzeichnis
Materialsammlung zu Agnes Miegel Inhaltsverzeichnis A) Texte von Agnes Miegel 1) Dem Führer! (1936)................................................................................................... 3 2) An den Führer (1938).…............................................................................................ 4 3) An Deutschlands Jugend (1939)............................................................................... 5 4) N.S. Frauen-Warte / Mutterherz (1937)..................................................................... 7 B) Expertisen über Agnes Miegel 1) Gutachten zur Rolle der Dichterin Agnes Miegel (1879 - 1964) im „Dritten Reich“... 9 C) Agnes Miegel in der öffentlichen Diskussion 1) Agnes-Miegel-Initiative Düsseldorf Rede von Jürgen Schuh, VVN-BdA NRW........ 11 2) Geistige Mutter........................................................................................................ 16 3) Hymnen auf Adolf Hitler........................................................................................... 18 4) Wer war die Dichterin Agnes Miegel?..................................................................... 21 5) “Es bleibt bei Agnes-Miegel-Straße”....................................................................... 23 6) Vom Mügeln und Miegeln........................................................................................ 25 7) Düsseldorf: Miegel-Schule: Jubiläum 2010 mit neuem Namen............................... 27 8) Neuer Name und nicht ganz die Alte..................................................................... -

"Die Revolution in Deutschland Wird Von Borna Ausgehen" Eine Sächsische Kleinstadt Und Ein Nazizentrums Neuen Typs
"Die Revolution in Deutschland wird von Borna ausgehen" Eine sächsische Kleinstadt und ein Nazizentrums neuen Typs Er platzte fast vor Stolz aus allen Nähten, als er, dezent einen Schritt im Hintergrund, in unmittelbarer Nähe seiner ganz in rot gekleideten Chefin stand, die am Mikro die fast 200 Gäste auf ihrem Anwesen begrüßte. Noch knapp drei Jahre zuvor hatte er weniger Grund zum Strahlen gehabt. Damals suchte der studierte Militärhistoriker dringend einen neuen Job. Sein bisheriger Chef, der Bundestagsabgeordnete Martin Hohmann, war erst nach einer antisemitischen Rede aus der CDU ausgeschlossen worden und dann in seinem bisherigen Wahlkreis Fulda nicht erneut nominiert worden. Erwartungsgemäß scheiterte er bei der Bundestagswahl im Herbst 2005 mit seiner Kandidatur als unabhängiger Kandidat. Peter Hild war arbeitslos. Und wer nimmt schon einen Militärhistoriker, der zwar ein Bundesverdienstkreuz, jedoch keinerlei Berufserfahrung vorweisen kann? Sein bisheriger Arbeitgeber konnte wohl kaum als positive Referenz gelten. Wie so oft halfen auch hier Beziehungen. Sein vormaliger Chef Martin Hohmann hatte umfangreiche Schützenhilfe von rechts und ganz rechts erhalten. Zu denen, die ihm zur Seite gesprungen waren, gehörte auch der emeritierte Professor der Betriebswirtschaft Bernhard Bellinger (Berlin, *1920). Zu diesem Zweck hatte er im Kolb-Verlag den Band „Wir Deutsche sind kein ‚Tätervolk’ - Solidarität mit Martin Hohmann MdB" veröffentlicht. Man kannte sich also. Da traf es sich gut, dass bei Bellinger Ursula Haverbeck-Wetzel, Gründerin und langjährige Vorsitzende des „Vereins Gedächtnisstätte e.V.", nachfragte, ob er nicht eine geeignete Person als wissenschaftlichen Leiter für das neue Anwesen ihres Vereins kenne. Die Bekanntschaft der alten Dame (*1928) und des alten Herrn ist nicht zufällig. -
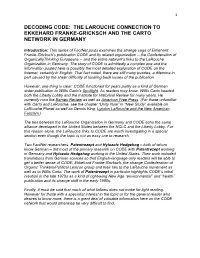
Decoding Code: the Larouche Connection to Ekkehard Franke-Gricksch and the Carto Network in Germany
1 DECODING CODE: THE LAROUCHE CONNECTION TO EKKEHARD FRANKE-GRICKSCH AND THE CARTO NETWORK IN GERMANY Introduction: This series of FactNet posts examines the strange saga of Ekkehard Franke-Gricksch‟s publication CODE and its related organization – the Confederation of OrganicallyThinking Europeans -- and the entire network‟s links to the LaRouche Organization in Germany. The story of CODE is admittedly a complex one and the information posted here is possibly the most detailed exploration of CODE on the Internet, certainly in English. That fact noted, there are still many puzzles, a dilemma in part caused by the sheer difficulty of locating back issues of the publication. However, one thing is clear: CODE functioned for years partly as a kind of German sister publication to Willis Carto‟s Spotlight. As readers may know, Willis Carto headed both the Liberty Lobby and the Institute for Historical Review for many years. He currently runs the Barnes Review as well as American Free Press. (For those unfamiliar with Carto and LaRouche, see the chapter “Unity Now” in “New Study” available on LaRouche Planet as well as Dennis King, Lyndon LaRouche and the New American Fascism.) The ties between the LaRouche Organization in Germany and CODE echo the same alliance developed in the United States between the NCLC and the Liberty Lobby. For this reason alone, the LaRouche links to CODE are worth investigating in a special section even though the topic is not an easy one to research. Two FactNet researchers, Patentrezept and Hylozoic Hedgehog – both of whom know German – did most of the primary research on CODE with Patentrezept working in Germany and Hylozoic Hedgehog working in the United States. -

Verfassungsschutzbericht 2018 Impressum
Niedersächsisches Ministerium für Inneres und Sport – Verfassungsschutz – 2018 Verfassungsschutzbericht Verfassungsschutzbericht 2018 Impressum Herausgeber: Niedersächsisches Ministerium für Inneres und Sport Presse- und Öffentlichkeitsarbeit Lavesallee 6 30169 Hannover Telefon: 0511 120-6255 Telefax: 0511 120-6555 E-Mail: [email protected] Internet: www.mi.niedersachsen.de Redaktion: Niedersächsisches Ministerium für Inneres und Sport Abteilung Verfassungsschutz Büttnerstraße 28 30165 Hannover Telefon: 0511 6709-217 Telefax: 0511 6709-394 E-Mail: [email protected] Internet: www.verfassungsschutz.niedersachsen.de Layout und Gestaltung: ermisch | Büro für Gestaltung, Hannover Verfassungsschutzbericht 2018 Vorworte Liebe Bürgerinnen und Bürger, „Der Verfassungsschutz dient dem Schutz der freiheitlichen demokratischen Grund ordnung, des Bestandes und der Sicherheit des Bundes und der Länder“, so steht es in Paragraph 1 des Niedersächsischen Verfas sungsschutzgesetzes. Der Inhalt dieses Paragraphen beschreibt sprechen. Eine zunehmende Verrohung der das Wesen und den Zweck des Verfassungs Sprache im öffentlichen Diskurs verstärkt schutzes, der für ein hohes Sicherheits diese Entwicklung weiter. Welche Gefahr von niveau in unserem Land unverzichtbar ist. Rechtsextremisten ausgeht, hat uns zuletzt Seine große Bedeutung wird auch anhand der Mord am Kasseler Regierungspräsidenten aktueller Ereignisse und der gegenwärtigen Dr. Walter Lübcke eindringlich und bitter vor Entwicklung in den -

Demokratie Stärken – Rechtsextremismus Bekämpfen Nordrhein-Westfalen Für Toleranz Und Menschlichkeit
Demokratie stärken – Rechtsextremismus bekämpfen Nordrhein-Westfalen für Toleranz und Menschlichkeit Broschüre zur Ausstellung des Forums Jugend und Politik Bonn der Friedrich-Ebert-Stiftung Christoph Busch > Von: [email protected] > Betreff : Bin stolz auf dich ! > Hi Benny, > Janosch hat mir erzählt, dass du im Bus eine Türkin > gegen zwei Nazis beschützt hast. Ich wollte dir nur sagen, > dass ich stolz auf dich bin ! Und ich finde es komisch, dass > davon nichts in der Zeitung stand. Es ist wohl nur eine > Meldung, wenn „keiner aufgestanden ist“. Ich habe mich > jedenfalls total gefreut, mal wieder von dir zu hören. > Liebe Grüße > Nadine Von : [email protected] Betreff : Re : Bin stolz auf dich ! Liebe Nadine, Szene Die rechte chte“ vielen Dank, aber es war eigentlich halb so wild. Ich „Neue Re ) habe nur als erster gesagt, dass sie aufhören sollen, ie ntellektuelle Ideolog (Rechtsi Stress zu machen, da haben mich gleich zwei Frauen die Köpfe unterstützt. Die beiden haben dann nur noch einmal Kampf um ln VU Pro Kö nachgestänkert und dann sind sie beim nächsten Halt NPD D emokraten raus. Ich glaube, wenn ich allein gewesen wäre, hätte ich Nationald cht Junge er NPD) Ma anisation d mich das nicht getraut. Man muss eb (Jugendorg en sehen, was geht. mente m die Parla n Kampf u ierten Wille den organis aften Kampf um radsch Lieben Gruß zurück Freie Kame ionale Benn onazis, reg y n nisierte Ne tione (Lokal orga Ak os) P.S. : Übrigens, auf den ersten Blick sahen die gar Aktionsbür traße tzung f um die S B. -

Unvereinbarkeitsliste Für Afd-Mitgliedschaft, Stand 18
Unvereinbarkeitsliste für AfD-Mitgliedschaft Stand 03.09.2019 AfD-Bundesgeschäftstelle ([email protected]) Zuordnung Gruppierung/Partei/Organisation gehört zu verboten beobachtet bundesweit ausschl. in Bundesländern Jahr 2013 Jahr 2014 Jahr 2015 Art der Vereinigung AE: Ausländerextremismus RE: Rechtsextremismus LE: Linksextremismus ISiT: Islamismus / Islamistischer Terrorismus SO: Scientology AE Anadolu Federasyonu (Anatolische Föderation) DHKP-C x (seit 1998) x x x x Organisation AE Arbeiterpartei Kurdistans (PKK) x (seit 1993) x x x x Partei AE Babbar Khalsa Germany (BKG) BKI x x x x x Organisation AE Babbar Khalsa International (BKI) x x x x x Organisation AE Ciwanên Azad PKK x x x x x Organisation AE Demokratisches Gesellschaftszentrum der KurdInnen in Deutschland e.V. (NAV- x x x x x Verein DEM) AE Demokratisches Kurdisches Gemeindezentrum Neumünster e.V. x SH x x Verein AE Der Kalifatstaat (Hilafet Devleti) x (seit 2001) x x x x Organisation AE Ekonomi ve Maliye Bürosu (EMB - Wirtschaft und Finanzbüro) x x x x Organisation AE Föderation der patriotischen Arbeiter- und Kulturvereinigungen aus Kurdistan in PKK x (seit 1993) x x x x Teilorganisation der Bundesrepublik Deutschland e.V. (FEYKA-Kurdistan) AE Föderation der Türkisch-Demokratischen Idealistenvereine in Deutschland e.V. Graue Wölfe x x x x x Organisation (ADÜTDF) AE Förderation Kurdischer Vereine in Deutschland e.V. (YEK-KOM – Yekitîya Komalên weitgehend PKK x x x x x Organisation Kurd Li Elmanya) AE Freiheits- und Demokratiekongress Kurdistans (Kongreya Azadî û Demokrasiya