1. Eisenbahn Und Bahnhof Mitte Des 19
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-
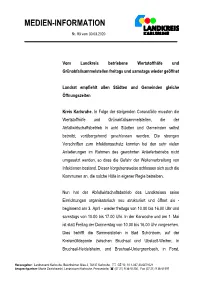
Medien-Information
MEDIEN-INFORMATION Nr. 93 vom 30.03.2020 10; 10.1-047.43-5471021 Vom Landkreis betriebene Wertstoffhöfe und Grünabfallsammelstellen freitags und samstags wieder geöffnet Landrat empfiehlt allen Städten und Gemeinden gleiche Öffnungszeiten Kreis Karlsruhe. In Folge der steigenden Coronafälle mussten die Wertstoffhöfe und Grünabfallsammelstellen, die der Abfallwirtschaftsbetrieb in acht Städten und Gemeinden selbst betreibt, vorübergehend geschlossen werden. Die strengen Vorschriften zum Infektionsschutz konnten bei den sehr vielen Anlieferungen im Rahmen des gewohnten Anlieferbetriebs nicht umgesetzt werden, so dass die Gefahr der Weiterverbreitung von Infektionen bestand. Dieser Vorgehensweise schlossen sich auch die Kommunen an, die solche Höfe in eigener Regie betreiben. Nun hat der Abfallwirtschaftsbetrieb des Landkreises seine Einrichtungen organisatorisch neu strukturiert und öffnet sie - beginnend am 3. April - wieder freitags von 10.00 bis 16.00 Uhr und samstags von 10.00 bis 17.00 Uhr. In der Karwoche und am 1. Mai ist statt Freitag der Donnerstag von 10.00 bis 16.00 Uhr vorgesehen. Dies betrifft die Sammelstellen in Bad Schönborn, auf der Kreismülldeponie zwischen Bruchsal und Ubstadt-Weiher, in Bruchsal-Heidelsheim, und Bruchsal-Untergrombach, in Forst, ___________________________________________________________________________________________________ Herausgeber: Landratsamt Karlsruhe, Beiertheimer Allee 2, 76137 Karlsruhe, GZ 10; 10.1-047.43-5471021 Ansprechpartner: Martin Zawichowski, Landratsamt Karlsruhe, Pressestelle, (07 21) 9 36-51200, Fax (07 21) 9 36-51597 2 Gondelsheim, Hambrücken, Kürnbach, Zaisenhausen und den Wertstoffhof in Oberhausen-Rheinhausen. Die kleine Sammelstelle beim städtischen Bauhof in der Panzerstraße in der Bruchsaler Südstadt bleibt geschlossen, weil es dort keinen größeren Wartebereich gibt. Damit die Vorgaben zum Infektionsschutz eingehalten werden, darf künftig nur eine bestimmte Zahl von Anlieferenden die Sammelstelle gleichzeitig nutzen. -

Abfuhrkalender 2021 Abfallwirtschaftsbetrieb Für Privathaushalte Gondelsheim Landkreis Karlsruhe
Abfuhrkalender 2021 AbfallWirtschaftsBetrieb für Privathaushalte Gondelsheim Landkreis Karlsruhe Dez. 2020 Januar Februar März April Mai Juni + + 1 Di 1 Fr Neujahr 1 Mo 1 Mo 1 Do 1 Sa Tag der Arbeit 1 Di wö+ 2 Mi 2 Sa 2 Di 2 Di 2 Fr Karfreitag 2 So 2 Mi + + 3 Do 3 So 3 Mi 3 Mi 3 Sa 3 Mo 3 Do Fronleichnam + 4 Fr 4 Mo 4 Do 4 Do 4 So 4 Di 4 Fr wö+ 5 Sa 5 Di 5 Fr 5 Fr 5 Mo Ostermontag 5 Mi 5 Sa 6 So 6 Mi Heilige drei Könige 6 Sa 6 Sa 6 Di 6 Do 6 So + 7 Mo 7 Do 7 So 7 So 7 Mi 7 Fr 7 Mo + 8 Di 8 Fr 8 Mo 8 Mo 8 Do 8 Sa 8 Di + + + 9 Mi 9 Sa 9 Di 9 Di 9 Fr 9 So 9 Mi 10 Do 10 So 10 Mi 10 Mi 10 Sa 10 Mo 10 Do 11 Fr 11 Mo 11 Do 11 Do 11 So 11 Di 11 Fr + 12 Sa 12 Di 12 Fr 12 Fr 12 Mo 12 Mi 12 Sa 13 So 13 Mi 13 Sa 13 Sa 13 Di 13 Do Christi Himmelfahrt 13 So + 14 Mo 14 Do 14 So 14 So 14 Mi 14 Fr 14 Mo + + + 15 Di 15 Fr 15 Mo 15 Mo 15 Do 15 Sa 15 Di wö+ 16 Mi 16 Sa 16 Di 16 Di 16 Fr 16 So 16 Mi + + 17 Do 17 So 17 Mi 17 Mi 17 Sa 17 Mo 17 Do + 18 Fr 18 Mo 18 Do 18 Do 18 So 18 Di 18 Fr wö+ 19 Sa 19 Di 19 Fr 19 Fr 19 Mo 19 Mi 19 Sa + 20 So 20 Mi 20 Sa 20 Sa 20 Di 20 Do 20 So + 21 Mo 21 Do 21 So 21 So 21 Mi 21 Fr 21 Mo 22 Di 22 Fr 22 Mo 22 Mo 22 Do 22 Sa 22 Di + + + 23 Mi 23 Sa 23 Di 23 Di 23 Fr 23 So 23 Mi 24 Do 24 So 24 Mi 24 Mi 24 Sa 24 Mo Pfingstmontag 24 Do 25 Fr 1. -

Protokoll 52. Ordentlicher Kreistag Des Fußballkreises Bruchsal 2013
Kreis Bruchsal Kreisschriftführer bfv Kreis Bruchsal – Finkenweg 1 – 68794 Oberhausen-Rheinhausen Matthias Hollweck An die Mitglieder des Kreisvorstandes Ubstadt, Talwiesen 17c 76698 Ubstadt-Weiher Fon: 07253/3623 Mobil: 0160/8879297 Email: [email protected] www.fussball-br.de Ubstadt-Weiher, 19. Juni 2013 Betreff: Protokoll 52. ordentlicher Kreistag des Fußballkreises Bruchsal 2013 Sitzungsort: Sporthaus FV 1912 Wiesental Datum: Mittwoch, 19. Juni 2013 Sitzungsdauer: 19.00 Uhr – 20.45 Uhr 1. Begrüßung Der stellvertretende Kreisvorsitzende Ralf Longerich eröffnet um kurz nach 19 Uhr den Kreistag und begrüßt die anwesenden Vereinsvertreter, Kreismitarbeiter und Ehrengäste. 2. Totenehrung Die Anwesenden erheben sich zum Gedenken an die in der Legislaturperiode ver- storbenen Sportkameraden. Stellvertretend werden genannt: Franz Schneider, Vorsitzender Kreissportgericht Uwe Walter, Jugendstaffelleiter und SR-Ausschussmitglied Roland Pfoh, Kreis-SR-Obmann 3. Grußworte Es folgen die Grußworte in folgender Reihenfolge: - Manfred Schweikert, FV 1912 Wiesental - Krimhild Rolli, stellv. Bürgermeisterin Waghäusel-Wiesental - Ronny Zimmermann, Präsident des bfv - Walfried Hambsch, Vorsitzender des Sportkreises Bruchsal Volksbank Bruhrain – Kraich – Hardt BLZ 663 916 00 Kto.-Nr. 20 65 100 Seite 2 von 5 4. Berichte Die Berichte des Kreiskassiers, der Staffelleiter, des Pokalspielleiters, des Kreis- jugendleiters, des Vorsitzenden des Kreisschiedsrichterausschusses, des Kreis- sportgerichts, des Referenten für Freizeitsport, des Bußgeldbeauftragten sowie des Ehrenamtsbeauftragten liegen in schriftlicher Form vor. Die Tätigkeitsberich- te dieser Ressorts sind im Anhang des Protokolls zu finden. a. Bericht des KV Der Kreisvorsitzende Heinz Blattner erklärt in seinem vorgetragenen Bericht, dass es in seiner ersten Amtsperiode das Ziel war, die Arbeit seines Vorgängers und jetzigem Ehrenkreisvorstandes Dieter Siegele fortzuführen. Er deutet an, dass Kontinuität im Fußballkreis Bruchsal ganz groß geschrieben wird. -

Preise Für Bargeldauszahlungen an Unseren Geldautomaten
Unser SB-Angebot auf einen Blick: Helmstadt Eschelbronn Angelbachtal, Schloßstraße 4 ......................................................... Bad Rappenau, Bahnhofstraße 11 ................................................. Waibstadt Bad Rappenau, Rosentrittklinik, Salinenstraße 28 .................... Neckarbischofsheim Bretten, Engelsberg 6-8 ................................................................... Hoffenheim Bretten, Pforzheimer Straße 71 ...................................................... Bretten, Melanchthonstraße 100 ................................................... Eschelbronn Helmstadt A6 Bruchsal, Bahnhof .............................................................................. Sinsheim Bruchsal, Friedrichsplatz 2 .............................................................. Waibstadt Bruchsal, Hardfeldplatz 3 ................................................................. Neckarbischofsheim Bruchsal, Fachmarktzentrum Heimenäcker/Kammerforst 3 .... Hoffenheim Steinsfurt Bad Rappenau Bruchsal, Fürst-Stirum-Klinik / Gutleutstraße 1-14 .................... Mingolsheim Bruchsal, Tankstelle Eberhardt / W.-von-Siemens-Str. 24 a ..... Kronau Angelbachtal Bruchsal / Servicefiliale, Werner-von-Siemens-Str. 12 .............. Wiesental A6 Weiler Diedelsheim, Richard-Wagner-Straße 3 ....................................... A5 Östringen Sinsheim Eschelbronn, Kandelstraße 4 .......................................................... Langenbrücken Flehingen, Bissinger Straße 2 ........................................................ -

Liniennetzplan
Gültig ab 09. Dezember 2018 [ VRN] [ VRN] [ VRN] Liniennetzplan R92 Mainz R2 Mannheim [ VRN] R91 Heidelberg r s t b R51 Neustadt (Weinstr.)/Kaiserslautern S3 Karlsruhe (via Heidelberg) Lingenfeld S4 Bruchsal (via Heidelberg) w b Waghäusel S3, S4 Germersheim (via Heidelberg) R53 Neustadt (Weinstr.) Graben-Neudorf S4 Huttenheim Nord R2 Germersheim Bf S3 b Philippsburg Wiesental zeo w b Bad Schönborn-Kronau b S33 Maikammer-Kirrweiler Rheinsheim w R92 Graben-Neudorf Bf b Germersheim egrkl d 3 Edenkoben w Odenheim 5 b w w d R Mitte/Rhein Germersheim b Menzingen Rietburgbahn b Odenheim Bf f Edesheim w Bad Schönborn b R51 Germersheim Süd Menzingen S33 Hochstetten q p Hochstetten Spöck S33 Odenheim West Knöringen-Essingen Süd/Nolte R92 w b Bahnbrücken Hochstetten Altenheim bj R2 Rinnthal Landau Hbf Spöck Richard-Hecht-Schule Karlsdorf Zeutern Ost Annweiler-Sarnstall jb R92 zeo zeo AnnweilerAlbersweiler am Trifels LandauLandau West Süd VN b w b j S52 Sondernheim Hochstetten Grenzstr. Spöck Hochhaus Gochsheim Siebeldingen-BirkweilerGodramstein Landau S51 Zeutern Bf R55 R57 Ubstadt- b w Bellheim Am Mühlbuckel Linkenheim Schulzentrum Friedrichstal Nord b R55 Pirmasens b b b bj Insheim Weiher Zeutern Sportplatz Münzesheim Ost b 1 zeo 3 R53 9 b R57 Bundenthal S4 S Linkenheim Rathaus Friedrichstal Mitte R [ VRN] Rohrbach Bellheim Bf b Stettfeld Münzesheim Bf b S31 S32 51 Linkenheim Friedrichstr. Friedrichstal Saint-Riquier-Platz Friedrichstal Bf b R 11 S Barbelroth Rülzheim Bf Rhein ! S2 Ubstadt Uhlandstr. Oberöwisheim [ HNV] R54 Steinweiler Linkenheim Süd 1 w Blankenloch S4 Heilbronn/Öhringen Kapellen-Drusweiler S KIT-Campus Nord: Rülzheim Freizeitzentrum KIT-Campus Nord Bf 4 Waldstadt Blankenloch Nord b S32 Unteröwisheim Bf S5 Heidelberg Bad Bergzabern b Winden b Zugang nur mit besonderem Ubstadt w Europäische Schule b Blankenloch Mühlenweg b Blankenloch Bf Unteröwisheim Eppingen C Bad Bergzabern b C Rheinzabern Bf Leopoldshafen Frankfurter Str. -

Wabenplan Stand Januar 2010
Wabenplan Stand Januar 2010 Neustadt/Weinstraße Öhringen-Cappel Hbf. Öhringen Ü1 Bitzfeld Bretzfeld 590 Speyer Hbf. Scheppach Maikammer- Wieslansdorf St. Martin Kirrweiler Berghausen (Pf) Ü3 Eschenau Affaltrach Eußerthal Ramberg 580 Heiligenstein Willsbach Edenkoben Wein- Schwegen- Rinnthal Annweiler Frankweiler Rhodt garten heim Sülzbach Albersweiler Ü1 591 Edesheim Venningen Wilgartswiesen Siebeldingen- Gommers- Ellhofen Sarnstall Böchingen Böbingen -Birkweiler heim Lingenfeld Weinsberg Knöringen- Zeiskam Leinsweiler Godramstein West- Essingen Hochstadt heim Ilbesheim Germersheim Heilbronn Ü1 Hauenstein Waldhambach Wernersberg Landau 585 Lustadt Billigh. Gossersweiler 581 570 575 Ü2 Silz Böckingen Hinterweidenthal Offenbach Oberhausen- Münchweiler Sondernheim Rheinhausen Bunden- Bad Schönborn- Insheim thal Vorderweidenthal Ottersheim Knittelsheim Rheins- Waghäusel Kronau Östringen Leingarten Dahn heim Kronau Klingenmünster Herxheim Bellheim Kirrlach Mingolsheim Birkenhördt 588 Ham- 256 Schwaigern Rohrbach 560 565 Philippsburg brücken 266 Langenbr. Stettfeld Zeutern Odenheim Ü1 Böllenborn Rülzheim Hördt Wiesental Weiher Tiefenbach Stetten Herxheim- Huttenheim 253 Ubstadt- weyher Kuhardt Kraichtal Gemmingen Steinweiler Leimersheim Weiher Unteröwisheim Eichelberg Hayna Rußheim Forst Blankenborn Neupotz Neuenbürg Landshausen Ü1 568 Rheinzabern Liedolsheim Graben- 268 Elsenz 578 Neudorf Karlsdorf- Münzes- 550 Oberacker Sulzfeld Eppingen Bf. Kapellen-Drusweiler Barbelroth Hatzenbühl Hochstetten Neuthard heim Zaisenhausen Bad Bergzabern Winden -

Bus Linie 141 Fahrpläne & Netzkarten
Bus Linie 141 Fahrpläne & Netzkarten 141 Gondelsheim - Bretten Im Website-Modus Anzeigen Die Bus Linie 141 (Gondelsheim - Bretten) hat 7 Routen (1) Bretten Bahnhofsvorplatz: 14:10 - 16:10 (2) Bretten Bahnhofsvorplatz: 05:23 - 22:30 (3) Bretten Rechbergklinik: 08:26 - 13:31 (4) Gondelsheim Bahnhof: 06:02 - 23:05 (5) Gondelsheim Graf-Douglas-Str.: 05:47 - 16:25 Verwende Moovit, um die nächste Station der Bus Linie 141 zu ƒnden und, um zu erfahren wann die nächste Bus Linie 141 kommt. Richtung: Bretten Bahnhofsvorplatz Bus Linie 141 Fahrpläne 2 Haltestellen Abfahrzeiten in Richtung Bretten Bahnhofsvorplatz LINIENPLAN ANZEIGEN Montag 14:10 - 16:10 Dienstag 14:10 - 16:10 Bretten Rechbergklinik Mittwoch 14:10 - 16:10 Bretten Bahnhofsvorplatz 4, Bretten Donnerstag 14:10 - 16:10 Freitag 14:10 - 16:10 Samstag Kein Betrieb Sonntag Kein Betrieb Bus Linie 141 Info Richtung: Bretten Bahnhofsvorplatz Stationen: 2 Fahrtdauer: 5 Min Linien Informationen: Bretten Rechbergklinik, Bretten Bahnhofsvorplatz Richtung: Bretten Bahnhofsvorplatz Bus Linie 141 Fahrpläne 15 Haltestellen Abfahrzeiten in Richtung Bretten Bahnhofsvorplatz LINIENPLAN ANZEIGEN Montag 05:23 - 22:30 Dienstag 05:23 - 22:30 Gondelsheim Graf-Douglas-Str. Bruchsaler Straße 59, Gondelsheim Mittwoch 05:23 - 22:30 Gondelsheim Marktplatz Donnerstag 05:23 - 22:30 Bruchsaler Straße 7, Gondelsheim Freitag 05:23 - 22:30 Gondelsheim Bahnhof Samstag 07:00 - 22:30 Froschgasse 1, Gondelsheim Sonntag 10:00 - 20:00 Neibsheim Kirche Talbachstraße 10, Germany Neibsheim Große Gasse Talbachstraße 83, Germany -

Sandhasenecho 2017/2018
SANDHASENECHO 2017/2018 WWW.TV-FORST-HANDBALL.DE Vorwort HANDBALL IN FORST - GEMEINSAM ERFOLGREICH! Eine ereignisreiche Saison mit BHV-Pokalfinale, Final Four und VR-Talentiade-Verbandsentscheid liegt hinter uns. Erwartungsfroh starten wir nun in die Handballsaison 2017/2018, in der wir die positive Entwicklung unserer Mannschaften fortsetzen möchten. Auch wenn uns dabei, wie so viele Vereine, strukturelle Probleme beschäftigen, haben wir mit der Verpflichtung neuer Jugendtrainer unsere Bemühungen um die Ausbildung unserer Jugendlichen intensiviert. Mit zwei Herren, zehn Jugendmannschaften (A-Jugend bis SuperMinis) und einer AH32+-Mannschaft haben wir in diesem Jahr nochmals eine Mannschaft mehr für den Spielbetrieb gemeldet wie im Vorjahr. Das Spielertrainer-Duo Marc Fey und Christoph Funke lenkt weiterhin die Geschicke unserer Landesliga-Mannschaft. Die neuen Mannschaften der Liga versprechen dabei viele spannende Spiele und einige packende Lokalderbys. Nach einer tollen vergangenen Runde krönte sich unsere 2.Mannschaft mit der Kreisligameisterschaft und geht in dieser Saison in der Bezirksliga Bruchsal/Pforzheim an den Start. Begleitet wird die Mannschaft bei dieser großen Herausforderung weiterhin von Lothar Schüssler als Trainer. A- und B-Jugend treten in den Bezirksligen der Handballkreise Bruchsal/Karlsruhe/Pforzheim an. Die C-Jugend konnte sich erfolgreich für die Landesliga qualifizieren und unsere D1 hat die Qualifikation zur 1. Kreisliga Heidelberg geschafft. Alle weiteren Jugend-Teams, bis hinab zu den SuperMinis, wetteifern in den Kreisligen des Handballkreises Bruchsal um Punkte. Darüber hinaus wollen wir auch im Kindergarten- und Kleinkind- Alter mit unseren „Krümeln“ und „Purzeln“ die Forster Kinder weiterhin auf Trapp halten und ihnen die Freude an der Bewegung vermitteln. Besonders danken möchte ich daher an dieser Stelle den vielen Übungsleitern und Betreuern der zuvor genannten Mannschaften, die viel Zeit und Herzblut in die Arbeit mit den Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen investieren. -

Schuldner- Beratung
Zuständigkeit Weitere Informationen unter: für den südlichen Landkreis: Hausanschrift: www.landkreis-karlsruhe.de/ Kriegsstraße 78 Schuldnerberatung 76133 Karlsruhe www.meine-schulden.de Herr Behringer für die Gemeinden: Karlsbad, Malsch, Marxzell, www.meineschufa.de Waldbronn und Walzbachtal Mo - Do ganztags, Fr vormittags Telefon 0721 936 - 66 880 Frau Dahy für die Gemeinden: Eggenstein-Leopoldshafen, Pfinztal, Rheinstetten und Stutensee Mo - Do ganztags, Fr vormittags Telefon 0721 936 - 66 350 Frau Mutz Caritasverband Ettlingen für die Gemeinde: Ettlingen (Stadt und Stadtteile) Telefon 07243 515 - 123 Schuldner- Hausanschrift: Lorenz-Werthmann-Straße 2 76275 Ettlingen beratung - Termine jeweils nur nach telefonischer Vereinbarung - im Landkreis Karlsruhe Landratsamt Karlsruhe Dezernat III - Stand: Juli 2020 Amt für Grundsatz und Soziales Die Schuldnerberatung berät und unterstützt Sachgebietsleitung Frau Ebenhöch Sie, wenn Sie in finanziellen Schwierigkeiten im Landratsamt Karlsruhe für die Gemeinden: Bad Schönborn, Gondelsheim, sind. Graben-Neudorf, Hambrücken und Ubstadt- Frau Sauter-Kröper Weiher Di - Fr vormittags, Do ganztags Kriegsstraße 78 Telefon 0721 936 - 65 460 Ziel der Schuldnerberatung 76133 Karlsruhe Telefon 0721 936 - 66 040 ist es, mit Ihnen die Ursachen der [email protected] Ver- bzw. Überschuldung herauszu- Herr Schulze Diakonie Bretten finden und gemeinsam Lösungswege für die Gemeinden: Bretten mit Stadtteilen und zu erarbeiten. Zuständigkeit Oberderdingen für den nördlichen Landkreis: Telefon -
Maßnahmenbericht Nördlicher Oberrhein (Bergland Mit Weschnitz)
Maßnahmenbericht Nördlicher Oberrhein (Teil Bergland mit Weschnitz) zum Hochwasserrisikomanagementplan Oberrhein Inhalt: Beschreibung und Bewertung der Hochwassergefahr und des Hochwasserrisikos Ziele des Hochwasserrisikomanagements Maßnahmen zur Erreichung der Ziele für die verantwortlichen Akteure Zielgruppen: Kommunen, Behörden, Öffentlichkeit FEDERFÜHRUNG Regierungspräsidium Karlsruhe Referat 52 Gewässer und Boden 76247 Karlsruhe www.rp-karlsruhe.de BEARBEITUNG Björnsen Beratende Ingenieure GmbH Diakonissenstraße 29 67346 Speyer www.bjoernsen.de BILDNACHWEIS Deckblatt (Mitte): Saalbachhochwasser 2013, T. Meyer, Brettener Woche STAND November 2014 Hochwasserrisikomanagementplanung in Baden-Württemberg Maßnahmenbericht Nördlicher Oberrhein (Bergland mit Weschnitz) 1 Einführung 7 2 Abgrenzung der relevanten Gewässer im Rahmen der vorläufigen Bewertung des Hochwasserrisikos 11 3 Beschreibung der Hochwassergefahr und des Hochwasserrisikos 14 3.1 Hochwassergefahrenkarten 14 3.1.1 Aufgabe und Vorgehen bei der Erstellung der Hochwasser- gefahrenkarten 14 3.1.2 Rechtliche Auswirkungen der Hochwassergefahrenkarten 17 3.1.3 Hochwassergefahrenkarten im Projektgebiet 17 3.2 Hochwasserrisikokarten 18 3.2.1 Aufgabe und Vorgehen bei der Erstellung der Hochwasser- risikokarten 18 3.2.2 Hochwasserrisikokarten im Projektgebiet 21 3.3 Schlussfolgerungen aus den Hochwassergefahren- und Hochwasser- risikokarten 41 3.3.1 Vorgehen zur Ermittlung der Schlussfolgerungen – verbale Beschreibung und Risikobewertung 41 3.3.2 Flächen mit bewertbaren Risiken im -

I Die Region Gondelsheim in Der Vor- Und Frühgeschichte Die
I Die Region Gondelsheim in der Vor- und Frühgeschichte (FOLKE DAMMINGER) ..15 Die Grundlagen - Geologie und Naturraum 15 Jäger und Sammler - Paläo- und Mesolithikum 15 Die ersten Bauern - Altneolithikum 16 Krise und Wandel - Mittelneolithikum 17 Neue Ideen, neue Materialien - Jung- bis Endneolithikum 18 Prospektoren, Schmiede und Häuptlinge - die Bronzezeit 19 Im Blickpunkt der mediterranen Welt - die Eisenzeit 20 Unter römischer Herrschaft 22 „Zusammengespülte und vermengte Menschen" - die Alamannen 23 Neue Herren im Südwesten - die Franken 25 II Gondelsheim im Mittelalter und in der frühen Neuzeit 27 Standesherren und rebellische Untertanen: Politische Geschichte des Dorfes bis um 1800 27 Die Herrschaftsgeschichte von der Ersterwähnung 1257 bis 1650 (UTE ADLER) 27 Ein Dorf entwickelt sich (THOMAS ADAM) 33 Im Jahrhundert der Kriege (THOMAS ADAM) 37 Die Rebellion von 1730 (THOMAS ADAM) 39 Zum Tod eines frommen und gläubigen Christen: Aus der Leichenpredigt auf Maximilian Freiherr von Mentzingen 40 Der Bankrott des Hauses Mentzingen (THOMAS ADAM) 46 Das lange Mittelalter in Landwirtschaft und Gewerbe 52 Äcker, Wiesen, Weinberge: Landnutzungsformen der Agrargesellschaft (THOMAS ADAM) 53 Bericht der Großherzoglichen Kultur-Inspektion Karlsruhe vom 29. Januar 1885 über die Wiesenwässerung aus dem Saalbach 56 „Verderbliche Grenz- und MarkungsStreitigkeiten" (THOMAS ADAM) 59 Geschichte der Straßen in und um Gondelsheim (WOLFGANG JÖRG) 62 Das Hofgut Bonartshausen (WOLFGANG EBERHARDT) 64 Von Mühlen und Müllern (THOMAS ADAM) 67 Ein kurzer „Rausch": -

Landkreisprofil Landkreis Karlsruhe
__________________________________________________________________________ Landkreisprofil Landkreis Karlsruhe im Rahmen des Pilotvorhabens Fachplan Gesundheit des Ministeriums für Arbeit und Sozialordnung, Familie, Frauen und Senioren Zeitraum: Dezember 2014 bis Mai 2016 erstellt von Dr. Monika Grillenberger und Jochen Paul Käßmann 17.07.2015, modifiziert bis Mai 2016 Ansprechpartnerinnen: Dr. Monika Grillenberger (Koordination) Landratsamt Karlsruhe Dezernat IV Gesundheitsamt Sachgebiet Gesundheitsförderung und Gesundheitsberichterstattung Beiertheimer Allee 2 76137 Karlsruhe Tel: 0721 936-5909 Fax: 0721 936-5143 E-Mail: [email protected] Internet: http://www.landratsamt-karlsruhe.de Pirjo Pfendtner Landratsamt Karlsruhe Dezernat IV Gesundheitsamt Beiertheimer Allee 2 76137 Karlsruhe Tel: 0721 936-5877 Fax: 0721 936-5143 E-Mail: [email protected] Internet: http://www.landratsamt-karlsruhe.de Landkreisprofil Landkreis Karlsruhe 2 Inhalt 1. Beschreibung des Landkreises ...................................................................................... 3 2. Indikatoren ..................................................................................................................... 6 2.1. Methoden .................................................................................................................... 6 2.1.1. Datenquellen ........................................................................................................... 6 2.1.2. Darstellung der Indikatoren ....................................................................................