Statistische Quartalsblätter 1/2016
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

Austria's Presidential Election Is Set to Be Another Vote Dominated by The
Austria’s presidential election is set to be another vote dominated by the issue of immigration blogs.lse.ac.uk/europpblog/2016/03/01/austrias-presidential-election-is-set-to-be-another-vote-dominated-by-the-issue-of-immigration/ 3/1/2016 Austria will hold a presidential election on 24 April, with a run off scheduled for 22 May if no candidate manages to win an absolute majority in the first vote. Emmanuel Sigalas states that while the post itself is largely ceremonial, the election will be a key test of the relative standing of each of the main parties. He writes that the contest is likely to be dominated by the issue of the migration crisis and the creeping influence of the Freedom Party of Austria’s (FPÖ) anti-immigration platform over the Austrian government. On 24 April, young (the voting age is 16) and old Austrians alike will cast their ballot, in person or by post, for the new President of the Republic. She, or most likely he, will replace the incumbent President Heinz Fischer, who will have served two terms in office (i.e. twelve years). By more or less general accord, Fischer has been regarded as a good President. He has fulfilled his predominantly symbolic duties (embodying and promoting national unity and interests) well. His name has not been associated with any scandals, and even if he is not the most charismatic political leader in the country’s history, he has undoubtedly proved to be simpatico. Of course, when Fischer was first elected in 2004 the context was completely different. -

Der Erfolg Der FPÖ: Österreichs Parteien- Und Regierungssystem Unter Druck
Matthias Belafi Der Erfolg der FPÖ: Österreichs Parteien- und Regierungssystem unter Druck Bei der letzten Nationalratswahl in Österreich am 29. September 2013 konnten SPÖ und ÖVP nur noch ganz knapp über 50 % der Stimmen auf sich vereinen, so dass die Neuauflage der »Großen Koalition« nur noch als »MiGroKo« (für: mittelgroße Koali- tion) bezeichnet wurde und als letzte Chance für die beiden Parteien galt.1 Seitdem war die Regierung beinahe schon gelähmt aus Angst vor Neuwahlen, weil davon auszuge- hen war, dass die FPÖ als stärkste Kraft daraus hervorgehen und den nächsten Kanzler stellen werde. Bestätigt wurde diese Sorge durch die Bundespräsidentenwahl im Jahr 2016, die unterstrich, in welcher schwierigen Situation sich die beiden Regierungspar- teien befanden. Im ersten Wahlgang am 24. April gab es ein Kopf-an-Kopf-Rennen der Kandidaten von SPÖ und ÖVP, das erst nach der Auszählung der Briefwahlstimmen entschieden wurde. Dieses enge Rennen zwischen den Kandidaten der Parteien der Großen Koalition drehte sich allerdings nur um die Plätze vier und fünf. Rudolf Hundstorfer von der SPÖ erzielte 11,3, Andreas Khol von der ÖVP 11,1 %. Der FPÖ-Kandidat Norbert Hofer schnitt mit 35 % mit deutlichem Abstand als bester Kandidat ab und unterlag im zweiten Wahlgang am 22. Mai mit 49,65 % nur knapp dem Grünen Alexander Van der Bellen. Die Wahl wurde auf Antrag der FPÖ jedoch wegen Verstößen gegen das Wahlgesetz aufgehoben und – nach einer weiteren Ver- schiebung wegen nichtklebender Wahlumschläge – am 4. Dezember 2016 wiederholt. Hofer verlor diese Stichwahl mit 46,2 %. Aufmerksam und mit Sorge beobachtete qua- si ganz Europa knapp ein Jahr die mögliche Wahl eines freiheitlichen Bundespräsiden- ten in Österreich, die als Signal für den Aufstieg der Rechtspopulisten in Europa galt. -

Österreich-Konvent – Die Umsetzung Der Verfassungsrevision
Demokratiezentrum Wien Quelle online: www.demokratiezentrum.org Quelle print: Demokratiezentrum Wien, April 2004 Barbara Blümel Österreich-Konvent – Die Umsetzung der Verfassungsrevision Was schon vor der Nationalratswahl 2002 im Raum stand1, hat seither konkrete Formen angenommen: Dass in einem „Österreich-Konvent“ ExpertInnen und PolitikerInnen zusammenarbeiten, um so politisch realistische Umsetzungsvorschläge für eine Verfassungsreform zu erarbeiten. Im Jänner 2003 haben der Präsident des Nationalrates Andreas Khol und der damalige Präsident des Bundesrates Herwig Hösele einen ausgearbeiteten Plan zur Einsetzung des Österreich- Konvents vorgelegt2, aber auch die SPÖ machte konkrete Vorschläge. Für Präsident Khol stand fest: „Das Modell ist der Europa-Konvent, der mit der gleichen Frage konfrontiert ist: Was kommt da raus? Das Papier verpflichtet niemanden zu irgendetwas. Aber es hat das Gewicht des Vorsitzenden, das Gewicht, dass alle politischen Kräfte mitgearbeitet haben. Über das Ergebnis wird sich die aktuelle Politik nicht so leicht hinwegsetzen können. 3 Und Ähnliches erwarte ich von der österreichischen Situation.“ 1. Gründung Der Österreich-Konvent wurde durch eine politische Vereinbarung zwischen Nationalrat, Bundesrat (jeweils Präsidialkonferenz), den Landtagen (vertreten durch die Konferenz der 4 Landtagspräsidenten), der Bundesregierung, der Landeshauptleutekonferenz (vertreten durch den vorsitzenden Landeshauptmann), dem Gemeindebund und dem Städtebund eingerichtet. Bundeskanzler Schüssel hat für den 2. Mai 2003 das Gründungskomitee -

Wolfgang Schüssel – Bundeskanzler Regierungsstil Und Führungsverhalten“
View metadata, citation and similar papers at core.ac.uk brought to you by CORE provided by OTHES DIPLOMARBEIT Titel der Diplomarbeit: „Wolfgang Schüssel – Bundeskanzler Regierungsstil und Führungsverhalten“ Wahrnehmungen, Sichtweisen und Attributionen des inneren Führungszirkels der Österreichischen Volkspartei Verfasser: Mag. Martin Prikoszovich angestrebter akademischer Grad Magister der Philosophie (Mag. phil.) Wien, 2012 Studienkennzahl lt. Studienblatt: A 300 Studienrichtung lt. Studienblatt: Politikwissenschaft Betreuer: Univ.-Doz. Dr. Johann Wimmer Persönliche Erklärung Ich erkläre hiermit, dass ich die vorliegende schriftliche Arbeit selbstständig verfertigt habe und dass die verwendete Literatur bzw. die verwendeten Quellen von mir korrekt und in nachprüfbarer Weise zitiert worden sind. Mir ist bewusst, dass ich bei einem Verstoß gegen diese Regeln mit Konsequenzen zu rechnen habe. Mag. Martin Prikoszovich Wien, am __________ ______________________________ Datum Unterschrift 2 Inhaltsverzeichnis 1 Danksagung 5 2 Einleitung 6 2.1 Gegenstand der Arbeit 6 2.2. Wissenschaftliches Erkenntnisinteresse und zentrale Forschungsfrage 7 3 Politische Führung im geschichtlichen Kontext 8 3.1 Antike (Platon, Aristoteles, Demosthenes) 9 3.2 Niccolò Machiavelli 10 4 Strukturmerkmale des Regierens 10 4.1 Verhandlungs- und Wettbewerbsdemokratie 12 4.2 Konsensdemokratie/Konkordanzdemokratie/Proporzdemokratie 15 4.3 Konfliktdemokratie/Konkurrenzdemokratie 16 4.4 Kanzlerdemokratie 18 4.4.1 Bundeskanzler Deutschland vs. Bundeskanzler Österreich 18 4.4.1.1 Der österreichische Bundeskanzler 18 4.4.1.2. Der Bundeskanzler in Deutschland 19 4.5 Parteiendemokratie 21 4.6 Koalitionsdemokratie 23 4.7 Mediendemokratie 23 5 Politische Führung und Regierungsstil 26 5.1 Zusammenfassung und Ausblick 35 6 Die Österreichische Volkspartei 35 6.1 Die Struktur der ÖVP 36 6.1.1. Der Wirtschaftsbund 37 6.1.2. -

The 2016 Austrian Presidential Election: a Tale of Three Divides
The 2016 Austrian Presidential Election: A Tale of Three Divides Mario Gavenda Resul Umit* July 18, 2016 A preprint of the article published in Regional & Federal Studies, 26(3), 419–432. Abstract The 2016 Austrian presidential election was remarkably different than the previous ones in the history of the country characterized by its stable political system. Not only did it open the role of president in Austria to debate, but it also sidelined the two political parties that had dominated Austrian politics since World War II. Alexander Van der Bellen won the election with one of the closest margins in recent history. This article argues that the election divided the country in more than one way. Besides the near 50–50 divide between the candidates, the results show that it generated important dynamics in territorial politics as well, notably in the states and cities of Austria. These results point towards a party system transformation in Austrian politics. Keywords Presidential election; Austria; urban-rural divide; right-wing populism; party system transformation * Corresponding author. 1 Introduction The election of the 12th Federal President of Austria was nothing like the previous ones. First, it put the country’s characteristically stable political system under an unprecedented challenge. From the very beginning, the campaign opened the traditionally ceremonial role of Austrian presidency to debate, with threats of using the constitutional right to dissolve the parliament. After the first round of the election, it became clear that the two parties that created this stability, who had shared the presidential post between themselves since 1945, were out of the race. -

The Marshall Plan in Austria 69
CAS XXV CONTEMPORARY AUSTRIANAUSTRIAN STUDIES STUDIES | VOLUME VOLUME 25 25 This volume celebrates the study of Austria in the twentieth century by historians, political scientists and social scientists produced in the previous twenty-four volumes of Contemporary Austrian Studies. One contributor from each of the previous volumes has been asked to update the state of scholarship in the field addressed in the respective volume. The title “Austrian Studies Today,” then, attempts to reflect the state of the art of historical and social science related Bischof, Karlhofer (Eds.) • Austrian Studies Today studies of Austria over the past century, without claiming to be comprehensive. The volume thus covers many important themes of Austrian contemporary history and politics since the collapse of the Habsburg Monarchy in 1918—from World War I and its legacies, to the rise of authoritarian regimes in the 1930s and 1940s, to the reconstruction of republican Austria after World War II, the years of Grand Coalition governments and the Kreisky era, all the way to Austria joining the European Union in 1995 and its impact on Austria’s international status and domestic politics. EUROPE USA Austrian Studies Studies Today Today GünterGünter Bischof,Bischof, Ferdinand Ferdinand Karlhofer Karlhofer (Eds.) (Eds.) UNO UNO PRESS innsbruck university press UNO PRESS UNO PRESS innsbruck university press Austrian Studies Today Günter Bischof, Ferdinand Karlhofer (Eds.) CONTEMPORARY AUSTRIAN STUDIES | VOLUME 25 UNO PRESS innsbruck university press Copyright © 2016 by University of New Orleans Press All rights reserved under International and Pan-American Copyright Conventions. No part of this book may be reproduced or transmitted in any form, or by any means, electronic or mechanical, including photocopy, recording, or any information storage nd retrieval system, without prior permission in writing from the publisher. -
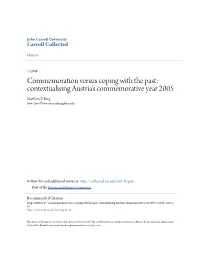
Contextualising Austria's Commemorative Year 2005 Matthew .P Berg John Carroll University, [email protected]
John Carroll University Carroll Collected History 1-2008 Commemoration versus coping with the past: contextualising Austria's commemorative year 2005 Matthew .P Berg John Carroll University, [email protected] Follow this and additional works at: http://collected.jcu.edu/hist-facpub Part of the European History Commons Recommended Citation Berg, Matthew P., "Commemoration versus coping with the past: contextualising Austria's commemorative year 2005" (2008). History. 19. http://collected.jcu.edu/hist-facpub/19 This Article is brought to you for free and open access by Carroll Collected. It has been accepted for inclusion in History by an authorized administrator of Carroll Collected. For more information, please contact [email protected]. Commemoration versus Vergangenheitsbewältigung: Contextualizing Austria’s Gedenkjahr 2005* Abstract This essay explores the politics of memory in post-1945 Austrian political culture, focusing on the shift between the fiftieth anniversary of the Anschluss and the sixtieth anniversary of the end of the Second World War. Postwar Austrian society experienced a particular tension associated with the Nazi past, manifested in communicative and cultural forms of memory. On the one hand, the support of many for the Third Reich—expressed through active or passive complicity—threatened to link Austria with the perpetrator status reserved for German society. On the other, the Allies’ Moscow Declaration (1943) created a myth of victimization by Germany that allowed Austrians to avoid confronting difficult questions concerning the Nazi era. Consequently, discussion of Austrian involvement in National Socialism became a taboo subject during the initial decades of the Second Republic. The 2005 commemoration is notable insofar as it marked a significant break with this taboo. -

Kurt Waldheim: "Ich Habe Nur Meine Pflicht Getan." Diplomarbeit
Kurt Waldheim: "Ich habe nur meine Pflicht getan." Ein Wahlkampf überschattet von einer Debatte um den "Opfermythos" - Pflichterfüllung und der Auseinandersetzung Österreichs mit der eigenen NS Vergangenheit Diplomarbeit zur Erlangung des akademischen Grades eines Magisters der Philosophie an der Karl-Franzens-Universität Graz vorgelegt von Christoph Schneeweiss Am Institut für Geschichte Begutachter: Ao. Univ. – Prof. Dr. phil. Dieter Anton Binder Graz, 2018 Ehrenwörtliche Erklärung Ich erkläre ehrenwörtlich, dass ich die vorliegende Arbeit selbständig und ohne fremde Hilfe verfasst, andere als die angegebenen Quellen nicht benutzt und die den Quellen wörtlich oder inhaltlich entnommenen Stellen als solche kenntlich gemacht habe. Die Arbeit wurde bisher in gleicher oder ähnlicher Form keiner anderen inländischen oder ausländischen Prüfungsbehörde vorgelegt und auch noch nicht veröffentlicht. Die vorliegende Fassung entspricht der eingereichten elektronischen Version. Graz am 26.07.2018 Unterschrift: Christoph Schneeweiss 1 Danksagung Ich bedanke mich bei meinem Betreuer Ao. Univ. – Prof. Dr. phil. Dieter-Anton Binder für die bereitwillige Unterstützung in allen Phasen dieser Diplomarbeit. Ich bedanke mich bei meinen Eltern, die mir meine Ausbildung ermöglichten und mich auf jede ihnen mögliche Art und Weise unterstützten. 2 Inhaltsverzeichnis I Einleitung…………………………………………………………………………………….5 1.1 Forschungsfrage/These………………………………………………………………….....7 1.2 Stand der Forschung……………………………………………………………………….8 1.3 Theoretischer Rahmen……………………………………………………………………..9 -

Online Zu Gott
Ein kleiner Wien 1080 , Lerchenfelder 14, Str. STICH für mich, ACADEMIA Politik. Wirtschaft. Religion. Kultur. 7 Eucharistie am Schirm: ein wichtiger Kirche im Krisenmodus 14 für uns Uni und Covid: alle. ein sozialer Härtefall 21 ÖCV-Bildungsakademie: Erfolgsmodell wird 50 3,00 Jahrgang (AT), 72. | Erscheinungsort: Wien. Österreichische Post M | AG. MZ 02Z030510 € Preis: ONLINE ZU GOTT Wir unterstützen: Wie digital darf/muss Kirche sein? Melden Sie sich für die Corona-Schutzimpfung an. Und unterstützen Sie auch andere Menschen dabei. Weitere Infos zur Corona-Schutzimpfung auf www.uniqa.at Gemeinsam besser leben. Österreichischer Cartellverband 03 | 2021 (Mai) 0259_21_MSY_Inserat_Pflaster_210x280abf.indd 1 01.03.21 11:07 KIRCHE ONLINE Ein Jahr ACADEMIA um 15 Euro Das Jahres-Abo im Umfang von sechs Ausgaben kostet nur 4 7 15 Euro und kann per E-Mail an [email protected] oder per Telefon unter +43-1-405 16 22 31 bestellt werden. Es ge- IHRE STORY IST DIE IHR SOLLT FLEISSIG nügt auch einfach eine Überweisung des Abonnement-Prei- FROHBOTSCHAFT ZUSAMMENKOMMEN ses auf das Konto AT11 3200 0002 1014 5050 (Academia) Wilhelm Ortmayr Lucas Semmelmeyer unter Angabe der Zustelladresse. 14 16 18 11 INFANTILISIERUNG, DREI SEMESTER CHEMISCHE SYNTHESEN? „WIENER ZEITUNG“ DEPRESSIONEN, NOTFALL-MODUS NICHT IM HOME-OFFICE Engelbert Washietl SELBSTMORDE Christoph Riess Lucas Semmelmeyer Léopold Bouchard 21 26 29 24 2+2 = … „BEMERKENSWERTE PREMIERE VON THEOLYMPIA 50 JAHRE LANG MODERN … EIN ANWENDUNGSBEISPIEL BEMÜHUNGEN“ Marie-Theres Igrec, Florian Tursky FÜR EINE ADDITION Gerhard Hartmann Lucas Semmelmeyer Wolfram Kreipl 10 / 33 32 34 37 REZENSIONEN EIN SCHRITT ZUR ES GILT DIE LÖSUNGSBEGABUNG PICKELHAUBE UNSCHULDSVERMUTUNG Franz Mayrhofer Gerhard Hartmann Herbert Kaspar 38 LESERBRIEFE OFFENLEGUNG Medieninhaber: Cartellverband der katholischen österreichischen Studentenverbindungen (ÖCV). -

The Waldheim Phenomenon in Austria
Demokratiezentrum Wien Onlinequelle: www.demokratiezentrum.org Printquelle: Mitten, Richard: The Politics of the Antisemitic Prejudice. The Waldheim Phenomenon in Austria. Westview Press, Boulder, Colorado 1992 (Chapter 1 and 8) Richard Mitten THE POLITICS OF ANTISEMITIC PREJUDICE : THE WALDHEIM PHENOMENON IN AUSTRIA Table of Contents: Acknowledgments Chapter One: Introduction: “Homo austriacus” agonistes Chapter Two: Austria Past and Present Chapter Three: From Election Catatonia to the “Waldheim Affair” Chapter Four: “What did you do in the war, Kurt?” Chapter Five: Dis“kurt”esies: Waldheim and the Language of Guilt Chapter Six: The Role of the World Jewish Congress Chapter Seven: The Waldheim Affair in the United States Chapter Eight: The “Campaign” against Waldheim and the Emergence of the Feindbild Chapter Nine: When “The Past” Catches Up 1 Autor/Autorin: Richard Mitten • The Campaign against Waldheim and the Emergence of the Feindbild Printquelle: Mitten, Richard: The Politics of the Antisemitic Prejudice. The Waldheim Phenomenon in Austria. Westview Press, Boulder, Colorado 1992 (Chapter 1 and 8) • Onlinequelle: www.demokratiezentrum.org Demokratiezentrum Wien Onlinequelle: www.demokratiezentrum.org Printquelle: Mitten, Richard: The Politics of the Antisemitic Prejudice. The Waldheim Phenomenon in Austria. Westview Press, Boulder, Colorado 1992 (Chapter 1 and 8) Introduction: “Homo austriacus” agonistes Gaiety, a clear conscience, the happy deed, the confidence in the future---all these depend, for the individual as well as for a people, on there being a line that separates the forseeable, the light, from the unilluminable and the darkness; on one’s knowing just when to forget, when to remember; on one’s instinctively feeling when necessary to perceive historically, when unhistorically. -

Austria - the World Factbook
Austria - The World Factbook https://www.cia.gov/the-world-factbook/countries/austria/ Explore All Countries — Austria Europe INTRODUCTION Background Once the center of power for the large Austro-Hungarian Empire, Austria was reduced to a small republic after its defeat in World War I. Following annexation by Nazi Germany in 1938 and subsequent occupation by the victorious Allies in 1945, Austria's status remained unclear for a decade. A State Treaty signed in 1955 ended the occupation, recognized Austria's independence, and forbade unification with Germany. A constitutional law that same year declared the country's "perpetual neutrality" as a condition for Soviet military withdrawal. The Soviet Union's collapse in 1991 and Austria's entry into the EU in 1995 have altered the meaning of this neutrality. A prosperous, democratic country, Austria entered the EU Economic and Monetary Union in 1999. GEOGRAPHY Location Central Europe, north of Italy and Slovenia Geographic coordinates 47 20 N, 13 20 E Map references Europe Area total: 83,871 sq km land: 82,445 sq km 1 of 19 4/27/2021, 8:40 AM Austria - The World Factbook https://www.cia.gov/the-world-factbook/countries/austria/ water: 1,426 sq km country comparison to the world: 114 Area - comparative about the size of South Carolina; slightly more than two-thirds the size of Pennsylvania Land boundaries total: 2,524 km border countries (8): Czech Republic 402 km, Germany 801 km, Hungary 321 km, Italy 404 km, Liechtenstein 34 km, Slovakia 105 km, Slovenia 299 km, Switzerland 158 km Coastline -

European Parliament Press Releases
Compilation of Press releases from the European Parliament and the Austrian Parliament concerning the Joint Parliamentary Meeting on the Future of Europe, held in Brussels the 8 and 9 May 2006 European Parliament Press releases Future of Europe/European integration Joint parliamentary meeting on the Future of Europe puts enlargement in the limelight On the eve of "Europe Day", nearly 250 members of the European Parliament and EU national Parliaments gathered in Brussels to discuss the future of Europe now that the introduction of a new treaty has been put on hold. In his opening speech, EP president Josep Borrell called for a "period of proposals" to follow the "period of reflection", which was introduced after the draft constitutional treaty was rejected by referendums in France and the Netherlands. Mr Borrell reminded the meeting that the Nice Treaty was "insufficient for the future" and that there were "pressing questions to be answered", even though "the answers are not always easy to find". The Convention, which drew up the first draft of the Constitution, has perhaps "underestimated the unease of our fellow citizens", he said, adding, "we are gathered here to debate how we can re-launch the dynamism of the European project and restore confidence among the people who have elected us". At the moment, the EU was focussing too much on sectoral policies, he said, "as if the lack of a comprehensive European project is making us resigned to a Europe of projects". Mr Borrell didn't want to pretend that the two-day meeting in the European Parliament was going to solve everything, "but the simple fact that we, European and national parliamentarians, work on this together, for me is symbolic and a sign of hope".