25 Jahre Intercity Express
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

University of Cincinnati
UNIVERSITY OF CINCINNATI Date: August 6th, 2007 I, __________________Julia K. Baker,__________ _____ hereby submit this work as part of the requirements for the degree of: Doctorate of Philosophy in: German Studies It is entitled: The Return of the Child Exile: Re-enactment of Childhood Trauma in Jewish Life-Writing and Documentary Film This work and its defense approved by: Chair: Dr. Katharina Gerstenberger Dr. Sara Friedrichsmeyer Dr. Todd Herzog The Return of the Child Exile: Re-enactment of Childhood Trauma in Jewish Life-Writing and Documentary Film A Dissertation submitted to the Division of Research and Advanced Studies University of Cincinnati In partial fulfillment of the Requirements for the degree of DOCTORATE OF PHILOSOPHY (Ph.D.) In the Department of German Studies Of the College of Arts and Sciences 2007 by Julia K. Baker M.A., Bowling Green State University, 2000 M.A., Karl Franzens University, Graz, Austria, 1998 Committee Chair: Katharina Gerstenberger ABSTRACT “The Return of the Child Exile: Re-enactment of Childhood Trauma in Jewish Life- Writing and Documentary Film” is a study of the literary responses of writers who were Jewish children in hiding and exile during World War II and of documentary films on the topic of refugee children and children in exile. The goal of this dissertation is to investigate the relationships between trauma, memory, fantasy and narrative in a close reading/viewing of different forms of Jewish life-writing and documentary film by means of a scientifically informed approach to childhood trauma. Chapter 1 discusses the reception of Binjamin Wilkomirski’s Fragments (1994), which was hailed as a paradigmatic traumatic narrative written by a child survivor before it was discovered to be a fictional text based on the author’s invented Jewish life-story. -

Mezinárodní Komparace Vysokorychlostních Tratí
Masarykova univerzita Ekonomicko-správní fakulta Studijní obor: Hospodářská politika MEZINÁRODNÍ KOMPARACE VYSOKORYCHLOSTNÍCH TRATÍ International comparison of high-speed rails Diplomová práce Vedoucí diplomové práce: Autor: doc. Ing. Martin Kvizda, Ph.D. Bc. Barbora KUKLOVÁ Brno, 2018 MASARYKOVA UNIVERZITA Ekonomicko-správní fakulta ZADÁNÍ DIPLOMOVÉ PRÁCE Akademický rok: 2017/2018 Studentka: Bc. Barbora Kuklová Obor: Hospodářská politika Název práce: Mezinárodní komparace vysokorychlostích tratí Název práce anglicky: International comparison of high-speed rails Cíl práce, postup a použité metody: Cíl práce: Cílem práce je komparace systémů vysokorychlostní železniční dopravy ve vybra- ných zemích, následné určení, který z modelů se nejvíce blíží zamýšlené vysoko- rychlostní dopravě v České republice, a ze srovnání plynoucí soupis doporučení pro ČR. Pracovní postup: Předmětem práce bude vymezení, kategorizace a rozčlenění vysokorychlostních tratí dle jednotlivých zemí, ze kterých budou dle zadaných kritérií vybrány ty státy, kde model vysokorychlostních tratí alespoň částečně odpovídá zamýšlenému sys- tému v ČR. Následovat bude vlastní komparace vysokorychlostních tratí v těchto vybraných státech a aplikace na český dopravní systém. Struktura práce: 1. Úvod 2. Kategorizace a členění vysokorychlostních tratí a stanovení hodnotících kritérií 3. Výběr relevantních zemí 4. Komparace systémů ve vybraných zemích 5. Vyhodnocení výsledků a aplikace na Českou republiku 6. Závěr Rozsah grafických prací: Podle pokynů vedoucího práce Rozsah práce bez příloh: 60 – 80 stran Literatura: A handbook of transport economics / edited by André de Palma ... [et al.]. Edited by André De Palma. Cheltenham, UK: Edward Elgar, 2011. xviii, 904. ISBN 9781847202031. Analytical studies in transport economics. Edited by Andrew F. Daughety. 1st ed. Cambridge: Cambridge University Press, 1985. ix, 253. ISBN 9780521268103. -

CHRONOLOGIE Herbert Harrer
CHRONOLOGIE Herbert Harrer 1836 Am lZ Februar sucht Simon Georg Sina 1845 Am 15. Januar wird der Bau der Streckenach 1855 Am 12. Februarwird der Kauf der Linie 1873 Am 4. Mai werden die neuenTrassen Freiherr von Hodos um eine Konzession Brucka.d. Leitha neuerlich aufgenommen. Wien - Bruck a.d. Leitha genehmigt, die der Verbindungsbahn Richtung Haupt fOreine Bahn Wien - Raab an. Der Bahn 1845 Der Raaber Bahnhof(an der Stelle des Obernahme durch die StEG erfolgt am zollamt (heute Wien Mitte) durch den hof ist beim "Canalhafen" (des Wiener spateren Ostbahnhofes) wird weitgehend 1.Oktober 1855. Arsenal- und den Steudeltunnel mit Neustiidter Kanals, heute BahnhofWien fertiggestellt. 1856 Simon Georg Sina Freiherrvon Hodos Aufnahme des Personenverkehrs Mitte) geplant. 1846 Am 31. Juliwird die StreckeWien - Bruck stirbt am 18. MaL er6ffnet. 1837 Am 1. Marz akzeptiert Sina geanderte Be a.d. Leithaeingleisig fertiggestellt. Die 1857 Am 1.August fiihrt der erste Schnellzug 1873 Der Frachtenbahnhof der StEG (AufschGt dingungen der Regierung - damit ist der Eroffnung des Bahnhofs und der Strecke von Wien nach Ljubljana (Laibach). tung bis 5 Meter) wird mit 15Gleisen Standort des spatersn SOd- und Ostbahn verzogertsich wegen Hochwassers 1857 Am 15. Oktober wird die Verbindungsbahn gebaut. hofes fixiert. bis 12. September. zum Hauptzollamt (heute Wien Mitte) mit 1873 Am 15. Mai wird die Strecke Favoriten 1838 Sina erhalt am 2. Januareine vcrlauflge 1848 Von 9.Oktober bis 15. Novemberist der der Trasse Gberden Ghegaplatz und durch Frachtenbahnhof der StEG - als erste Baugenehmigung. Verkehrauf der BruckerLiniewegen der den SchweizerGarten eroffnet. direkte Verbindung zwischen SOd- und 1838 20. Marz, GrOndung der Wien-Raaber Revolution eingestellt. -

Neuchâtel- Arc Jurassien
Septembre 2010 No 7 Transports romands Claude Nicati (sp) Neuchâte l-Arc jurassien: 150 ans Bulletin d’information sur les transports publics de Suisse romande et de France voisine EDITORIAL Vision multimodale u cœur de l’Arc jurassien, le Le rail célèbre 150 ans de Pays de Neuchâtel jouit d’une situation géographique privi - légiée à tous égards et est largement vitalité en pays neuchâtelois Aouvert sur le monde par son histoire et sa trajectoire économique. Frontalier de la France, il ne se trouve qu’à une demi-heure de la Ville fédé - rale, à trois-quarts d’heure de Lausanne et à un peu plus d’une heure de la métropole économique de Zurich et de la cité internationale de Genève. Certes, le canton de Neuchâtel a dû faire face dans son passé à de nom - breuses difficultés économiques et financières. Des solutions adéquates ont cependant toujours été trouvées pour les surmonter. Actuellement, de nombreux efforts sont déployés en vue de le doter de structures modernes et attractives nécessaires à une dyna - mique de développement économique durable. La politique des transports neuchâte - ICN près de Colombier, sur la ligne du Pied du Jura, axe majeur du réseau des CFF. (photo cff) lois n’échappe pas à ce processus. C’est ainsi que notre canton a décidé d’ins - crire ses projets de transports dans une ssez curieusement, le qu’à se brancher aux réseaux châtel – Berne), à voie normale, vision multimodale, d’adopter une canton de Neuchâtel a été international et confédéral. puis par les lignes à voie métrique approche coordonnée et convergente un pionnier ferroviaire en Dès lors, le canton se divisa (déjà) La Chaux-de-Fonds – Les Ponts- de la planification des transports et du Suisse. -

Zugbildungen Deutsche Reichsbahn, Ep. III/IV
Deutsche Reichsbahn, Ep. III/IV Zugbildungen Eilzug der 1950er Jahre: Eilzüge verkehrten über mittelgroße Entfernungen (meist zwischen zwei Ballungsräumen) und hielten nur in den wichtigeren Bahnhöfen. (Art. 02100 – 01563 – 13160) Personenzug Nahverkehr: Typischer Nebenbahnpersonenzug der 1980er Jahre. (Art. 04586 – 01561) D-Zug der 1960er Jahre. (Art. 02145 – 13896 – 16920 – 16900 – 16970 – 16940) Nahgüterzug: Die V 36 übernahm teilweise auch den leichten Streckendienst. (Art. 04630 – 13421 – 14125 – 01586 – 15611) D-Zug Mitte Epoche IV: Kombinierter Zug mit Reisezugwagen der frühen Ep. IV (schwarze Längsträger) und Speisewagen der späten Epoche IV. (Art. 02450 – 01570 – 16750 – 16340) Militärtransport der NVA (Art. 02673 – 01592 – 01593) Städteexpress für den hochwertigen Fernverkehr der 1980er Jahre (Art. 02337 – 01602 – 01603) Deutsche Bundesbahn, Ep. III/IV Zugbildungen Personenzug mit Güterbeförderung: Gebildet aus Personen- und Güterwagen. (Art. Lok aus 01585 – 13003 – 13013 – 13006 – 01574) Nahgüterzug der 1980er Jahre. (Art. 04634 – 15241 – 01582 – 14479 – 15610) Intercity der Ep. IV. (Art. 02431 – 13530 – 13697 – 3 x 16500) Durchgangsgüterzug der 1960er Jahre: Loks mit Kabinentender machten den Packwagen für den Aufenthalt des Güterzug-Begleitpersonals entbehrlich. (Art. 02093 – 01587 – 14576 – 2 x 17150) Schnellzug Anfang der Epoche IV. (Art. 02451 – 2 x 16941 – 16971 – 16901 – 16921) Internationaler Schnellgüterzug TEEM (Trans Europ Express Marchandises): Diese Züge – meist bestehend aus gedeckten Wagen – fuhren in festen Relationen durch mehrere europäische Länder. (Art. 02500 – 17152 – 17151 – 14691 – 15830 – 15495) Schnellzug der 1980er Jahre. (Art. 02382 – 13676 – 13677 – 13677 – 13678 – 13517) Deutsche Bahn AG Zugbildungen InterCity (IC): Als IC verkehren bei der DB AG schnellfahrende Fernverkehrszüge, die aus höherwertigem Wagenmaterial zusammengestellt sind. In der Übergangszeit zwischen alter und neuer IC-Lackierung wurden häufig Fahrzeuge beider Farbschemen miteinander kombiniert. -

TGV Rhin - Rhône Bulletin D’Information Sur Les Transports Publics De Suisse Romande Et De France Voisine Jean-Pierre Chevènement (Sp)
Décembre 2011 No 12 Transports romands TGVRhin - Rhône Bulletin d’information sur les transports publics de Suisse romande et de France voisine Jean-Pierre Chevènement (sp) EDITORIAL Lien fédérateur franco-suisse Un projet suisse autant que français e TGV Rhin-Rhône est naturel- lement un TGV franco-suisse. Je veux noter l’importance de la liaison avec Bâle, Zurich et Berne: là Lsont les principaux bassins de popula- tion. Avec la réalisation de la deuxième tranche de la branche Est Belfort-Mul- house, Bâle est à trois heures de Paris. De même, la réouverture d’une liaison cadencée Belfort-Delle-Delémont- Bienne va offrir aux Jurassiens un accès aisé à la gare TGV de Belfort- Montbéliard, à Meroux. Bien entendu, je n’oublie pas les Suisses de la région lémanique: Lau- sanne accessible à partir de Dijon et Dole qui bénéficiera de la réalisation Vue aérienne de la gare Besançon - Franche-Comté TGV, implantée près d’Auxon. (photo sncf/arep) de la branche Ouest Dijon-Montbard prévue à l’horizon des années 2020 et Genève par la ligne du Haut-Bugey. amais sans doute, ligne fer- maire de Belfort, qui avait com- crédits. La Suisse elle-même par- Le TGV Rhin-Rhône est riche de pos- roviaire n’a fédéré autant pris, dès 1985, l’importance de ticipa au financement d’une ligne sibilités futures. La branche Sud vers d’acteurs de l’Arc jurassien cette étoile. Car le TGV Est Stras- construite hors de son territoire, Lyon offrira aux Suisses un accès faci- franco-suisse et n’a mobilisé bourg – Paris menaçait de couper mais qui a l’avantage de l’amar- lité à la Méditerranée, à la Provence, au Jautant d’énergie pour mener à la Franche-Comté, le sud de l’Al- rer au réseau européen à grande Languedoc et à l’Espagne. -
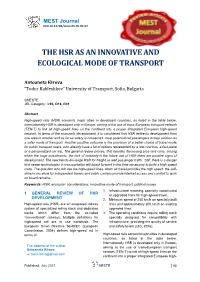
The Hsr As an Innovative and Ecological Mode of Transport
MEST Journal DOI 10.12709/mest.05.05.02.07 THE HSR AS AN INNOVATIVE AND ECOLOGICAL MODE OF TRANSPORT Antoaneta Kirova “Todor Kableshkov” University of Transport, Sofia, Bulgaria ©MESTE JEL Category: L92, O18, R41 Abstract High-speed rails (HSR) connects major cities in developed countries, as listed in the table below. Internationally HSR is developed only in Europe, aiming at the use of trans-European transport network (TEN-T) to link all high-speed lines on the continent into a proper integrated European high-speed network. In terms of the economic development, it is considered that HSR redirects development from one area to another and as far as safety is concerned, most potential rail passengers accept aviation as a safer mode of transport. Another positive outcome is the provision of a better choice of travel mode for public transport users, who already have a lot of options represented by a low-cost bus, a fast plane or a personalized car trip. The general review proves, that besides discussing pros and cons, among which the huge investments, the lack of certainty in the future use of HSR there are positive signs of development. The new trends envisage HSR for freight as well passenger traffic. Still, there is a danger that newer technologies in transportation will boost forward in the time necessary to build a high-speed route. The question who will use the high-speed lines, when air travel provides the high speed, the self- driven cars allow for independent travels and public carriers provide Internet access and comfort to work on board remains. -
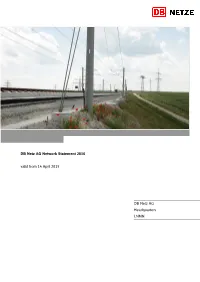
DB Netz AG Network Statement 2016 Valid from 14 April 2015 DB Netz
DB Netz AG Network Statement 2016 valid from 14 April 2015 DB Netz AG Headquarters I.NMN Version control Date Modification 12.12.2014 Amendment of Network Statement 2015 as at 12 December 2014 (Publication of the Network Statement 2016) Inclusion of detailed information in sections 1.9 ff and 4.2.5 ff due to 14.10.2015 commissioning of rail freight corridors Sandinavian-Mediterranean and North Sea-Balitc. Addition of connection to Port of Hamburg (Hohe Schaar) in section 13.12.2015 3.3.2.5 Printed by DB Netz AG Editors Principles of Network Access/Regulation (I.NMN) Theodor-Heuss-Allee 7 60486 Frankfurt am Main Picture credits Front page photo: Bildschön, Silvia Bunke Copyright: Deutsche Bahn AG Contents Version control 3 List of Annexes 7 1 GENERAL INFORMATION 9 1.1 Introduction 9 1.2 Purpose 9 1.3 Legal basis 9 1.4 Legal framework of the Network Statement 9 1.5 Structure of the Network Statement 10 1.6 Term of and amendments to the Network Statement 10 1.7 Publication and opportunity to respond 11 1.8 Contacts at DB Netz AG 11 1.9 Rail freight corridors 12 1.10 RNE and international cooperation between DB Netz AG and other RIUs 14 1.11 List of abbreviations 15 2 CONDITIONS OF ACCESS 16 2.1 Introduction 16 2.2 General conditions of access to the railway infrastructure 16 2.3 Types of agreement 17 2.4 Regulations and additional provisions 17 2.5 Special consignments 19 2.6 Transportation of hazardous goods 19 2.7 Requirements for the rolling stock 19 2.8 Requirements for the staff of the AP or the involved RU 20 2.9 Special conditions -

Ihre Anfahrt Zu MSA
Anfahrt zu MSA_Berlin_2015_Layout 1 20.02.2015 09:59 Seite 1 Ihre Anfahrt zu MSA Wir freuen uns auf Ihren Besuch... MSA • Thiemannstraße 1 • D-12059 Berlin Telefon: +49 30 6886-0 • Telefax: +49 30 6886-1558 • [email protected] • www.MSAsafety.com 1 Thiemannstraße Hertzbergplatz MSA safety .com Anfahrt zu MSA_Berlin_2015_Layout 1 20.02.2015 09:59 Seite 2 Ihre Anfahrt zu MSA Wir freuen uns auf Ihren Besuch... MSA • Thiemannstraße 1 • D-12059 Berlin Telefon: +49 30 6886-0 • Telefax: +49 30 6886-1558 • [email protected] • www.MSAsafety.com Mit dem PKW Mit der Bahn Mit dem Flugzeug Hamburg/Bremen/Rostock Berlin-Hauptbahnhof (DB) Von Tegel A10 Berliner Ring Richtung Berlin-Zentrum. Taxi: Fahrzeit ca. 20 min. Taxi: Fahrzeit ca. 30 min. Abfahrt Dreieck Oranienburg auf A111, Öffentliche Verkehrsmittel: S-Bahn S9 bis Treptower Park Öffentliche Verkehrsmittel: A100 folgen Richtung Dresden, Abfahrt Grenzallee. oder S3, S5, S7, S75 bis Ostkreuz. S41 bis Sonnenallee. Bus 109 oder X9 bis Jakob-Kaiser-Platz. Rechts in die Grenzallee, zweite Straße links in die Sonnenallee, U-Bahn U7 Richtung Rudow bis Hermannplatz. Berlin-Ostbahnhof (DB) dritte Straße rechts in die Thiemannstraße. Bus M41 Richtung Baumschulenstraße bis Hertzbergplatz. Taxi: Fahrzeit ca. 15 min. Hannover/Nürnberg Öffentliche Verkehrsmittel: Wie von Hauptbahnhof kommend. Von Schönefeld A10 Berliner Ring bis Schönefelder Kreuz. Taxi: Fahrzeit ca. 25 min. Berlin-Lichtenberg (DB) Abfahrt Richtung Berlin-Zentrum, A113 bis Ende. Öffentliche Verkehrsmittel: Taxi: Fahrzeit ca. 15 min. 2 Rechts B96a über Adlergestell, Grünauer Straße, Schnellerstraße, S-Bahn S45 bis Köllnische Heide. Öffentliche Verkehrsmittel: S-Bahn S5, S7, S75 bis Ostkreuz. -

Reference List / Glas Trösch Ag Rail
02.10.2017/JG REFERENCE LIST / GLAS TRÖSCH AG RAIL Train Identification Train Identification Homologation Impact Speed Country of Year of the first Train Manufacture Operator / Owner Continent Other information Photo from Manufacture from Operator Standard (Test projectile) operation delivery TSI HS RST Front windscreen with film Ansaldo Breda ETR 1000 EUROPA V300 Zefiro Trenitalia Norm: 600 km/h Italy 2012 heating system EN 15152 High speed TSI HS RST Front windscreen with Bombardier CRH1-380 ASIA Zefiro China Railways Norm: 540 km/h China 2011 wire heating system EN 15152 High speed TSI HS RST Front windscreen Upper SIEMENS VELARO RENFE AVES103 530 km/h Spain EUROPA 2003 and lower with wire Norm: UIC 651 heating system High speed TSI HS RST Front windscreen Upper SIEMENS ICE 3 DB 403 530 km/h Germany EUROPA 1998 and lower with wire Norm: UIC 651 heating system High speed TSI HS RST Front windscreen with SIEMENS 411 EUROPA VELARO D DB Norm: 520 km/h Germany 2009 wire heating system EN 15152 High speed TSI HS RST United Front windscreen with SIEMENS 320 EUROPA VELARO D EUROSTAR Norm: 520 km/h Kingdom - 2012 wire heating system EN 15152 France High speed page 1 of 4 02.10.2017/JG REFERENCE LIST / GLAS TRÖSCH AG RAIL Train Identification Train Identification Homologation Impact Speed Country of Year of the first Train Manufacture Operator / Owner Continent Other information Photo from Manufacture from Operator Standard (Test projectile) operation delivery TSI HS RST Front windscreen with SIEMENS HT 80001 EUROPA VELARO D Norm: 520 km/h Turkey -

Participating Hotels - Fixed Members' Rate Northern Europe -10%
participating hotels - Fixed Members' Rate Northern Europe -10% Hotel Code Hotel Name Country Brand H7309 ibis Yerevan Center ARMENIA IBIS H5210 ibis Bregenz AUSTRIA IBIS H1917 ibis Graz AUSTRIA IBIS H5174 ibis Innsbruck AUSTRIA IBIS H1722 ibis Linz City AUSTRIA IBIS H3748 ibis Salzburg Nord AUSTRIA IBIS H3747 ibis Wien City AUSTRIA IBIS H8564 ibis Wien Hauptbahnhof AUSTRIA IBIS H2736 ibis Wien Messe AUSTRIA IBIS HB3Y1 ibis Styles Klagenfurt am Woerthersee AUSTRIA IBIS STYLES HB426 ibis Styles Parndorf Neusiedler See AUSTRIA IBIS STYLES H9034 ibis Styles Wien City AUSTRIA IBIS STYLES HB1C2 ibis Styles Wien Messe Prater AUSTRIA IBIS STYLES H5742 Hotel Mercure Graz City AUSTRIA MERCURE HOTEL HA0Q7 Hotel Mercure Raphael Wien AUSTRIA MERCURE HOTEL H0984 Hotel Mercure Salzburg City AUSTRIA MERCURE HOTEL H9959 Hotel Mercure Vienna First AUSTRIA MERCURE HOTEL H1568 Hotel Mercure Wien City AUSTRIA MERCURE HOTEL H5358 Hotel Mercure Wien Westbahnhof AUSTRIA MERCURE HOTEL H0781 Hotel Mercure Wien Zentrum AUSTRIA MERCURE HOTEL H1276 Hotel Am Konzerthaus Vienna - MGallery AUSTRIA MGALLERY H6154 Novotel Wien City AUSTRIA NOVOTEL H8565 Novotel Wien Hauptbahnhof AUSTRIA NOVOTEL H3720 Novotel Suites Wien City Donau AUSTRIA NOVOTEL SUITES H6599 SO/ Vienna AUSTRIA SO BY SOFITEL HA1L0 ibis Baku City AZERBAIDJAN IBIS HA593 Fairmont Baku Flame Towers AZERBEIJAN FAIRMONT HB5M6 Adagio Access Brussels Delta BELGIUM ADAGIO ACCESS H1453 ibis Antwerpen Centrum BELGIUM IBIS H1047 ibis Brugge Centrum BELGIUM IBIS 1 page of 25 / 20.07.2021 participating hotels - Fixed -

Die Queen Fährt Panorama-S-Bahn
Fahrplanwechsel 2005 Wohlfühlurlaub bei DB Regio – Neuerungen und im Winter Veränderungen – Angebote der TMB Ī Seiten 9/10 Ī Seite 23 TMB Tourismus-Marketing Brandenburg GmbH ᵸ Bahn Berlin Deutsche Bahn Gruppe 4. November punkt Die Queen fährt . 21/2004 Nr 3 Reisen in Berlin und Brandenburg Panorama-S-Bahn as gab es in der über 80-jährigen Geschichte Dder Berliner S-Bahn noch nicht: Für die Fahrt der britischen Königin von Berlin Ostbahnhof nach Potsdam wurde an Stelle des komfor- tablen Bentley der ähnlich komfortable gläserne Zug der S-Bahn Berlin eingesetzt. Staunende Fahrgäste auf den Bahnsteigen der Stadtbahn am Mittwoch Mittag. Lesen Sie auch Ī Seite 3 Die Queen im Gespräch mit Hartmut Mehdorn (links) und dem britischen Botschafter Sir Peter Torry. Foto: DB AG/Darchinger S-BAHN IM INTERNET Das Brandenburg-Ticket Neue Fahrplantabellen Den ab 12. Dezember gültigen Der Fahrschein für S-Bahn-Fahrplan können Sie bereits jetzt im Internet unter www.s-bahn-berlin.de abrufen und sich so erstmals langfristig auf die viele Gelegenheiten Änderungen einstimmen. Diese halten sich diesmal allerdings in Grenzen Fünf Reisende, die Bahn. Alle wichtigen und betreffen vor allem die Linien S 3, zwischen Montag und Details zum neuen, alten S 5 und S 7. Der nächste Fahrplan- Sonntag einen ganzen Tag lang Bekannten Brandenburg- wechsel bei der S-Bahn erfolgt bereits unterwegs sind, kreuz und quer Ticket finden Sie in unse- am 25. Februar 2005, wenn die mit der Bahn durchs Land rem Abc auf den verlängerte S 25 nach Teltow in fahren – mit dem Brandenburg- Ī Seiten 12 bis 14.