Planfeststellungsbesch
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

Am Wiesbadener „Rheinsteig“
119-136-Kümmerleneu 03.12.2007 10:25 Uhr Seite 119 Jb. nass. Ver. Naturkde. 128 S. 119-136 13 Abb. Wiesbaden 2007 Geologie auf Schritt und Tritt – am Wiesbadener „Rheinsteig“ EBERHARD KÜMMERLE Rhein, Rheinsteig, Geologie, Fossilien, Landschaft, Quellen Kurzfassung: Nach der Erfahrung, dass man nur das sieht oder beachtet, was man weiß, werden geologische Details dargestellt, die sich dem interessierten Wanderer auf dem Rheinsteig zeigen. Inhaltsverzeichnis 1 Zielsetzung ........................................................................................... 119 2 Am alten und neuen Rheinufer ............................................................. 119 3 Zur Küste des Mainzer Meeresbeckens ................................................ 123 4 Landschaft aus einigen der ältesten Gesteine Europas .......................... 126 5 Im Tal der Quellen und Schlangen ........................................................ 131 6 Dank ..................................................................................................... 135 7 Literatur ................................................................................................ 135 1 Zielsetzung Der Rheinsteig, ein 320 km langer, an Abwechslung reicher Wanderweg, führt von Wiesbaden-Biebrich durch den Rheingau, das Mittelrheintal und das Sieben- gebirge bis nach Bonn. Er wurde im September 2005 eröffnet. Er hat nicht nur im Hinblick auf die wunderschöne Landschaft, auf die vielen Burgen und die male- rischen Dörfer und kleinen Städte, die er tangiert, viel zu bieten, sondern -

Planungsraumprofile Schierstein
Schierstein- Schierstein- Amt für Statistik Wohndauer Schierstein Arbeitsmarkt Schierstein und Stadtforschung Mitte Mitte Neubürger/-innen 13,3 % 12,9 % Sozialversicherungs- 2 308 4 228 Stadtteilprofile 2021 Wohndauer von Erwach- pflichtig Beschäftigte senen unter 2 Jahre ohne Selbständige und Planungsraum Beamte Alteingesessene 31,4 % 31,4 % Schierstein-Mitte Wohndauer von Erwach- Beschäftigtenquote 65,9 % 65,6 % senen über 20 Jahre Anteil an den 18- bis Schierstein- 64-Jährigen Bevölkerung Schierstein Melderegister 01.01.2021 Mitte Arbeitslose 199 331 Einwohner/-innen 5 616 10 642 Schierstein- Haushalte Schierstein Anteil Arbeitslose u. 25 J. 8,5 % 9,1 % Mitte Anteil an der Arbeitslosenquote 6,2 % 5,7 % Gesamtbevölkerung: Haushalte 2 974 5 373 Bundesagentur für Arbeit, eigene Berechnungen Personen mit Migrations- 33,3 % 35,2 % Haushalte mit Kindern 17,7 % 20,2 % 30.09.2020 (Beschäftigte), September 2020 (Arbeitslose) hintergrund* Alleinerziehende 3,6 % 3,9 % Ausländer/-innen 16,0 % 16,8 % Kaufkraft je Einwohner Schierstein- Schierstein Einpersonenhaushalte 10,2 % 9,9 % und Jahr Mitte Spätaussiedler* 5,6 % 5,1 % mit 75-Jährigen und in € . 25 897 Melderegister 01.01.2021, * Zuordnungsverfahren auf Basis des Älteren Melderegisters 01.01.2021 Wiesbaden=100 . 97 Zuordnungsverfahren auf Basis des Melderegisters 01.01.2021 IFH Unternehmensberatung, Stand: März 2021 Die häufigsten Wohnungen und Schierstein- Schierstein- Schierstein ausländischen Schierstein Neubau Mitte Schierstein- Mitte Individualverkehr Schierstein Staatsangehörigkeiten -

Jahre 2010-2008 22.03.2010
Hier findet ihr eine Zusammenfassung der Zeitungsberichte über den SV Schierstein 1913. Für die Richtig- und Vollständigkeit der Inhalte und gültigkeit der enthaltenen Links können wir keinerlei Verantwortung übernehmen. Es gilt unser Online-Impressum unter http://www.schierstein13.de/impressum.html Pressearchive aus früheren Jahren sind unter http://www.schierstein13.de/presse-1.html zu finden. Jahre 2010-2008 22.03.2010 Portugiesischer SV profitiert B-LIGA WIESBADEN 2:2 im Verfolgerduell zwischen Schwarz-Weiß und Türken [...] Schierstein 13 - Portugiesischer SV 0:3 (0:1).- Schierstein beim Alu-Treffer von Marcel Göbel im Pech, die Portugiesen bei einem Eigentor sowie den Treffern von Guido und Mehmodovic mit viel Dusel.- Res.: 1:4.[...] Wiesbadener Tagblatt, vom 22.03.2010 01.02.2010 Klarenthal top, Hellas ein Flop [...]Im Gast-Status nutzte der SC Klarenthal seinen Heimvorteil, gewann das vom Fußball-B-Ligisten SV Schierstein 13 in der Klarenthaler Sporthalle organisierte Hallenturnier durch ein 2:0 im Finale über TB Rambach. Dritter wurde Freudenberg nach einem 4:1 über die 13er, die nach dem Ausscheiden von Mario Kaluscha bis zum Rundenende von Spielausschuss-Chef Jesco Bonello und dem zum Kader der Ersten zählenden Marco Goscenny trainiert werden. Während Klarenthals harmonisches Team den sportlichen Glanzpunkt setzte, sorgte Hellas Schierstein für das einzige Ärgernis. Mit Torwart und nur drei Feldspielern angetreten, verloren die Griechen ihr erstes Spiel gegen Maroc 0:7 und zogen danach von dannen. Endstand, Gruppe 1: 1. TB Rambach 7/4:2, 2. SC Klarenthal 7/3:2, 3. Türkischer SV II 6/2:1, 4. SV Hajduk 4/3:4, 5. -

Die Neue Rheinbrücke Wiesbaden-Schierstein
Hessen Mobil Straßen- und Verkehrsmanagement Die neue Rheinbrücke Wiesbaden-Schierstein Wettbewerb und Entwurf Projekt1 19.10.2007 08:32 Seite 1 Fachthemen Eberhard Pelke DOI: 10.1002/stab.201310024 Alwin Dieter Die neue Rheinbrücke Wiesbaden-Schierstein – Wettbewerb und Entwurf Oft unterschätzt, stand die bestehende Rheinbrücke Wiesbaden- 1 Die vorhandene Rheinbrücke Wiesbaden-Schierstein Schierstein am Wendepunkt vom statischen zum fertigungsge- rechten Ingenieurbauwerk. Der Siegerentwurf des Realisierungs- Der erste Bedarfsplan für die Bundesfernstraßen der neuen wettbewerbes 2007 bestätigte die Grundlagen von Entwurf und Bundesrepublik Deutschland 1956 richtete ein besonderes Ausführung der Jahre 1959 bis 1962 und zieht Schlüsse aus der Augenmerk auf die Verknüpfung von Ballungs- und wich- Unter- und baulichen Erhaltung des bestehenden Bauwerks. Der tigen Wirtschaftsräumen beiderseits des Rheins. Nach dem Aufsatz beschreibt Entstehung des bestehenden Bauwerks, Kölner Ring und dem Bonner Ring war der Bau der Umge- wesentliche Instandsetzungsschritte, die sich daraus ableitende hungsstraße Mainz, d. h. dem Stadtring Mainz–Wiesbaden, Erfordernis zum Neubau und abschließend dessen Ausschrei- ein vordringliches Projekt. Zur Erschließung dieses Wirt- bungsentwurf. schaftsraums der Bundesländer Rheinland-Pfalz und Hessen waren zwei neue große Rhein- und eine Mainbrücke zu er- The new Rhine Bridge Wiesbaden-Schierstein, Germany – stellen. Competition and Design. The underestimated, existing Rhine Der Stadtring Mainz–Wiesbaden war durch die rechts- Bridge Wiesbaden-Schierstein was the watershed between rheinische Bundesstraße B 42 und die linksrheinische B 9 static and erection optimization. The winner of the design zu schließen und an den Rhein-Main-Schnellweg über die competition in 2007 for a new Rhine Bridge between Wies- B 26 mit der Autobahn Frankfurt–Basel (heute A 67) zu baden and Mainz confirms the basic design and construction verbinden. -

Sonderdruck 01 / 2019
VERLAG GMBH SONDERDRUCK 01 / 2019 GESUNDHEIT · FITNESS · BEWEGUNG Foto: Christa Kaddar GESUND UND FIT IN DER REGION 2 Gesund und fit in der Region SONDERDRUCK - Anzeige - SONDERDRUCK Gesund und fit in der Region 3 Editorial per und Seele, ganz gleich in wel- chem Tempo. Wege, auf denen sich Menschen ruhig und ausgegli- Wohlfühlregion mit... chen fühlen, fördern die Selbst- Angeboten für die persönliche Fitness reflexion, regen die Vorstellungs- kraft an und bringen Erholung. Was Psychologen lange wissen, Auch wenn viele auf dem Weg zur Gärten vermitteln ohne Zweifel bestätigen auch deutsche und briti- Arbeit zwangsweise den Rheingau den Eindruck, dass man sich in ei- sche Gehirnforscher, die heraus- verlassen müssen, um ihr täglich ner Wohlfühlregion befindet – gefunden haben, wie sich ver- Brot zu verdienen, wird gerade an auch wenn man sich dessen im schiedene Umgebungen auf die jedem heller werdenden Morgen Alltag nicht immer bewusst ist. Gehirnfunktionen auswirken. In- doch deutlich, dass man sich beim Sorgen, Stress, Ärger und Hektik nere Ruhe entsteht durch das Zu- Anblick von sattem Grün und gro- verstellen manchmal den Blick auf sammenwirken verschiedener Sin- ßem Fluss glücklich schätzen die guten Seiten des Lebens – neseindrücke. Vielleicht haben kann, entlang rebengesäumter selbst im Rheingau. Da hilft es, ein auch genau diese Eindrücke vor Straßen auch wieder in den geseg- wenig herunter zu kommen und 200 Jahren die ersten „ Rhein- stellen wir einige dieser Angebote neten Landstrich, den andere als zu sich selbst zu finden, etwa beim romantiker“ ins Schwärmen ge- vor, die dazu beitragen können, Urlaubsregion auserkoren haben, Wandern oder beim Sport in Ver- bracht, weil sie sich hier wohl ge- dass man sich wohlfühlt, zu Har- zurückkommen zu können. -

Rheingaulinie Gesamtverkehr RE9, RB10 G 10 Neuwied Koblenz Kaub Wiesbaden Frankfurt RMV-Servicetelefon: 069 / 24 24 80 24 T
RheingauLinie Gesamtverkehr RE9, RB10 G 10 Neuwied Koblenz Kaub Wiesbaden Frankfurt RMV-Servicetelefon: 069 / 24 24 80 24 t NeuwiedKoblenz # StadtmitteKoblenz # HauptbahnhofNiederlahnsteinOberlahnstein # Braubach # Osterspai # # Filsen # Kamp-Bornhofen# KestertSt. # Goarshausen # Kaub #Lorchhausen # Lorch AssmannshausenRüdesheimGeisenheim a.Oestrich-Winkel Rh. HattenheimErbachEltville (Rheingau)NiederwallufWiesbaden-SchiersteinWiesbaden-BiebrichWiesbaden HauptbahnhofMainz-KastelFrankfurt-Höchst Frankfurt Hauptbahnhof P+R P+R P+R P+R P+R P+R X79 RB23 ICE RB23 RB23 ICE S1 S1 RE4 S1 ICE RE20 RE54 RE85 S6 IC RE25 RE25 RB21 S8 S9 RB11 S2 IC RB22 RE55 RE98 S7 RE2 RB75 S9 RB12 RE2 RE30 RB58 RE99 S8 RE14 RE3 RB34 RE60 S9 # = Bahnhof ist nicht zum RMV-Tarif erreichbar X26 X76 RE20 RE4 RB40 RB61 S1 RB22 RE5 RB41 RB67 : Station für Rollstuhlfahrer zugänglich X72 S2 RB12 RB48 RB68 S3 : Station für Rollstuhlfahrer mit Hilfe zugänglich RE14 RE50 RE70 S4 zusätzliche Fahrten zwischen Lorchhausen, Rüdesheim und Wiesbaden Hbf auch auf der Buslinie 171 RB15 RB51 RB82 S5 Montag - Freitag Am 24.12. und 31.12. Verkehr wie Samstag Linie RB10 RB10 RE9 RB10 RB10 RE9 RB10 RB10 RE9 RB10 RB10 RB10 RE9 RB10 RB10 RB10 RB10 RB10 RB10 Neuwied # ab 4.37 5.37 7.02 7.37 8.37 9.37 10.37 11.37 Koblenz Stadtmitte # 4.49 5.49 7.17 7.49 8.49 9.49 10.49 11.49 Koblenz Hauptbahnhof # 4.52 5.52 6.52 7.24 7.52 8.52 9.52 10.52 11.52 12.22 Niederlahnstein # 4.58 5.59 6.59 7.30 7.59 8.59 9.59 10.59 11.59 12.29 Oberlahnstein # 5.01 6.02 7.02 7.33 8.02 9.02 10.02 11.02 12.02 12.32 Braubach # 5.06 6.06 7.06 7.37 8.06 9.06 10.06 11.06 12.06 12.36 Osterspai # 5.10 6.10 7.10 7.41 8.10 9.10 10.10 11.10 12.10 12.40 Filsen # 5.13 6.13 7.13 7.44 8.13 9.13 10.13 11.13 12.13 12.43 Kamp-Bornhofen # 5.16 6.16 7.16 7.47 8.16 9.16 10.16 11.16 12.16 12.46 Kestert # 5.20 6.20 7.20 7.51 8.20 9.20 10.20 11.20 12.20 12.50 St. -
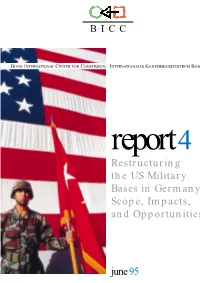
Restructuring the US Military Bases in Germany Scope, Impacts, and Opportunities
B.I.C.C BONN INTERNATIONAL CENTER FOR CONVERSION . INTERNATIONALES KONVERSIONSZENTRUM BONN report4 Restructuring the US Military Bases in Germany Scope, Impacts, and Opportunities june 95 Introduction 4 In 1996 the United States will complete its dramatic post-Cold US Forces in Germany 8 War military restructuring in ● Military Infrastructure in Germany: From Occupation to Cooperation 10 Germany. The results are stag- ● Sharing the Burden of Defense: gering. In a six-year period the A Survey of the US Bases in United States will have closed or Germany During the Cold War 12 reduced almost 90 percent of its ● After the Cold War: bases, withdrawn more than contents Restructuring the US Presence 150,000 US military personnel, in Germany 17 and returned enough combined ● Map: US Base-Closures land to create a new federal state. 1990-1996 19 ● Endstate: The Emerging US The withdrawal will have a serious Base Structure in Germany 23 affect on many of the communi- ties that hosted US bases. The US Impact on the German Economy 26 military’syearly demand for goods and services in Germany has fal- ● The Economic Impact 28 len by more than US $3 billion, ● Impact on the Real Estate and more than 70,000 Germans Market 36 have lost their jobs through direct and indirect effects. Closing, Returning, and Converting US Bases 42 Local officials’ ability to replace those jobs by converting closed ● The Decision Process 44 bases will depend on several key ● Post-Closure US-German factors. The condition, location, Negotiations 45 and type of facility will frequently ● The German Base Disposal dictate the possible conversion Process 47 options. -

Machbarkeitsstudie Rheinbrücke Bingen - Rüdesheim Umweltfachliche Beurteilung
Machbarkeitsstudie Rheinbrücke Bingen - Rüdesheim Umweltfachliche Beurteilung Stand 26.03.2021 Im Auftrag des Landesbetriebs Mobilität Worms Bearbeitung durch herne ● münchen ● hannover ● berlin www.boschpartner.de Schönauer Straße 5 Auftraggeber: Landesbetrieb Mobilität 67547 Worms Worms Kirchhofstraße 2c Auftragnehmer: Bosch & Partner GmbH 44623 Herne www.boschpartner.de Projektleitung: Dipl.-Geogr. Jörg Borkenhagen Bearbeiter: M. Sc. Lars Aretz Herne, den 26.03.2021 Machbarkeitsstudie Rheinbrücke Bingen - Rüdesheim Inhaltsverzeichnis Inhaltsverzeichnis Seite 0.1 Kartenverzeichnis ............................................................................................... II 0.2 Anlagenverzeichnis ............................................................................................. II 0.3 Abbildungsverzeichnis ....................................................................................... III 0.4 Tabellenverzeichnis .......................................................................................... IV 1 Anlass und Aufgabenstellung ......................................................................... 1 2 Überprüfung und Aktualisierung des Bestandes Pflanzen und Tiere ......... 2 2.1 Naturschutzfachliche und raumplanerische Vorgaben ....................................... 3 2.1.1 Schutzgebiete, Geschützte Objekte und Geschützte Lebensräume .................. 3 2.1.1.1 Natura2000-Gebiete ........................................................................................... 3 2.1.1.2 RAMSAR-Konvention -

Haltestellenverzeichnis Wiesbaden 2021
Haltestellenverzeichnis Gemeinde Ortsteil Ziel- Haltestelle Linie code Altheim (Hess) Münster (Hessen) Amöneburg (Wiesbaden) Wiesbaden Aschaffenburg Aschaffenburg Hauptbahnhof ▲ RB75 9110 Assmannshausen Rüdesheim (Rhein) Auringen Wiesbaden Babenhausen (Hess) Babenhausen (Hess) Bahnhof RB75 4143 Hergershausen (DA) Bahnhof RB75 4143 Bad Camberg Bad Camberg Bahnhof RE20, RB21, RB22 6101 Bad Homburg v.d.Höhe Bad Homburg v.d.Höhe Bahnhof X26 5101 Feldbergstraße X26 5101 Finanzamt X26 5101 Kurhaus X26 5101 Markt X26 5101 Untertor/Friedhof X26 5101 Biebrich (Wiesbaden) Wiesbaden Bierstadt Wiesbaden Bischofsheim (Kr GG) Bischofsheim (Kr GG) Bahnhof S8, S9, RB75 6593 Braubach Braubach Bahnhof # RB10 Brechen Niederbrechen Bahnhof RE20, RB21, RB22 6120 Oberbrechen Bahnhof RB21, RB22 6120 Breckenheim Wiesbaden Bremthal Eppstein (Taunus) Bretzenheim (Mainz) Mainz Büttelborn Klein-Gerau Bahnhof RB75 3715 Darmstadt Darmstadt Hauptbahnhof RB75 4001 Nordbahnhof RB75 4001 Kranichstein Bahnhof RB75 4035 Delkenheim Wiesbaden Dieburg Dieburg Bahnhof RB75 4128 Diedenbergen Hofheim (Taunus) Dietesheim Mühlheim am Main, Stadt 630670 Haltestellenverzeichnis Gemeinde Ortsteil Ziel- Haltestelle Linie code Dietzenbach Dietzenbach Bahnhof S2 3550 Mitte Bahnhof S2 3550 Steinberg Bahnhof S2 3550 Dotzheim Wiesbaden Drais Mainz Dudenhofen (b Offenbach) Rodgau Eddersheim Hattersheim (Main) Eltville am Rhein Eltville am Rhein Bahnhof RE9, RB10 6455 Erbach (Rheingau) Bahnhof RE9, RB10 6455 Hattenheim Bahnhof RE9, RB10 6494 Martinsthal Am Steinberg 5 6455 Schiersteiner Straße -

Go Downtown! ESWE Public Transportation Service Right Into the Heart of Town
Go downtown! ESWE public transportation service right into the heart of town WELCOME TO WIESBADEN! 2015 ticket types and prices locations and bus services sightseeing attractions ESWE Verkehrsgesellschaft mbH · Gartenfeldstrasse 18 · 65189 Wiesbaden · Telefon (0611) 450 22-450 · www.eswe-verkehr.de 2 wIESBAdEn PUBLIC tRAnSPoRt At YoUR SERVICE ESwE public transportation – mobilizing wiesbaden! The ESWE Verkehrsgesellschaft public transporta- Wiesbaden’s touristic highlights are also but a tion company is one of the largest in Hesse and bus ride away with our convenient and reliable an integral part of Wiesbaden city life, that has service, places to see such as the Kurhaus and become unimaginable without its blue-orange Casino, the historical Neroberg Mountain Railway, ESWE city buses. Our around 235 vehicles are or Biebrich Palace with its breathtaking beautiful giving you a quick, convenient and inexpensive panoramic view over the Rhine. bus service into the heart of the Hessian capital, a service that around fifty million passengers a year We are looking forward to welcoming you soon have come to know and love. on one of our buses – and to beautiful Wiesbaden! An ESWE bus is usually only minutes away from anywhere in downtown Wiesbaden – a bus that will whisk you away to your favorite stores and fine restaurants in the city center, or to the many city events that take place over the year. More dEtails here: www.eswe-verkehr.de/english tICKEtS FoR INDIVIdUAL MoBILItY 3 Into the city at affordable prices Single ticket friends or colleagues – a whole day on all the A single ticket with an ESWE bus costs a 2.70 for ESWE buses for up to five people (adults and adults; children aged six to fourteen only pay children) costs just a 9.70. -

Band 137, 2016
Cervus elaphoides (MWNH- CervusNas elaphoidessau (MWNHisch-PLEISer- 660a):Ve rGeweihfragmentein für Naturkunde PLEIS-660a): Geweihfragment Jahrbücher des NassauischenJahrbücher des V ereins fürNassauischen Naturkunde Vereins für Naturkunde Band 130 Wiesbaden 2009 ISSN 0368-1254 Band 137 Wiesbaden 2016 ISSN 0368-1254 NassauischerVerein für Naturkunde JahrbücherJahrbücher des des NassauischenNassauischen VVereinereinss für Naturkundefür Naturkunde Band 130 Wiesbaden 2009 ISSN 0368-1254 Band 137 Wiesbaden 2016 ISSN 0368-1254 Titelbild Der Gartenschläfer (Eliomys quercinus, L. 1766) zum Aufsatz von OLAF GODMANN © Nassauischer Verein für Naturkunde, Wiesbaden 2016 ISSN 0368-1254 Für den sachlichen Inhalt der Beiträge sind die Autorinnen und Autoren allein verant- wortlich. Herausgabe und Vertrieb: Nassauischer Verein für Naturkunde Friedrich-Ebert-Allee 2, 65185 Wiesbaden e-Mail: [email protected] http://www.naturkunde-online.de Schriftentausch / publication exchange / échange de publications: Hessische Landesbibliothek Rheinstraße 55/57, 65185 Wiesbaden Telefon: (0611) 9495-1851 Frau Buchecker e-Mail: [email protected] Schriftleitung: Prof. Dr. B. Toussaint 65232 Taunusstein Telefon: (06128) 71737 e-mail: [email protected] Satz: Prof. Dr. B. Toussaint, Taunusstein Druck und Verarbeitung: Druckerei Chmielorz GmbH, Wiesbaden Printed in Germany/Imprimé en Allemagne Gedruckt auf chlorfrei gebleichtem Papier 2 Inhaltsverzeichnis Editorial ....................................................................................................... -

A Bridge for 100 Years of Mobility
Cover story: We make a difference Photo: © iStockphoto.com Photo: Project: Reconstruction of Schiersteiner Bridge A bridge for 100 years of mobility Nowhere else can mobility, transport and logistics be expe- rienced as clearly as in road traffic. After its reconstruction, the Schierstein motorway bridge in Rhineland-Palatinate is more stable, lighter and more cost-effective, thanks to the optimized design of its steel structure. The HFI-welded steel tubes used for this purpose were supplied by Mannesmann Line Pipe. On 10 February 2015, at around 10 pm, Hesse and Rhineland-Palatinate, made considerable damage was detected in itself felt in rush-hour and interregional the Schiersteiner Bridge on motorway long-distance traffic: Tailbacks of sev- A 643. One pier of the more than eral kilometers, diversion chaos through 50-year-old foreland bridge had tilted, Mainz, Wiesbaden and the surrounding whereupon the carriageway was low- area not only strained the nerves of tens ered by about 30 cm. The bridge was of thousands of commuters and truck then closed immediately. On the day drivers, but also those of the plan- after, the importance of the bridge, as ners and road workers who had been a part of the "Mainzer Ring" between working for two years now on one of 12 LINE PIPE GLOBAL · 12/2019 Image: © Hessen Mobil The design is the most economical solution in terms of both maintenance and production costs. From the jury‘s reasoning on the winning design Germany‘s largest transport infrastruc- Grontmij BGS and the architectural firm ture projects. Ferdinand Heide designed a 1,285 m long box girder bridge.