Band 137, 2016
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

Go Downtown! ESWE Public Transportation Service Right Into the Heart of Town
Go downtown! ESWE public transportation service right into the heart of town WELCOME TO WIESBADEN! 2015 ticket types and prices locations and bus services sightseeing attractions ESWE Verkehrsgesellschaft mbH · Gartenfeldstrasse 18 · 65189 Wiesbaden · Telefon (0611) 450 22-450 · www.eswe-verkehr.de 2 wIESBAdEn PUBLIC tRAnSPoRt At YoUR SERVICE ESwE public transportation – mobilizing wiesbaden! The ESWE Verkehrsgesellschaft public transporta- Wiesbaden’s touristic highlights are also but a tion company is one of the largest in Hesse and bus ride away with our convenient and reliable an integral part of Wiesbaden city life, that has service, places to see such as the Kurhaus and become unimaginable without its blue-orange Casino, the historical Neroberg Mountain Railway, ESWE city buses. Our around 235 vehicles are or Biebrich Palace with its breathtaking beautiful giving you a quick, convenient and inexpensive panoramic view over the Rhine. bus service into the heart of the Hessian capital, a service that around fifty million passengers a year We are looking forward to welcoming you soon have come to know and love. on one of our buses – and to beautiful Wiesbaden! An ESWE bus is usually only minutes away from anywhere in downtown Wiesbaden – a bus that will whisk you away to your favorite stores and fine restaurants in the city center, or to the many city events that take place over the year. More dEtails here: www.eswe-verkehr.de/english tICKEtS FoR INDIVIdUAL MoBILItY 3 Into the city at affordable prices Single ticket friends or colleagues – a whole day on all the A single ticket with an ESWE bus costs a 2.70 for ESWE buses for up to five people (adults and adults; children aged six to fourteen only pay children) costs just a 9.70. -

A Bridge for 100 Years of Mobility
Cover story: We make a difference Photo: © iStockphoto.com Photo: Project: Reconstruction of Schiersteiner Bridge A bridge for 100 years of mobility Nowhere else can mobility, transport and logistics be expe- rienced as clearly as in road traffic. After its reconstruction, the Schierstein motorway bridge in Rhineland-Palatinate is more stable, lighter and more cost-effective, thanks to the optimized design of its steel structure. The HFI-welded steel tubes used for this purpose were supplied by Mannesmann Line Pipe. On 10 February 2015, at around 10 pm, Hesse and Rhineland-Palatinate, made considerable damage was detected in itself felt in rush-hour and interregional the Schiersteiner Bridge on motorway long-distance traffic: Tailbacks of sev- A 643. One pier of the more than eral kilometers, diversion chaos through 50-year-old foreland bridge had tilted, Mainz, Wiesbaden and the surrounding whereupon the carriageway was low- area not only strained the nerves of tens ered by about 30 cm. The bridge was of thousands of commuters and truck then closed immediately. On the day drivers, but also those of the plan- after, the importance of the bridge, as ners and road workers who had been a part of the "Mainzer Ring" between working for two years now on one of 12 LINE PIPE GLOBAL · 12/2019 Image: © Hessen Mobil The design is the most economical solution in terms of both maintenance and production costs. From the jury‘s reasoning on the winning design Germany‘s largest transport infrastruc- Grontmij BGS and the architectural firm ture projects. Ferdinand Heide designed a 1,285 m long box girder bridge. -
![[PREVIEW] the New Wiesbaden-Schierstein Bridge](https://docslib.b-cdn.net/cover/9920/preview-the-new-wiesbaden-schierstein-bridge-2039920.webp)
[PREVIEW] the New Wiesbaden-Schierstein Bridge
2089 37th IABSE Symposium Madrid 2014 The New Wiesbaden-Schierstein Bridge – 50 Years of Steel Construction M2-1. Multi-supported Bridges - 1 Eberhard PELKE Alwin DIETER Head of Department Head of Unit The New Wiesbaden-Schierstein Bridge 50 Years of Steel Construction Bridge Engineering Business Line Transport Hessen Mobil - Road and & Mobility Traffic Management Welding Engineer Eberhard Pelke, born 1955, Alwin Dieter, born in 1953, is received his civil engineering a graduated Engineer (Dipl.- degree from the University of Ing.) in constructive civil Darmstadt in 1983. He has engineering (steel and steel been working for the Hessen composite bridges). Mobil since 1990. He has been working for Grontmij since 2004. Summary The bridge spans the river Rhine and connects the state capitals of Mainz andSpace Wiesbaden, for a portrait Germany. The existing bridge was at its turning point from a static to a production32-oriented x 48 mm engineering structure. The paper gives an insight into the deficits and damage of the existing bridge and explains the consequential requirement for a new design. Keywords: major projects, bridge, steel, composite, aesthetics, sustainability, environmental protection 1. The existing Schierstein Rhine Bridge When the planning for the existing Wiesbaden-Schierstein Rhine bridge began in 1955, the volume of traffic crossing the Rhine was estimated at 7,100 cars/day and max. 23,000 cars/24 hours. Today, more than 80,000 vehicles use the structure, of which 8% are trucks. The volume of traffic will continue to rise to around 97,000 cars/24 hours with an over-proportionally growing share of heavy duty vehicles. -

Welcome to the Rhine Cycle Route! from the SOURCE to the MOUTH: 1,233 KILOMETRES of CYCLING FUN with a RIVER VIEW Service Handbook Rhine Cycle Route
EuroVelo 15 EuroVelo 15 Welcome to the Rhine Cycle Route! FROM THE SOURCE TO THE MOUTH: 1,233 KILOMETRES OF CYCLING FUN WITH A RIVER VIEW Service handbook Rhine Cycle Route www.rhinecycleroute.eu 1 NEDERLAND Den Haag Utrecht Rotterdam Arnhem Hoek van Holland Kleve Emmerich am Rhein Dordrecht EuroVelo 15 Xanten Krefeld Duisburg Düsseldorf Neuss Köln BELGIË DEUTSCHLAND Bonn Koblenz Wiesbaden Bingen LUXEMBURG Mainz Mannheim Ludwigshafen Karlsruhe Strasbourg FRANCE Offenburg Colmar Schaff- Konstanz Mulhouse Freiburg hausen BODENSEE Basel SCHWEIZ Chur Andermatt www.rheinradweg.eu 2 Welcome to the Rhine Cycle Route – EuroVelo 15! FOREWORD Dear Cyclists, Discovering Europe on a bicycle – the Rhine Cycle Route makes it possible. It runs from the Alps to a North Sea beach and on its way links Switzerland, France, Germany and the Netherlands. This guide will point the way. Within the framework of the EU-funded “Demarrage” project, the Rhine Cycle Route has been trans- formed into a top tourism product. For the first time, the whole course has been signposted from the source to the mouth. Simply follow the EuroVelo15 symbol. The Rhine Cycle Route is also the first long distance cycle path to be certified in accordance with a new European standard. Testers belonging to the German ADFC cyclists organisation and the European Cyclists Federation have examined the whole course and evaluated it in accordance with a variety of criteria. This guide is another result of the European cooperation along the Rhine Cycle Route. We have broken up the 1233-kilometre course up into 13 sections and put together cycle-friendly accom- modation, bike stations, tourist information and sightseeing attractions – the basic package for an unforgettable cycle touring holiday. -
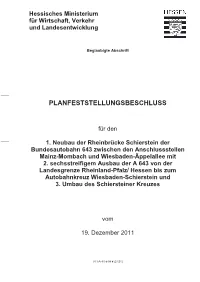
Planfeststellungsbesch
Hessisches Ministerium für Wirtschaft, Verkehr und Landesentwicklung Beglaubigte Abschrift PLANFESTSTELLUNGSBESCHLUSS für den 1. Neubau der Rheinbrücke Schierstein der Bundesautobahn 643 zwischen den Anschlussstellen Mainz-Mombach und Wiesbaden-Äppelallee mit 2. sechsstreifigem Ausbau der A 643 von der Landesgrenze Rheinland-Pfalz/ Hessen bis zum Autobahnkreuz Wiesbaden-Schierstein und 3. Umbau des Schiersteiner Kreuzes vom 19. Dezember 2011 VI 1-A–61-k-04 # (2.121) Inhalts- und Abkürzungsverzeichnis zum Planfeststellungsbeschluss der A 643 - – Inhaltsverzeichnis zum Planfeststellungsbeschluss für den Neubau der Rheinbrücke Schierstein (Bauwerke 1b, 4b, 1c, 4c, 2a, 5a, 2b und 5b) zwischen den Anschlussstellen Mainz-Mombach und Wiesbaden-Äppelallee, den sechsstreifigen Ausbau der Bundesautobahn 643 (Autobahndreieck Mainz- Autobahnkreuz Wiesbaden-Schierstein) von der Landesgrenze Rheinland-Pfalz/ Hessen bis zum Autobahnkreuz Wiesbaden-Schierstein in den Gemarkungen Schierstein und Biebrich der Landeshauptstadt Wiesbaden von Bau-km 0+262,781 bis 2+725 (Achse 1: östliche Richtungsfahrbahn) und von Bau-km 0+267,972 bis 2+655 (Achse 2: westliche Richtungsfahrbahn), und den Umbau des Schiersteiner Kreuzes - VI 1-A–61-k-04 # (2.121) - vom 19. Dezember 2011 Ziffer Inhalt Seite A. Verfügender Teil (Tenor) 1 I. Entscheidung 1 1. Feststellung des Plans 1 2. Übersicht über die planfestgestellten Maßnahmen 3 3. Festgestellte Planunterlagen 6 II. Erlaubnis zur Einleitung von Niederschlagswasser 13 in Gewässer III. Von der Konzentrationswirkung umfasste öffent- 13 lich-rechtliche Entscheidungen 1 (entspricht: Bau-km 4+316,69 der Planung des Landes Rheinland-Pfalz) 2 (entspricht: Bau-km 4+305,34 der Planung des Landes Rheinland-Pfalz) …/ Inhalts- und Abkürzungsverzeichnis zum Planfeststellungsbeschluss für die A 643 1. Zulassung des Projekts im FFH-Gebiet „Rett- 13 bergsaue bei Wiesbaden“ 2. -

PDF Download
LINE PIPE GLOBAL www.magazine.mannesmann-linepipe.com Issue 12 · April 2019 Transport, logistics, mobility We make a difference Germany Great Britain Poland Also available Reconstruction of Waste Disposal New construction of online! Schiersteiner Bridge Wembley Park Katowice bus station Page 12 Page 16 Page 20 magazine.mannesmann-linepipe.com EDITORIAL Dear Reader: The new issue of Line Pipe Global focuses For example, you can fi nd out on which on transport, logistics and mobility. route our pipes reach the USA. A fi gure Under the motto "We make a dif- that may surprise many of you in this con- ference", we don‘t want to look at the text: For the transport of our HFI-welded well-known aspects of applications in the pipes, we continuously have 90 special classic line pipe sector, but rather present wagons of Deutsche Bahn in service. Not exciting projects in which our products only a reliable, but also a very sustainable have been used. From the leading role transport alternative, as has been recently in a bridge construction project to a new confi rmed by DB Cargo. In 2018, rail bus station as part of a sustainable trans- transports have enabled us to reduce our port concept, and from there to innovative CO2 emissions by 2,080 tons to 825 tons waste disposal. compared to road transport by truck.* In addition, we look to the future and Here, too, we make a difference! give you an outline of the application area On the following pages of this issue of transport and hydrogen storage. -

Creative Business in Wiesbaden - Nummer Zwei Creative Business in Wiesbaden – Nummer Zwei
www.aaa-wiesbaden.de creative business in wiesbaden - nummer zwei creative business in wiesbaden – nummer zwei 1 KREATIV IN WIESBADEN CREATIVE IN WIESBADEN In der Öffentlichkeit – noch – zu Until now too little public attention wenig bekannt, hat sich in den letzten has been paid to how in recent years Jahren in der Landeshauptstadt eine Hesse‘s capital city has developed lebendige Design- und Kommunika- into a lively design and communi- tionsszene entwickelt. Namhafte cations scene. Our city is home to Agenturen, für nationale und interna- well-known agencies whose success tionale Unternehmen tätig, und, wie has been validated by prize awards gewonnene Preise bestätigen, auch for their work with companies active sehr erfolgreich, haben ihren Standort across Germany and around the in unserer Stadt. world. Schon der Gesellschaftsforscher Several years ago, when Richard Richard Florida hat die Beziehung Florida, the social researcher, studied von Kultur, Kreativität und wirtschaft- the relationships between culture, lichem Wachstum analysiert und her- creativity and economic growth, he ausgefunden, dass Kreativität als discovered that creativity is a location Standortfaktor entscheidend zu öko- factor which contributes substantially nomischem Erfolg beiträgt. Was liegt to economic success. What could da näher, als in der Kreativbranche be more obvious than actively to pro- aktive Wirtschaftsförderung zu betrei- mote business development in the ben, Netzwerke zu initiieren und den creative industries, to initiate busi- Wirtschaftsstandort Wiesbaden als ness networks, and to point out how einen besonderen Kreativstandort zu Wiesbaden‘s prominence is not so profilieren, der nicht durch Masse, much a question of quantity as it is sondern durch besondere Qualität of outstanding quality. -

Schiersteiner Brücke", the Extension of the Motorway a 643 from 4 Lanes to 6 Lanes and the Enlargement of the Motorway Junction, Hesse (Germany)
EUROPEAN COMMISSION Brussels, 14.9.2011 C(2011) 6365 final COMMISSION OPINION of 14.9.2011 delivered upon request of Germany pursuant to Art. 6 (4) Sub Par. 2 of Council Directive 92/43/EEC of 21 May 1992 on the conservation of natural habitats and of wild fauna and flora, concerning the replacement construction of the motorway bridge "Schiersteiner Brücke", the extension of the motorway A 643 from 4 lanes to 6 lanes and the enlargement of the motorway junction, Hesse (Germany) COMMISSION OPINION of 14.9.2011 delivered upon request of Germany pursuant to Art. 6 (4) Sub Par. 2 of Council Directive 92/43/EEC of 21 May 1992 on the conservation of natural habitats and of wild fauna and flora, concerning the replacement construction of the motorway bridge "Schiersteiner Brücke", the extension of the motorway A 643 from 4 lanes to 6 lanes and the enlargement of the motorway junction, Hesse (Germany) I. The legal framework Article 6 (3) of directive 92/43/EEC (the 'Habitats Directive') requires that any plan or project not directly connected with or necessary to the management of a Natura 2000 site but likely to have a significant effect thereon, either individually or in combination with other plans or projects, be subject to an appropriate assessment of its implications for the site in view of the site's conservation objectives. In the light of the conclusions of the assessment of its implications for the site and subject to the provisions of paragraph 4, the competent national authorities may agree to the plan or project only after having ascertained that it will not adversely affect the integrity of the site concerned and, if appropriate, after having obtained the opinion of the general public. -

Reiseplaner Travel Planner
2021 Reiseplaner Travel Planner 2 3 Wiesbaden – viele Gründe sprechen für die grüne Stadt! Inhalt Content Wiesbaden – plenty of reasons in favour of the green city! Herzlich willkommen Wiesbaden erleben Welcome Wiesbaden Experience Die hessische Landeshauptstadt Wiesbaden versteht zu Wiesbaden, the capital city of Hesse, knows how to captivate jeder Jahreszeit zu faszinieren. Sie begeistert mit zahl- visitors in every season. A number of centrally located reichen zentral gelegenen Grünanlagen und Parks; kurze green areas and parks offer inspiration. Short distances Wege tragen dazu bei, dass sich aktives Freizeitvergnügen, make it easy for anyone to comfortably combine active Einkaufsbummel und Kulturgenuss angenehm miteinander leisure time, shopping, and cultural pleasure. verbinden lassen. 2 12 The multifaceted nature of the city is also evident in its Der Facettenreichtum der Stadt drückt sich auch in ihrer extraordinary architecture: magnificent Wilhelminian außergewöhnlichen Architektur aus: Wilhelminische buildings from the historicist era, neoclassical edifices, Prachtbauten aus der Zeit des Historismus, klassizistische and elements of Art Nouveau testify to Wiesbaden’s glam- 4 Entschleunigung 12 Stadtführungen Gebäude und Jugendstilelemente zeugen von der glanz- orous history. Imperial courtiers and international spa Slowing Down City Tours vollen Geschichte Wiesbadens; kaiserlicher Hofstaat und guests populated the representative spa town in the late 6 Events 13 Pauschalangebote internationale Kurgäste bevölkerten im ausgehenden 19. 19th century. Behind many a splendid façade, there are Events Tour Packages Jahrhundert die repräsentative Kurstadt. Hinter so manch interesting and exciting anecdotes to be discovered, stories prachtvoller Fassade gibt es interessante und spannende that will also be shared during our city tours. 8 Kultur 18 Gruppenangebote Anekdoten zu entdecken, die auch bei Stadtrundgängen Culture Group Offers EXPERIENCE WIESBADEN | erzählt werden. -

A Bridge for 100 Years of Mobility
Cover story: We make a difference Photo: © iStockphoto.com Photo: Project: Reconstruction of Schiersteiner Bridge A bridge for 100 years of mobility Nowhere else can mobility, transport and logistics be expe- rienced as clearly as in road traffic. After its reconstruction, the Schierstein motorway bridge in Rhineland-Palatinate is more stable, lighter and more cost-effective, thanks to the optimized design of its steel structure. The HFI-welded steel tubes used for this purpose were supplied by Mannesmann Line Pipe. On 10 February 2015, at around 10 pm, Hesse and Rhineland-Palatinate, made considerable damage was detected in itself felt in rush-hour and interregional the Schiersteiner Bridge on motorway long-distance traffic: Tailbacks of sev- A 643. One pier of the more than eral kilometers, diversion chaos through 50-year-old foreland bridge had tilted, Mainz, Wiesbaden and the surrounding whereupon the carriageway was low- area not only strained the nerves of tens ered by about 30 cm. The bridge was of thousands of commuters and truck then closed immediately. On the day drivers, but also those of the plan- after, the importance of the bridge, as ners and road workers who had been a part of the "Mainzer Ring" between working for two years now on one of 12 LINE PIPE GLOBAL · 12/2019 Image: © Hessen Mobil The design is the most economical solution in terms of both maintenance and production costs. From the jury‘s reasoning on the winning design Germany‘s largest transport infrastruc- Grontmij BGS and the architectural firm ture projects. Ferdinand Heide designed a 1,285 m long box girder bridge. -
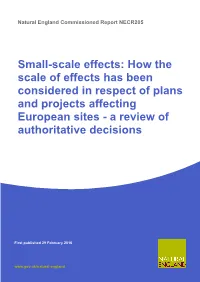
How the Scale of Effects Has Been Considered in Respect of Plans and Projects Affecting European Sites - a Review of Authoritative Decisions
Natural England Commissioned Report NECR205 Small-scale effects: How the scale of effects has been considered in respect of plans and projects affecting European sites - a review of authoritative decisions First published 29 February 2016 www.gov.uk/natural -england Foreword Natural England commission a range of reports from external contractors to provide evidence and advice to assist us in delivering our duties. The views in this report are those of the authors and do not necessarily represent those of Natural England. Background The implementation of a wide range of plans or scale of effects (either the proportion of the area projects can affect the wildlife or habitats on of a site or qualifying habitat feature, or the sites which have been designated for their proportion of a population of a species) where nature conservation importance as European these were judged to have been relatively small Protected Areas. in the context of the case. It is uncommon for European Protected Areas to It updates and builds upon a previous Research be threatened by a project that would have Report ENRR704 from 2006 entitled ‘How the major adverse effects on nature conservation. scale of effects on internationally designated However, small-scale effects are more common nature conservation sites in Britain has been and Natural England advisers need to judge considered in decision making – A review of whether the small-scale effects on a site may authoritative decisions’ and will be used as a adversely affect its integrity and whether the referencing tool for Natural England and other effects are significant in light of the conservation decision makers, in particular Natural England objectives for the site.