Die Schalksbachteiche Bei Herbstein
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

Kreisverwaltung
Info Kreisverwaltung 1 Vogelsbergkreis – Der Kreisausschuss – Goldhelg 20 – 36341 Lauterbach/Hessen Telefon: 06641 977-0 – Fax 977-336 – [email protected] – Ausgabe 2009 www.vogelsbergkreis.de vermeiden – verwerten – entsorgen Dienstleistungsfirma ZAV Wir sind für Sie da… und wohin mit dem …wenn es um die umwelt- abfall? gerechte Abfall-Entsorgung geht. Bevor wir uns fragen, wohin mit dem Abfall, müssen wir uns eigentlich fragen, woher kommt denn der Abfall? Mit ca. 150 kg bis 350 kg Abfällen pro Einwohner im Jahr trägt der Verbrau- cher ganz wesentlich zum Müllberg bei. Letztendlich entschei- det jeder Einzelne von uns durch sein Kaufverhalten über die Abfallproduktion. Die Müllsortierung ist ein wichtiger Schritt, um Rohstoffe zu sparen, doch wer es mit dem Umweltschutz ernst nimmt, darf den Müll gar nicht erst entstehen lassen. Regie- rung, Produzenten und Verbraucher sind gleichermaßen aufge- fordert, zu einer nachhaltigen Wirtschaftsweise beizutragen. Verbraucher unterschätzen oftmals ihren Einfluß auf den Markt. Produkte, die nicht gekauft werden, werden bald nicht mehr haben Sie fragen zum abfall hergestellt. Überlegen Sie deshalb bei jedem Einkauf: Brauche ich dieses Produkt überhaupt? Kann ich auf eine Alternative und zur entsorgung im ausweichen, die umweltfreundlicher und abfallärmer ist? Gibt vogelsbergkreis? es ein vergleichbares Produkt, das länger hält, sich besser reparieren oder wiederverwenden läßt? wir sind für sie da! Versuchen Sie, bewusst Abfall zu vermeiden, indem Sie die Ver- meidungsangebote wie Mehrweg-, Nachfüllprodukte und recy- celbare Verpackungen aus Glas, Metall und Papier bevorzugen. Was Sie darüber hinaus aber noch tun können und wie Sie unvermeidbare Abfälle richtig entsorgen, erfahren Sie aus dem eselswörth 23 Abfallratgeber des Zweckverbandes Abfallwirtschaft Vogels- bergkreis (ZAV). -

Pressemitteilung TNG Startet Glasfaser-Vermarktung in Weiteren
Pressemitteilung TNG startet Glasfaser-Vermarktung in weiteren Gebieten des Vogelsbergkreises • In den Gemeinden Freiensteinau und Ulrichstein sowie in Lingelbach in Alsfeld und Teilen von Schlitz und Grebenhain können sich Interessenten einen kostenlosen Glasfaser-Hausanschluss sichern • Netzausbau bei Beteiligung von 40% der Haushalte • Aktionszeitraum bis 13. Dezember mit Informationsveranstaltungen sowie Beratungsterminen Kiel, 25.09.2020 – Rund 7.500 weitere Haushalte im Vogelsbergkreis erhalten die Chance auf schnelles Internet über das zukünftige Glasfasernetz der TNG Stadtnetz GmbH (TNG) und können sich einen kostenlosen Glasfaser-Hausanschluss sichern. Dies gilt für die Bürgerinnen und Bürger in den Gemeinden Freiensteinau und Ulrichstein sowie in der Ortschaft Lingelbach in Alsfeld, den Grebenhainer Ortschaften Bannerod, Crainfeld, Grebenhain, Heisters, Ilbeshausen- Hochwaldhausen, Vaitshain, Volkartshain, Wünschen-Moos und Zahmen und in den Schlitzer Ortschaften Bernshausen, Niederstoll, Ober-Wegfurth, Queck, Rimbach, Ützhausen und Unter- Schwarz. Die TNG setzt Ihren Weg fort, ein Glasfasernetz im Herzen Hessens zu errichten Flott startet die TNG in die Vermarktung der nächsten Gebiete – ab sofort und nur bis zum 13. Dezember 2020 haben die Bewohnerinnen und Bewohner der weiteren Gebiete die Möglichkeit, sich für den Ausbau eines leistungsstarken Glasfasernetzes in ihrer Region zu entscheiden. Bei einer Beteiligung von 40 % aller Haushalte bis zum 13. Dezember startet die TNG in die Planung des Netzes. TNG ist der einzige Anbieter in der Region, der geradewegs in den Ausbau eines 100 %-igen Glasfasernetzes bis ins Haus starten wird und somit komplett auf die störanfällige Kupferleitung verzichtet. Der passende Glasfasertarif und damit auch der kostenlose Bau des Hausanschlusses kann schnell und bequem unter www.tng.de/onlinebestellung beantragt werden. Damit sichert man sich zudem ein Startguthaben in Höhe von 25 €. -

Ergebnisse Landwirtschaft VB 2018.Xlsx
Bodenrichtwert Grünland Bodenrichtwert Ackerland Gemeinde Gemarkung Stichtag: 01.01.2018 Stichtag: 01.01.2018 Alsfeld Alsfeld 1,00 € 1,40 € Alsfeld Altenburg 1,00 € 1,40 € Alsfeld Angenrod 1,00 € 1,10 € Alsfeld Berfa 0,80 € 1,00 € Alsfeld Billertshausen 1,00 € 1,20 € Alsfeld Eifa 0,90 € 1,40 € Alsfeld Elbenrod 0,90 € 1,10 € Alsfeld Eudorf 1,40 € 1,70 € Alsfeld Fischbach 0,90 € 1,30 € Alsfeld Hattendorf 1,10 € 1,40 € Alsfeld Heidelbach 1,10 € 1,40 € Alsfeld Leusel 1,00 € 1,10 € Alsfeld Liederbach 1,00 € 1,40 € Alsfeld Lingelbach 0,90 € 1,40 € Alsfeld Münch-Leusel 1,10 € 1,40 € Alsfeld Reibertenrod 1,00 € 1,30 € Alsfeld Schwabenrod 1,20 € 1,40 € Antrifttal Bernsburg 0,90 € 1,10 € Antrifttal Ohmes 0,80 € 0,90 € Antrifttal Ruhlkirchen 0,75 € 1,10 € Antrifttal Seibelsdorf 0,70 € 1,20 € Antrifttal Vockenrod 0,80 € 1,30 € Feldatal Ermenrod 0,45 € 0,50 € Feldatal Groß-Felda 0,55 € 0,70 € Feldatal Kestrich 0,55 € 0,60 € Feldatal Köddingen 0,45 € 0,50 € Feldatal Stumpertenrod 0,40 € 0,55 € Feldatal Windhausen 0,40 € 0,50 € Feldatal Zeilbach 0,50 € 0,55 € Freiensteinau Fleschenbach 0,70 € 0,75 € Freiensteinau Freiensteinau 0,45 € 0,45 € Freiensteinau Gunzenau 0,50 € 0,50 € Freiensteinau Holzmühl 0,40 € 0,50 € Freiensteinau Nieder-Moos 0,80 € 0,80 € Freiensteinau Ober-Moos 0,70 € 0,85 € Freiensteinau Radmühl(Hess.) 0,60 € 0,60 € Freiensteinau Radmühl(Preuß.) 0,60 € 0,60 € Freiensteinau Reichlos 0,70 € 0,75 € Freiensteinau Reinhards 0,45 € 0,45 € Freiensteinau Salz 0,60 € 0,60 € Freiensteinau Weidenau 0,70 € 0,75 € Bodenrichtwert Grünland Bodenrichtwert -

WANDERWELT Tourenvorschläge
WANDERWELT Tourenvorschläge JETZT: mit NEUEN Premiumwegen! VOGELSBERG Hessen www.vogelsberg-touristik.de 02|03 VULKANREGION VOGELSBERG … auf neuen Wegen INHALTSVERZEICHNIS 04 | 11 Vulkanring Vogelsberg 12 | 17 Wander-Gastgeber und Pauschalen 18 Premiumwege ExtraTouren Vogelsberg 19 Höhenrundweg Hoherodskopf 20 | 21 Bergmähwiesenpfad 22 | 23 Drei-SeenTour Freiensteinau 24 | 25 SchächerbachTour Homberg (Ohm) 26 | 27 StauseeTour Eschenrod 28 | 29 NaturTour Nidda 30 | 31 BachTour Lauterbach 32 | 33 GipfelTour Schotten 34 | 35 FelsenTour Herbstein 36 | 37 WeitblickTour Ulrichstein 38 | 39 HeinzemannTour Gemünden 40 | 41 WiesenTour Lauterbach Geotouren Vogelsberg 42 Geführte Geotouren 43 Geopark Vulkanregion Vogelsberg 44 Amanaburch-Tour 45 Geotour Felsenmeer 46 Zeitpfad Wartenberg 47 Erzweg Süd 48 | 49 Eisenpfad Gedern 50 Spur der Natur mit geol. Baumhecke 51 Erlebnispfad: Geopfad Themenwege Naturerlebnis Marburg Homberg/ Alsfeld Wandern auf dem Vulkan Ohm Fulda 52 | 53 Erlebnispfade ab Hoherodskopf Schlitz 54 | 55 Schäfer- und Magerrasenroute Lauterbach Lahn REGION Der Vogelsberg ist ein Vulkangebirge, genau genommen ein Vulkanfeld mit ungemeiner Mächtigkeit Gießen Grünberg Ulrichstein 56 Auf Schäfers Spuren und 60 km Durchmesser. Immer wieder ergossen sich Lavamassen aus Schloten und Spalten über die Herbstein Fulda 57 Bismarcksteinrunde Schotten Erde. Das war in der Zeit vor 15 bis 18 Millionen Jahren. Laubach 58 | 59 Berchtaweg Hungen Grebenhain Regionale Touren Viele Schichten sind bereits verwittert. Erosion und Wasser formten das Mittelgebirge, auf dem sich Wetter Nidda Freiensteinau Gedern VOGELSBERG 60 Zum Kirchlein Fraurombach die Natur so herrlich breit machen konnte. Der waldreiche Hohe Vogelsberg mit Gipfeln über 700 Friedberg Büdingen Birstein 61 Y-Tour Büdingen Meter ist umgeben von einer parkartigen Landschaft mit Hecken, Lesesteinwällen, Weiden und Seen, Nidda Wächtersbach 62 Antrifttal Rundweg sodass auf den Wanderwegen immer wieder Weitsichten begeistern. -

The Self-Perception of Chronic Physical Incapacity Among the Labouring Poor
THE SELF-PERCEPTION OF CHRONIC PHYSICAL INCAPACITY AMONG THE LABOURING POOR. PAUPER NARRATIVES AND TERRITORIAL HOSPITALS IN EARLY MODERN RURAL GERMANY. BY LOUISE MARSHA GRAY A thesis submitted for the degree of Doctor of Philosophy at the University of London. University College, London 2001 * 1W ) 2 ABSTRACT This thesis examines the experiences of the labouring poor who were suffering from chronic physical illnesses in the early modern period. Despite the popularity of institutional history among medical historians, the experiences of the sick poor themselves have hitherto been sorely neglected. Research into the motivation of the sick poor to petition for a place in a hospital to date has stemmed from a reliance upon administrative or statistical sources, such as patient lists. An over-reliance upon such documentation omits an awareness of the 'voice of the poor', and of their experiences of the realities of living with a chronic ailment. Research focusing upon the early modern period has been largely silent with regards to the specific ways in which a prospective patient viewed a hospital, and to the point in a sick person's life in which they would apply for admission into such an institution. This thesis hopes to rectif,r such a bias. Research for this thesis has centred on surviving pauper petitions, written by and on behalf of the rural labouring poor who sought admission into two territorial hospitals in Hesse, Germany. This study will examine the establishment of these hospitals at the onset of the Reformation, and will chart their history throughout the early modern period. Bureaucratic and administrative documentation will be contrasted to the pauper petitions to gain a wider and more nuanced view of the place of these hospitals within society. -
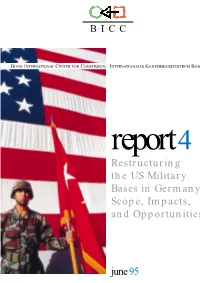
Restructuring the US Military Bases in Germany Scope, Impacts, and Opportunities
B.I.C.C BONN INTERNATIONAL CENTER FOR CONVERSION . INTERNATIONALES KONVERSIONSZENTRUM BONN report4 Restructuring the US Military Bases in Germany Scope, Impacts, and Opportunities june 95 Introduction 4 In 1996 the United States will complete its dramatic post-Cold US Forces in Germany 8 War military restructuring in ● Military Infrastructure in Germany: From Occupation to Cooperation 10 Germany. The results are stag- ● Sharing the Burden of Defense: gering. In a six-year period the A Survey of the US Bases in United States will have closed or Germany During the Cold War 12 reduced almost 90 percent of its ● After the Cold War: bases, withdrawn more than contents Restructuring the US Presence 150,000 US military personnel, in Germany 17 and returned enough combined ● Map: US Base-Closures land to create a new federal state. 1990-1996 19 ● Endstate: The Emerging US The withdrawal will have a serious Base Structure in Germany 23 affect on many of the communi- ties that hosted US bases. The US Impact on the German Economy 26 military’syearly demand for goods and services in Germany has fal- ● The Economic Impact 28 len by more than US $3 billion, ● Impact on the Real Estate and more than 70,000 Germans Market 36 have lost their jobs through direct and indirect effects. Closing, Returning, and Converting US Bases 42 Local officials’ ability to replace those jobs by converting closed ● The Decision Process 44 bases will depend on several key ● Post-Closure US-German factors. The condition, location, Negotiations 45 and type of facility will frequently ● The German Base Disposal dictate the possible conversion Process 47 options. -

Schiedsamt Bezeichnung Name Und Anschrift Stadt/Gemeinde Alsfeld I Schiedsmann Dr
Schiedsamt Bezeichnung Name und Anschrift Stadt/Gemeinde Alsfeld I Schiedsmann Dr. Jürgen Sauer, Rodgarten 7, 36304 Alsfeld Stadt Alsfeld, Markt 1, 36304 Alsfeld, Tel.: 06631/182-0 stellvertr. Schiedsmann Holger Feick, Am Kirschendriesch 8, 36304 Alsfeld Stadt Alsfeld, Markt 1, 36304 Alsfeld, Tel.: 06631/182-0 Alsfeld II Schiedsfrau Ute Koch, Ostpreußenstraße 9a, 36304 Alsfeld Stadt Alsfeld, Markt 1, 36304 Alsfeld, Tel.: 06631/182-0 stellvertr. Schiedsmann Jürgen Boß, Hattendörfer Straße 4, 36304 Alsfeld Stadt Alsfeld, Markt 1, 36304 Alsfeld, Tel.: 06631/182-0 Dietmar Krist, Am Möncheberg 14, 36326 Gemeinde Antrifttal, Weihersweg 24, 36326 Antrifttal- Antrifttal Schiedsmann Antrifttal Ruhlkirchen, Tel.: 06631/918050 Gemeinde Antrifttal, Weihersweg 24, 36326 Antrifttal- stellvertr. Schiedsmann Rudi Hill, Kirtorfer Straße 8, 36326 Antrifttal Ruhlkirchen, Tel.: 06631/918050 Gemeinde Feldatal, Schulstraße 2, 36325 Feldatal, Gemeindeverwaltung Feldatal, Tel.: 06637-9602-0, E-Mail: Feldatal Schiedsmann Albrecht Stein, Mittelgasse 1, 36325 Feldatal [email protected] Gemeinde Feldatal, Schulstraße 2, 36325 Feldatal, Gemeindeverwaltung Feldatal, Tel.: 06637-9602-0, E-Mail: stellvertr. Schiedsfrau Monika Becker, Obergasse 1, 36325 Feldatal [email protected] Gemeinde Freiensteinau, Alte Schulstraße 5, 36399 Freiensteinau, Andrea Quall, Nordendstraße 2, 36399 Gemeinde Freiensteinau, Tel.: 06666/9600-0, E-Mail: Freiensteinau Schiedsfrau Freiensteinau [email protected] Gemeinde Freiensteinau, Alte Schulstraße 5, 36399 Freiensteinau, Edwin Schneider, -

Dorfgemeinschaftshaus Nieder-Gemünden
Aus dem Inhalt Jahrgang 49 Mittwoch, den 14.November2018Nummer 46 LINUS WITTICH Medien KG online lesen: www.wittich.de -Anzeige- CHRISTS OBERHESSISCHE WURSTSPEZIALITÄTEN SONDERANGEBOTE vom: 12.11. –17.11.18 Eigene Schlachtung, schlachtfrisch im Imbiss: Hausm. Blutwurst (1kg=5,90).......................500g 2,95 Täglich verarbeitet,,g garantiertarantiert besteeQ Qualitätualität. ost frisch Ger.Kartoffelwurst (1kg=9,90).................. 500g 4,95 Hausmannsk Besuchen Sie uns. eitet! Kasseler Rolle (1kg=7,90) ...............................500g 3,95 für Sie zuber Hackfleisch (1kg=3,98)....................................... 500g 1,99 MMETZETZGEREGEREI Über Homberg (im Ohmcenter) · 06633-233 | Kirtorf im Tegut · 06635-919291 150 Jahren www.lieblingsmetzgerei.de Qualität! Ohmtal-Bote -2- Nr.46/2018 Veranstaltungen Erlebnis2018·Kultur ·Genuss &vieles mehr… Veranstaltungender Gemeinde Homberg (Ohm) Datum,Ort,Veranstaltung 16.11.2018 17.11.2018 Helferinnenessen Altbierabend Maulbacher Ausflugsgesellschaft Burschenschaft Maulbach 17.11.2018,19:00 Uhr Jugendraum Jazz afterseven 21.11.2018,19:00 Uhr MicheleAlbertiTrio Buß- undBettag, Gottesdienstfür dieRegion Familienzentrum Ev.KirchengemeindeHomberg (Ohm) StadtkircheHomberg Veranstaltungender Gemeinde Amöneburg Datum,Ort,Veranstaltung 17.11., ZauberhafteWeihnacht 17.11., Konzert Kinkerlitzchen ausdem Garten,13.00 -17.00 Uhr Jugendblasorchester derFreiwilligenFeuerwehr 17.11., Jahreshauptversammlung Mardorf, Saal Raabe Alte Herren Erfurtshausen 18.11., Gedenkfeiern zumVolkstrauertag 17.11., Spanferkelessen -

Konzept Zur Sicherstellung Der Haus- Und Fachärztlichen Versorgung Im Ländlich Strukturierten Vogelsberg (Hier Feldatal Und Umliegenden Gemeinden)
Konzept zur Sicherstellung der haus- und fachärztlichen Versorgung im ländlich strukturierten Vogelsberg (hier Feldatal und umliegenden Gemeinden) Vorgestellt von: Dr. Stephan Harlfinger (FA f. Allgemeinmedizin) Andrea Dornseif (Praxismanagerin) HZH Hausarztzentrum Harlfinger September 2012 I. Ausgangssituation II. Lösung III. Planungsstand September 2012 IV. Vision: a. Gründung weiterer Zweigpraxen und eines MVZ b. Generierung weiterer fachärztlicher Kassensitze gemäß neuer Bedarfsplanung 2013 c. Ausweitung der Kooperation mit dem KKH Alsfeld (eventuell auch mit anderen regionalen Krankenhäusern) d. Immobilie Gesundheitszentrum Feldatal Konzept zur Sicherstellung der haus- und fachärztlichen Versorgung im ländlich strukturierten Vogelsberg (hier Feldatal und umliegenden Gemeinden) I. Ausgangssituation Die haus- und fachärztliche Versorgung in Feldatal sowie in den angrenzenden Gemeinden (Romrod, Schwalmtal, Lautertal, Ulrichstein, Gemünden Felda und Antrifttal) ist auf Grund der Altersstruktur der in Einzelpraxen tätiger Fachärztinnen und Fachärzte (FA)1 mittelfristig bis akut gefährdet. Nachfolger für die verwaisten Arztsitze zu finden, ist erfahrungsgemäß nur in Einzelfällen möglich (Bundesweit sind jährlich ca. 2500 hausärztliche Arztsitze neu zu besetzen, allerdings werden pro Jahr nur ca. 900 Fachärzte ausgebildet (mit 60 % Frauenanteil), welche die freiwerdenden Kassensitze übernehmen könnten). Durch den Wertewandel der jungen Ärztegeneration gibt es kaum noch Bereitschaft, sich trotz gesichertem Einkommen, der Verantwortung und -

Christs Oberhessische Wurstspezialitäten
Aus dem Inhalt Jahrgang 51 Mittwoch, den 8. Juli 2020 Nummer 28 LINUS WITTICH Medien KG online lesen: www.wittich.de Freibad Homberg (Ohm), © Purr - Anzeige - CHRISTS OBERHESSISCHE WURSTSPEZIALITÄTEN SONDERANGEBOTE vom: 06.07. – 11.07.20 Eigene Schlachtung, schlachtfrisch Fuldaer Presskopf (1kg = 8,90) .......................500g 4,45 Täglich im Imbiss: verarbeitet, garantiert beste Qualität. Ger. Bratwurst (1kg = 9,90) ............................... 500g 4,95 Hausmannskost frisch Besuchen Sie uns. Bauchscheiben (1kg = 7,90) .............................. 500g 3,95 für Sie zubereitet! Kasseler Rolle (1kg = 7,90) ................................ 500g 3,95 METZGEREI Über Homberg (im Ohmcenter) · 06633 - 233 | Kirtorf im Tegut · 06635 - 919 291 150 Jahren www.lieblingsmetzgerei.de Qualität! Ohmtal-Bote - 2 - Nr. 28/2020 Veranstaltungen Erlebnis2020 · Kultur · Genuss & vieles mehr… Veranstaltungen der Stadt Homberg (Ohm) Datum, Ort, Veranstaltung 14.07.2020 14.30 - 16.30 Uhr Strickcafé Familienzentrum Homberg (Ohm) 15.07.2020 09.30 Uhr - 11.30 Uhr Frauenfrühstück Familienzentrum Homberg (Ohm) - Anzeige - Wertanalyse+ Für Sie in Homberg-Ohm: Dennis Hofmann [email protected] Tel.: 0641 93263-22 Was ist Ihre Immobilie wert? In zwei Schritten mehr erfahren: Schritt 1: Kostenlos eine erste Online-Bewertung erstellen Schritt 2: Kostenlose und individuelle Wertanalyse durch unsere Experten vereinbaren www.imaxx.de Impressum: BÜRGERZEITUNG Wochenblatt mit öffentlichen Bekanntmachungen der Kommunalverwaltung Die Heimat- und Bürgerzeitung mit den öffentlichen Bekanntmachungen erscheint wöchentlich. Herausgeber, Druck und Verlag: LINUS WITTICH Medien KG, 36358 Herbstein, Industriestraße 9-11, Telefon 06643/9627-0, Telefax Anzeigen 06643/9627-78. Internet-Adresse: www.wittich.de, E-Mail-Adresse: [email protected], Geschäftsführung: Hans-Peter Steil, Produktionsleitung: Frank Vogel. Verantwortlich für den amtlichen Teil und die Rubrik „Aus dem Rathaus“: Der Bürgermeister. -

Weitblicktour Ulrichstein Markierung Durchgängig
26|27 45 Erlebnispunkte www.extratouren-vogelsberg.de VOGELSBERGER EXTRATOUR WeitblickTour Ulrichstein Markierung durchgängig: 12 km | 3,5 Stunden 17 km | 5 Stunden mit Verl. WEITBLICKTOUR ULRICHSTEIN Schwierigkeitsgrad: mittelschwer Zum Beginnen… · Wanderportal am Lindenplatz in Ulrichstein (großer Parkplatz und Bus- haltestelle direkt daneben). Zum Verbinden… (ÖPNV) Info: VGO (0 66 31) 96 33 33 Wegbeschreibung: Zum Erleben… Bushaltestelle Ulrichstein Startpunkt ist der zentral gelegene Lindenplatz in Ulrichstein. Hinter · gepflegte Pfade durch das Lindenplatz: der Bushaltestelle geht es links talabwärts und gleich noch einmal Gründchen · VEX VB-92 Hungen - Laubach links in einen kleinen Schotterweg, der in einen grasigen Feldweg · Naturdenkmal „Dicke Steine“ - Grünberg - Mücke - Hohe- übergeht. Immer dem Markierungszeichen folgend geht es hang- · Museum im Vorwerk rodskopf (Vulkan-Express abwärts über Wiesenwege bis in das „Gründchen“. Das Gründchen (Landwirtschaft, Forst, Jagd) Mai-Okt. Sa/So + feiertags) ist der Bachgrund des „Gilgbaches“ mit knorrig-alten Buchen und WEITBLICKTOUR ULRICHSTEIN | Ein 12km langer Rundweg · Vogelsberggarten · VB-15 Alsfeld - Feldatal - moosüberwucherten Basaltbrocken. Schattig kühl ist es hier an zu den schönsten Aussichtsplätzen und interessanten Punkten (Botanische Schauanlage auf Ulrichstein (Sa + So nur ALT) heißen Sommertagen, beruhigend murmelt der Bach. · VB-65 Schotten - Ulrichstein - rund um Ulrichstein. Herrliche Laubwälder und kleinräumige dem Schlossberg) Lauterbach (Sa + So nur ALT) Flurlandschaften, das romantische „Gründchen“ im Tal und Am Ende des Gründchens biegt der Weg scharf nach links und es · Schlossruine Ulrichstein · VB-76 ab Flensungen u. VB-78 die Blumenwiesen des Vogelsberggartens machen diesen Weg geht auf einem Waldrandweg, später dann über einen grasigen · Fernsichten ab Flensungen oder Nieder- zum unvergesslichen Wandererlebnis. Höhepunkt am Ende der Feldweg, wieder hangaufwärts. -

Errichtung Und Betrieb Des Windparks „Feldatal-Eckmannshain“ (Windfarm „Ulrichstein- Feldatal“)
Hamburger Allee 45 D-60486 Frankfurt am Main Telefon: 069 - 95 29 64 - 0 Telefax: 069 - 95 29 64 - 99 E–Mail: [email protected] www.pgnu.de Errichtung und Betrieb des Windparks „Feldatal -Eckmannshain“ (Windfarm „Ulrichstein-Feldatal“) Landschaftspflegerischer Begleitplan (WEA) Projekt – Nr.: L 15-07 Bearbeitung: Auftraggeber: Pavlina Bechova MSH Bürger-Windpark-Feldatal GmbH & Co. KG Christoph Kress Ulrichsteiner Str. 16 Carolin Göbel 36325 Feldatal Christin Morbitzer Projektentwicklung: iTerra energy GmbH Gottfried-Arnold-Str. 1A 35398 Gießen Frankfurt Fassung vom 17.05.2019, Aktualisierung vom 21.02.2020 Windpark „Feldatal-Eckmannshain“ Landschaftspflegerischer Begleitplan (WEA) Fassung vom 17.05.2019 2 Aktualisierung vom 21.02.2020 Windpark „Feldatal-Eckmannshain“ Landschaftspflegerischer Begleitplan (WEA) INHALTSVERZEICHNIS 1 Einleitung ...................................................................................................................................................... 10 1.1 Anlass und Aufgabenstellung .............................................................................................................. 10 2 Vorhabensbeschreibung und Wirkfaktoren ................................................................................................. 10 2.1 Lage des Untersuchungsgebietes ........................................................................................................ 10 2.2 Vorhabensbeschreibung .....................................................................................................................