Das Polizeiliche Durchgangslager Westerbork
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

Diplomarbeit
DIPLOMARBEIT Organisationsstrukturen der deutschen Besatzungsverwaltungen in Frankreich, Belgien und den Niederlanden unter besonderer Berücksichtigung der Stellung des SS- und Polizeiapparates vorgelegt von: Jörn Mazur am: 16. Dezember 1997 1. Gutachter: Prof. Dr. W. Seibel 2. Gutachter: Prof. Dr. E. Immergut UNIVERSITÄT KONSTANZ FAKULTÄT FÜR VERWALTUNGSWISSENSCHAFT Inhaltsverzeichnis Abkürzungsverzeichnis I. Einführung ............................................................................................................... 1 1.1 Thematik ................................................................................................. 1 1.2 Ziel ................................................................................................. 2 1.3 Fragestellungen und Thesen ....................................................................... 2 1.3.1 Fragestellungen ..................................................................................... 2 1.3.2 Thesen ..................................................................................... 3 1.4 Methodik ................................................................................................ 4 II. Stellung und Ausweitung des Machtbereichs des SS- und Polizeiapparates im Altreich ................................................................................................ 6 2.1 Stellung und Ausweitung des Machtbereichs des SS- und Polizeiapparates vor 1939 .................................................................................................... -

Uva-DARE (Digital Academic Repository)
UvA-DARE (Digital Academic Repository) Mensen, macht en mentaliteiten achter prikkeldraad: een historisch- sociologische studie van concentratiekamp Vught (1943-1944) Meeuwenoord, A.M.B. Publication date 2011 Document Version Final published version Link to publication Citation for published version (APA): Meeuwenoord, A. M. B. (2011). Mensen, macht en mentaliteiten achter prikkeldraad: een historisch-sociologische studie van concentratiekamp Vught (1943-1944). General rights It is not permitted to download or to forward/distribute the text or part of it without the consent of the author(s) and/or copyright holder(s), other than for strictly personal, individual use, unless the work is under an open content license (like Creative Commons). Disclaimer/Complaints regulations If you believe that digital publication of certain material infringes any of your rights or (privacy) interests, please let the Library know, stating your reasons. In case of a legitimate complaint, the Library will make the material inaccessible and/or remove it from the website. Please Ask the Library: https://uba.uva.nl/en/contact, or a letter to: Library of the University of Amsterdam, Secretariat, Singel 425, 1012 WP Amsterdam, The Netherlands. You will be contacted as soon as possible. UvA-DARE is a service provided by the library of the University of Amsterdam (https://dare.uva.nl) Download date:04 Oct 2021 Mensen, macht en mentaliteiten achter prikkeldraad Een historisch-sociologische studie van concentratiekamp Vught (1943-1944) Marieke Meeuwenoord 1 Mensen, macht en mentaliteiten achter prikkeldraad 2 Mensen, macht en mentaliteiten achter prikkeldraad Een historisch-sociologische studie van concentratiekamp Vught (1943-1944) ACADEMISCH PROEFSCHRIFT ter verkrijging van de graad van doctor aan de Universiteit van Amsterdam op gezag van de Rector Magnificus prof. -

Knut Døscher Master.Pdf (1.728Mb)
Knut Kristian Langva Døscher German Reprisals in Norway During the Second World War Master’s thesis in Historie Supervisor: Jonas Scherner Trondheim, May 2017 Norwegian University of Science and Technology Preface and acknowledgements The process for finding the topic I wanted to write about for my master's thesis was a long one. It began with narrowing down my wide field of interests to the Norwegian resistance movement. This was done through several discussions with professors at the historical institute of NTNU. Via further discussions with Frode Færøy, associate professor at The Norwegian Home Front Museum, I got it narrowed down to reprisals, and the cases and questions this thesis tackles. First, I would like to thank my supervisor, Jonas Scherner, for his guidance throughout the process of writing my thesis. I wish also to thank Frode Færøy, Ivar Kraglund and the other helpful people at the Norwegian Home Front Museum for their help in seeking out previous research and sources, and providing opportunity to discuss my findings. I would like to thank my mother, Gunvor, for her good help in reading through the thesis, helping me spot repetitions, and providing a helpful discussion partner. Thanks go also to my girlfriend, Sigrid, for being supportive during the entire process, and especially towards the end. I would also like to thank her for her help with form and syntax. I would like to thank Joachim Rønneberg, for helping me establish the source of some of the information regarding the aftermath of the heavy water raid. I also thank Berit Nøkleby for her help with making sense of some contradictory claims by various sources. -

Beladen Erfgoed Vertelt Een Verhaal
Beladen erfgoed vertelt een verhaal Gewapend met kaplaarzen en een zaklamp leidde Machlien Vlasblom vorig jaar een groep geschiedenisdocenten rond door de donkere, vochtige Apeldoornse bunker van rijkscommissaris Arthur Seyss-Inquart. De bunker behoort namelijk tot de categorie beladen, fout of omstreden WO2-erfgoed. In hoeverre kunnen beladen locaties een bijdrage leveren aan het onderwijs over en de perceptie op de Tweede Wereldoorlog? Machlien Vlasblom is e muur van Mussert werd onlangs als den al is er een glazen kap over de villa van de zelfstandig historicus. rijksmonument aangemerkt. Eenvoudig kampcommandant van Westerbork geplaatst met Het afgelopen jaar voerde zij voor D ging dit niet. We zien erfgoed vaak als iets als doel deze te behouden. Vorig jaar verstrekte WO2GLD een inventa- om trots op te zijn en iets waardoor we ons op de gemeente Apeldoorn een subsidie om de riserend onderzoek uit positieve wijze verbonden kunnen voelen met een voormalige bunker van rijkscommissaris Arthur naar beladen erfgoed in de provincie Gel- tastbaar verleden. Dit NSB-bouwwerk refereert Seyss-Inquart waterdicht te maken, zodat deze derland. echter aan een donkere, beladen geschiedenis . niet alleen een verleden heeft, maar ook een Een geschiedenis die pijn doet, wringt en schuurt. toekomst. De gemeente Rheden renoveerde een Desondanks is er een ontwikkeling gaande oude sporthal, gelegen op het statige landgoed waarbij steeds meer waarde wordt toegekend aan Avegoor. Deze sporthal was tijdens de bezet- gebouwen of locaties met een dergelijk oorlogs- ting gebouwd toen het landgoed als SS-Schule verleden.1 Deze (inter)nationale ontwikkeling fungeerde. De grondwerkzaamheden ter voorbe- resulteert in uiteenlopende initiatieven en pro- reiding op de bouw werden verricht door Joodse jecten. -

Ralph Pluim (Pdf)
J O N G E H I S T O R I C I S C H R I J V E N G E S C H I E D E N I S RALPH PLUIM Ook zij waren getuigen Ook zij waren getuigen Nederlanders bij het Nationalsozialistische Kraftfahrkorps (NSKK) 1941-1945 Inhoudsopgave Inleiding 3 1 De ontstaansgeschiedenis van het NSKK 1931-1941 Error! Bookmark not defined. 1.1 De automobiel verbindt Het belang van de automobiel voor Hitler en de nazi’s. Error! Bookmark not defined. 1.2 Het NSKK aan de biertafel De oprichting van het NSKK en haar eerste taken. Error! Bookmark not defined. 1.3 Het belang van de moord op Ernst Röhm Het NSKK wordt losgekoppeld van de SA. Error! Bookmark not defined. 1.4 Autoliefhebbers, sportliefhebbers en ambitieuze studenten Het NSKK breidt haar taken uit. Error! Bookmark not defined. 1.5 Het NSKK krijgt een praktische invulling. Het NSKK wordt ingezet voor de oorlog. Error! Bookmark not defined. 1.6 De eerste Nederlanders weten de weg naar het NSKK te vinden Werving Nederlanders voor het NSKK. Error! Bookmark not defined. 2 Nederlanders bij het NSKK 1941-1943 30 2.1 Niet weten waar je terecht komt Een keuze voor het NSKK. 31 2.2 Drank en sigaretten De `NSKK ziekte´ en SS-Wachbataillon `Nordwest´. Error! Bookmark not defined. 2.3 ‘Maak mij dan ook maar lid van de NSB’ NSKK´ers en de NSB. Error! Bookmark not defined. 2.4 Soms slaat de verveling toe De opleidingscholen van het NSKK. 44 2.5 Nederlandse NSKK’ers moesten zich NSKK-man voelen Kameraadschapsavonden en andere vrijetijdsbesteding van Nederlandse NSKK’ers. -
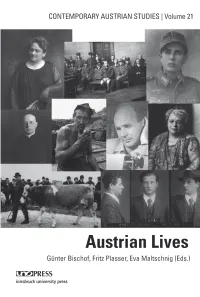
CAS21 for Birgit-No Marks
Austrian Lives Günter Bischof, Fritz Plasser, Eva Maltschnig (Eds.) CONTEMPORARY AUSTRIAN STUDIES | Volume 21 innsbruck university press Copyright ©2012 by University of New Orleans Press, New Orleans, Louisiana, USA. All rights reserved under International and Pan-American Copyright Conventions. No part of this book may be reproduced or transmitted in any form or by any means, electronic or mechanical, including photocopy, recording, or any information storage and retrieval system, without prior permission in writing from the publisher. All inquiries should be addressed to UNO Press, University of New Orleans, LA 138, 2000 Lakeshore Drive, New Orleans, LA, 70119, USA. www.unopress.org. Printed in the United States of America. Book and cover design: Lauren Capone Cover photo credits given on the following pages: 33, 72, 119, 148, 191, 311, 336, 370, 397 Published in the United States by Published and distributed in Europe University of New Orleans Press: by Innsbruck University Press: ISBN: 9781608010929 ISBN: 9783902811615 Contemporary Austrian Studies Sponsored by the University of New Orleans and Universität Innsbruck Editors Günter Bischof, CenterAustria, University of New Orleans Fritz Plasser, Universität Innsbruck Production Editor Copy Editor Bill Lavender Lauren Capone University of New Orleans University of New Orleans Executive Editors Klaus Frantz, Universität Innsbruck Susan Krantz, University of New Orleans Advisory Board Siegfried Beer Sándor Kurtán Universität Graz Corvinus University Budapest Peter Berger Günther Pallaver -

Austrian Lives
Austrian Lives Günter Bischof, Fritz Plasser, Eva Maltschnig (Eds.) CONTEMPORARY AUSTRIAN STUDIES | Volume 21 innsbruck university press Copyright ©2012 by University of New Orleans Press, New Orleans, Louisiana, USA. All rights reserved under International and Pan-American Copyright Conventions. No part of this book may be reproduced or transmitted in any form or by any means, electronic or mechanical, including photocopy, recording, or any information storage and retrieval system, without prior permission in writing from the publisher. All inquiries should be addressed to UNO Press, University of New Orleans, LA 138, 2000 Lakeshore Drive, New Orleans, LA, 70119, USA. www.unopress.org. Printed in the United States of America. Book and cover design: Lauren Capone Cover photo credits given on the following pages: 33, 72, 119, 148, 191, 311, 336, 370, 397 Published in the United States by Published and distributed in Europe University of New Orleans Press: by Innsbruck University Press: ISBN: 9781608010929 ISBN: 9783902811615 Contemporary Austrian Studies Sponsored by the University of New Orleans and Universität Innsbruck Editors Günter Bischof, CenterAustria, University of New Orleans Fritz Plasser, Universität Innsbruck Production Editor Copy Editor Bill Lavender Lauren Capone University of New Orleans University of New Orleans Executive Editors Klaus Frantz, Universität Innsbruck Susan Krantz, University of New Orleans Advisory Board Siegfried Beer Sándor Kurtán Universität Graz Corvinus University Budapest Peter Berger Günther Pallaver -

1939 Everyday Life Under Occupation: a Comparative Perspective Scenario
EVERYDAY LIFE subject UNDER OCCUPATION: a comparative perspective Context4. The Second World War and the German Germans was also countered. Among occupation had a great impact on the the countless campaigns organised by everyday life of European citizens. Condi- the Polish underground, the attempt to tions and legislation in individual countries liberate the capital from the German occu- differed depending on whether they were oc- pation in the face of the approaching Red cupied by or collaborated with the Third Reich. Army deserves particular attention. The War- Additionally, occupied countries were not treat- saw Rising broke out on 1 August 1944. It was ed equally. In Western Europe, the occupation the greatest city uprising in occupied Europe in had a different nature than in East-Central Europe. terms of scale and length. Two months of fighting For example, the Germans did not employ terror or ended in a defeat and brutal pacification of the ci- various types of repression there on such a scale as, vilian population estimated at 120,000–150,000. say, in the General Government (GG) or the Baltic The German forces almost completely destroyed states, Ukraine or the Balkans. In Western Europe, the city and thousands of surviving Warsaw resi- they also attempted to at least maintain the sham dents were sent to concentration camps. of decent treatment of civilians. Some administra- tive authority was left to local officials with control An extensive movement resisting the Germans was only over their actions. In principle, higher educa- also formed in occupied territories of the Soviet tion functioned normally there. -
A. Die Anfanglichen Grundsatzerklärungen Des Reichskommissars Und Die Niederländischen Generalsekretäre
III. POLITIK, ORGANISATION UND TATSÄCHLICHE MACHTSTRUKTUR DER DEUTSCHEN ZIVILVERWALTUNG A. Die anfanglichen Grundsatzerklärungen des Reichskommissars und die niederländischen Generalsekretäre „Das deutsche Volk ficht unter seinem Führer den Entscheidungskampf um Sein oder Nichtsein aus, den ihm der Flaß und Neid seiner Feinde aufgezwungen hat. Dieser Kampf gebietet dem deutschen Volk, alle seine Kräfte einzusetzen und gibt ihm das Recht, alle ihm erreichbaren Kräfte heranzuholen. Dieses Gebot und Recht der Not wird auch auf die Lebensführung des niederländischen Volkes und seiner Wirtschaft einwirken. Ich werde aber darum besorgt sein, daß das dem deutschen Volk blutsnahe niederländische Volk nicht in ungünstigere Lebensbedingungen ver- fällt, als es die gegebene Schicksalsgemeinschaft und der Vernichtungswille unserer Feinde in dieser Zeit nötig machen", so hatte Seyss-Inquart am 25. Mai 1940 in seinem „Aufruf an die niederländische Bevölkerung" erklärt1. In ähnlicher Weise äußerte er sich am 29. Mai 1940 in Den Haag, nachdem ihm der Militärbefehlshaber General von Falkenhausen die Regierungsgewalt in den besetzten niederländischen Gebieten übertragen hatte: „Wir kommen nicht hierher, um ein Volkstum zu be- drängen und zu zerstören und um einem Land die Freiheit zu nehmen . Wir wol- len dieses Land und seine Leute weder imperialistisch bedrängen, noch ihnen unsere politische Überzeugung aufdrängen"3. Die niederländischen Soldaten, so führte Seyss-Inquart bei dieser Gelegenheit weiter aus, hätten sich in dem Kampf, der den Deutschen von den Westmächten aufgezwungen worden sei, tapfer und ehrenvoll geschlagen. Die Deutschen wären lieber mit grüßender Hand als mit den „Waffen in den Fäusten" in dieses Land gekommen. Dank der „Großmut" des Führers und der Kraft der deutschen Wehrmacht sei die Ordnung und die Ruhe wiederherge- stellt worden und die Deutschen würden sich in die inneren Verhältnisse des Landes einschalten, soweit es „besondere Umstände des Augenblicks" erfordern. -
Rauter. Himmlers Vuist in Nederland T. Gerritse Summary
Rauter. Himmlers vuist in Nederland T. Gerritse Summary Rauter, Himmler’s fist in the Netherlands Rauter, Himmler’s fist in the Netherlands describes the life of Hanns Albin Rauter (1895- 1949), who was the most feared and hated representative of the German occupation in the Netherlands during the Second World War. As the agent of Heinrich Himmler, head of the SS, he showed no mercy in carrying out the tasks of the occupier. This biography does not limit itself to Rauter’s time in the Netherlands, but covers his entire earthly existence, from his birth in Klagenfurt, Austria, to the execution of his death sentence in the dunes of Scheveningen. The book is divided into three parts: Rauter’s years in Austria and Germany (1895- 1940), which has been given the title ‘Prelude’. ‘High stakes’ describes his reign of terror as Höherer SS- und Polizeiführer in the Netherlands (1940-1945), and ‘End-game’ (1946-1949) provides a detailed account of his trial at the Special Criminal Court and the Special Court of Cassation in The Hague. In the conclusion, the research questions are answered. Why does the dreaded Rauter deserve a biography? Oddly enough, the man who was nicknamed ‘the vulture from the Alps’, among other things, has virtually disappeared from the collective national memory. Post-war historians were interested in the activities perpetrated by the war criminals, but not in them as individuals and their motivations. They focused first and foremost on resistance fighters and, later, the victims. Based on his historical significance alone, Rauter ‘deserves’ a biography, but the question should also be asked whether Rauter was more than a one-dimensional, diabolical SS officer. -
Postma 1964 3426294.Pdf
A REICHSKQMMISSARIAT German Civil Government in the Netherlands 1940-1945 by Johannes Postma B.A., Graceland College, 1962 Submitted to the Department of History and the Faculty of the Graduate School of t~e University of Kansas in partial fulfulJ.Jnent of the requirements for the de- gree of }faster of Arts. Redacted Signature -. Instructor in charge Redacted Signature May, 1964 TABLE OF CONTENTS PAGE PREFACE . i CHAPTER I. IN THE GRASP OF THE THIRD REICH. • • • • 1 II. DEVELOPMENT, OBJECTIVES, AND STRUCTURE OF THE REICHSKOMMISSARIAT. • • • • • • • • • • • 18 III. PROMINENT PERSONNEL IN THE. REICHSKOMMISSARIA T. • • 3 9 IV. THE REICHSKOMMISSARIAT AND THE DUTCH ADMINISTRATION •••••••••••• . 70 V. THE REICHSKOMMISSARIAT AND THE REICH •••• . 91 VI .• CONCLUSIONS ••• . 111 BIBLIOGRAPHICAL ESSAY. 117 B;tBLI OGRAPHY. • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • .')124 CHARTS THE ORGANIZATION OF THE REICHSKOMMISSARIAT • • • • 38 THE REICHSKOMMISSARIAT IN RELATION TO THE REICH. • 110 PREFACE The Second World War, unleashed in 1939, caused great politi- cal upheavals and changes in the world, particularly in Europe. Many of the European nations were attacked and overrun by the powerful German armies. Some countries escaped a German invasion and consequent occupation by declaring and maintaining neutrality. These were Sweden, Switzerland, Spain, Portugal and Ireland. Other nations such as Italy, Finland, Hungary, Rumania, and Bul- garia chose to take sides with Germany, the last three responding under German pressure. With the exception of Finland, even these German allies experienced some form of German occupation. The following countries were all invaded and occupied by German troops: Austria, Czechoslovakia, Poland, Norway, Denmark, the Netherlands, Belgium, France, Yugoslavia, Greece, Estonia, Iatvia, Lithuania, and the Soviet Union. -
'De Eerste Soldaten Van Het Derde Rijk'?
‘De eerste soldaten van het Derde Rijk’? Vrijkorpsen, NSDAP en nazi-Duitsland, 1918-1934 Drs. W. Broek (s0751448) Bellevuelaan 88 2012 BX HAARLEM Tel.: 06-22373719 E-Mail: [email protected] Masterscriptie Political Culture and National Identities Dr. P. Dassen Opleiding Geschiedenis Universiteit Leiden 4 januari 2016 ‘De eerste soldaten van het Derde Rijk’? Inhoud Inleiding 3 Hoofdstuk 1. Ontstaansgeschiedenis en mythevorming vrijkorpsen 10 § 1.1 De ontstaansgeschiedenis van de vrijkorpsen 10 § 1.2 Diversiteit aan vrijkorpsen 14 § 1.3 Mythevorming vrijkorpsen in de late Weimarrepubliek 15 § 1.4 De drie vrijkorps-mythen 17 Hoofdstuk 2. Baltikumer 20 § 2.1 Baltikumer als “huurlingen van Engeland” 22 § 2.2 Samenstelling en motivatie Baltikumer 23 § 2.2.1 Materiële beloning voor de Baltikumer doorslaggevend? 23 § 2.2.2 Een leger van bandieten? 24 § 2.3 ‘Baltikum’-campagne als voortzetting Oberost en Ostpolitik 26 § 2.4 Doelstellingen en Verdrag van Versailles 28 § 2.5 Antisemitisme onder Baltikumer 32 § 2.6 Brutalisering in de ‘Baltikum’ 34 § 2.7 De Kapp-Lüttwitz-putsch 36 § 2.8 Organisation Consul en de moord op Walther Rathenau 39 Hoofdstuk 3. Adolf Hitler en de vrijkorpsen 42 § 3.1 Hitler en de vrijkorpsen tijdens de revolutie in München 42 § 3.2 De Hitler-putsch en de vrijkorpsen 45 § 3.3 SA en de vrijkorpsen 49 Hoofdstuk 4. Vrijkorps-herdenkingen in het Derde Rijk als ‘uitgevonden tradities’ 53 § 4.1 Albert Leo Schlageter als ‘eerste soldaat van het Derde Rijk’ 54 § 4.2 Kanttekeningen bij de ‘eerste soldaat van het Derde Rijk’ 57 § 4.3 Reichsehrenmal Annaberg 60 § 4.4 Kanttekeningen bij het Reichsehrenmal Annaberg 63 Conclusie 66 Literatuurlijst 71 Primaire bronnen 71 Secundaire literatuur 72 2 ‘De eerste soldaten van het Derde Rijk’? Inleiding “Waar was Hitler op het moment dat de strijd tegen het bolsjewisme in München daadwerkelijk plaatsvond?”1 Deze vraag stelde de belangrijkste spreker in een volgepakt Zirkus Krone in München op 26 februari 1933 op een bijeenkomst georganiseerd door de lokale afdeling van de Reichsbanner.