Mitteilungsblatt März 09
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

Synthese Des Votes Par Groupes Politiques
POINTAGE DES VOTES CONCERNANT L’ACCORD AGRICOLE UE-MAROC APPROUVE PAR LE PARLEMENT EUROPEEN LE 16 FEVRIER 2012 – 17/02/2012 – SYNTHESE DES VOTES PAR GROUPES POLITIQUES Absents ou Total Adhésion au Groupe Pour Contre Abstention Présents Refus de des vote voter membres national ALDE 57 5 5 67 18 85 77.61% ECR 29 5 4 38 15 53 64.47% EFD 4 17 2 23 10 33 60.87% PPE 156 60 13 229 42 271 52.18% VERTS 2 47 2 51 7 58 88.24% GUE- 0 29 1 30 4 34 95.00% NGL NI 3 17 1 21 9 30 71.43% S&D 116 44 3 163 27 190 56.75% 367 224 31 622 132 754 Mission du Royaume du Maroc auprès de l’Union Européenne Bruxelles POINTAGE DES VOTES CONCERNANT L’ACCORD AGRICOLE UE-MAROC APPROUVE PAR LE PARLEMENT EUROPEEN LE 16 FEVRIER 2012 – 17/02/2012 – SYNTHESE DES VOTES NATIONAUX Absences Adhésion Total des Etat membre Pour Contre Abstentions Présents ou refus de au vote membres voter national Autriche 7 12 0 19 0 19 44.74% Belgique 11 5 0 16 6 22 53.13% Bulgarie 14 2 0 16 2 18 81.25% Chypre 2 4 0 6 0 6 50.00% République 13 4 2 19 3 22 52.63% Tchèque Danemark 9 1 0 10 3 13 85.00% Estonie 5 1 0 6 0 6 75.00% Finlande 5 6 1 12 1 13 25.00% France 32 18 9 59 15 74 31.36% Allemagne 63 19 4 86 13 99 59.88% Grèce 12 3 2 17 5 22 55.88% Hongrie 12 1 0 13 9 22 88.46% Irlande 5 4 0 9 3 12 33.33% Italie 25 34 2 61 12 73 33.61% Lettonie 5 2 0 7 2 9 57.14% Lituanie 6 1 2 9 3 12 50.00% Luxembourg 5 1 0 6 0 6 75.00% Malte 0 4 0 4 2 6 100.00% Mission du Royaume du Maroc auprès de l’Union Européenne Bruxelles POINTAGE DES VOTES CONCERNANT L’ACCORD AGRICOLE UE-MAROC APPROUVE PAR LE PARLEMENT EUROPEEN -
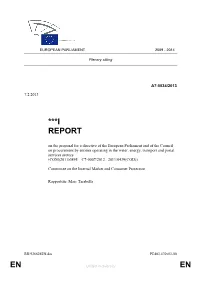
En En ***I Report
EUROPEAN PARLIAMENT 2009 - 2014 Plenary sitting A7-0034/2013 7.2.2013 ***I REPORT on the proposal for a directive of the European Parliament and of the Council on procurement by entities operating in the water, energy, transport and postal services sectors (COM(2011)0895 – C7-0007/2012– 2011/0439(COD)) Committee on the Internal Market and Consumer Protection Rapporteur: Marc Tarabella RR\926628EN.doc PE483.470v03-00 EN United in diversity EN PR_COD_1amCom Symbols for procedures * Consultation procedure *** Consent procedure ***I Ordinary legislative procedure (first reading) ***II Ordinary legislative procedure (second reading) ***III Ordinary legislative procedure (third reading) (The type of procedure depends on the legal basis proposed by the draft act.) Amendments to a draft act In amendments by Parliament, amendments to draft acts are highlighted in bold italics. Highlighting in normal italics is an indication for the relevant departments showing parts of the draft act which may require correction when the final text is prepared – for instance, obvious errors or omissions in a language version. Suggested corrections of this kind are subject to the agreement of the departments concerned. The heading for any amendment to an existing act that the draft act seeks to amend includes a third line identifying the existing act and a fourth line identifying the provision in that act that Parliament wishes to amend. Passages in an existing act that Parliament wishes to amend, but that the draft act has left unchanged, are highlighted in bold. Any deletions that Parliament wishes to make in such passages are indicated thus: [...]. PE483.470v03-00 2/296 RR\926628EN.doc EN CONTENTS Page DRAFT EUROPEAN PARLIAMENT LEGISLATIVE RESOLUTION................................ -
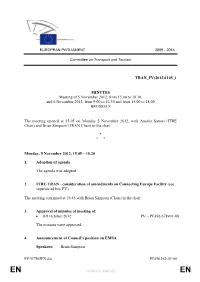
Tran Pv(2012)1105 1
EUROPEAN PARLIAMENT 2009 - 2014 Committee on Transport and Tourism TRAN_PV(2012)1105_1 MINUTES Meeting of 5 November 2012, from 15.00 to 18.30, and 6 November 2012, from 9.00 to 12.30 and from 15.00 to 18.00 BRUSSELS The meeting opened at 15.05 on Monday 5 November 2012, with Amalia Sartori (ITRE Chair) and Brian Simpson (TRAN Chair) in the chair. * * * Monday, 5 November 2012, 15.05 – 18.20 1. Adoption of agenda The agenda was adopted. 2. ITRE-TRAN - consideration of amendments on Connecting Europe Facility (see separate ad hoc PV) The meeting continued at 16.45 with Brian Simpson (Chair) in the chair. 3. Approval of minutes of meeting of: 8-9 October 2012 PV – PE496.678v01-00 The minutes were approved. 4. Announcement of Council's position on EMSA Speakers: Brian Simpson. PV\917565EN.doc PE498.162v01-00 EN United in diversityEN 5. Groundhandling services at Union airports and repeal of Council Directive 96/67/EC TRAN/7/08027 ***I 2011/0397(COD) COM(2011)0824 – C7-0457/2011 Rapporteur: Artur Zasada (PPE) PR – PE494.627v01-00 AM – PE496.364v02-00 AM – PE496.365v02-00 DT – PE489.673v01-00 Responsible: TRAN* – Opinions: EMPL* – Thomas Mann (PPE) AD – PE491.100v02-00 AM – PE492.654v01-00 ENVI – Decision: no opinion IMCO – Ildikó Gáll-Pelcz (PPE) AD – PE489.551v05-00 AM – PE491.335v02-00 Consideration of amendments Speakers: Artur Zasada, Thomas Mann, Saïd El Khadraoui, Wolf Klinz, Eva Lichtenberger, Peter van Dalen, Sabine Wils, Mathieu Grosch, Bogusław Liberadzki, Philippe De Backer, Michael Cramer, Jacqueline Foster, Georges Bach, Michael Gahler, Jaromír Kohlíček, Luis de Grandes Pascual, Brian Simpson, Matthew Baldwin (EC). -

TRAN PV(2013)1014 1 MINUTES Meeting of 14 October 2013
EUROPEAN PARLIAMENT 2009 - 2014 Committee on Transport and Tourism TRAN_PV(2013)1014_1 MINUTES Meeting of 14 October 2013, from 15.00 to 18.30 BRUSSELS The meeting opened at 15.03 on Monday 14 October 2013, with Brian Simpson (Chair) in the chair. * * * Monday, 14 October 2013, 15.03 – 18.20 1. Adoption of agenda The agenda was adopted. 2. Approval of minutes of meeting of: 16-17 September 2013 PV – PE516.974v01-00 The minutes were approved. 3. Chair’s announcements concerning coordinators’ decisions on 30 September 2013 The Coordinators decisions were approved. 2014 Programmes for public hearings, delegations and relations with national Parliaments Decision: Decisions on any hearings in the first three months of 2014 and for one delegation in the week beginning 24 March 2014 would be discussed on 14 October. No activities with national Parliaments were planned in the first half of 2014. PV\1005970EN.doc PE521.545v01-00 EN United in diversity EN TRAN Studies: overview and follow-up until the end of the legislative period Decision: no new studies to be requested in this legislature. Policy Department requested to provide precise information about the progress made on the studies already requested and the month when they should be ready. Comitology Decision: Coordinators took note of newsletter No. 20 of 23 September and that deadlines were open for two Commission acts where the Committee had veto rights. 4. Amendment of Directive 2012/34/EU of the European Parliament and of the Council of 21 November 2012 establishing a single European -
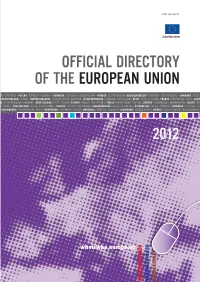
Official Directory of the European Union
ISSN 1831-6271 Regularly updated electronic version FY-WW-12-001-EN-C in 23 languages whoiswho.europa.eu EUROPEAN UNION EUROPEAN UNION Online services offered by the Publications Office eur-lex.europa.eu • EU law bookshop.europa.eu • EU publications OFFICIAL DIRECTORY ted.europa.eu • Public procurement 2012 cordis.europa.eu • Research and development EN OF THE EUROPEAN UNION BELGIQUE/BELGIË • БЪЛГАРИЯ • ČESKÁ REPUBLIKA • DANMARK • DEUTSCHLAND • EESTI • ΕΛΛΑΔΑ • ESPAÑA • FRANCE • ÉIRE/IRELAND • ITALIA • ΚΥΠΡΟΣ/KIBRIS • LATVIJA • LIETUVA • LUXEMBOURG • MAGYARORSZÁG • MALTA • NEDERLAND • ÖSTERREICH • POLSKA • PORTUGAL • ROMÂNIA • SLOVENIJA • SLOVENSKO • SUOMI/FINLAND • SVERIGE • UNITED KINGDOM • BELGIQUE/BELGIË • БЪЛГАРИЯ • ČESKÁ REPUBLIKA • DANMARK • DEUTSCHLAND • EESTI • ΕΛΛΑ∆Α • ESPAÑA • FRANCE • ÉIRE/IRELAND • ITALIA • ΚΥΠΡΟΣ/KIBRIS • LATVIJA • LIETUVA • LUXEMBOURG • MAGYARORSZÁG • MALTA • NEDERLAND • ÖSTERREICH • POLSKA • PORTUGAL • ROMÂNIA • SLOVENIJA • SLOVENSKO • SUOMI/FINLAND • SVERIGE • UNITED KINGDOM • BELGIQUE/BELGIË • БЪЛГАРИЯ • ČESKÁ REPUBLIKA • DANMARK • DEUTSCHLAND • EESTI • ΕΛΛΑΔΑ • ESPAÑA • FRANCE • ÉIRE/IRELAND • ITALIA • ΚΥΠΡΟΣ/KIBRIS • LATVIJA • LIETUVA • LUXEMBOURG • MAGYARORSZÁG • MALTA • NEDERLAND • ÖSTERREICH • POLSKA • PORTUGAL • ROMÂNIA • SLOVENIJA • SLOVENSKO • SUOMI/FINLAND • SVERIGE • UNITED KINGDOM • BELGIQUE/BELGIË • БЪЛГАРИЯ • ČESKÁ REPUBLIKA • DANMARK • DEUTSCHLAND • EESTI • ΕΛΛΑΔΑ • ESPAÑA • FRANCE • ÉIRE/IRELAND • ITALIA • ΚΥΠΡΟΣ/KIBRIS • LATVIJA • LIETUVA • LUXEMBOURG • MAGYARORSZÁG • MALTA • NEDERLAND -

List of Meps (Provisional)
List of MEPs Germany: CDU/CSU (EPP): Ingeborg Grässle (sort.), Monika Hohlmeier, Elisabeth Jeggle (sort.), Christa Klass (sort.), Angelika Niebler (sort.), Doris Pack (sort.), Godelieve Quisthoudt-Rowohl (sort.), Brigit Schnieber-Jastram, Renate Sommer (sort.), Sabine Verheyen, Anja Weisgerber (sort.), SPD (PASD) : Evelyne Gebhardt (sort.), Jutta Haug (sort.), Petra Kammerevert, Constanze Krehl (sort.), Dagmar Reichenbach (sort.), Ulrike Rodust (sort.), Birgit Sippel, Jutta Steinruck, Barbara Weiler (sort.), Kerstin Westphal, FDP (ALDE) : Nadja Hirsch, Silvana Koch-Mehrin (sort.), Gesine Meissner, Britta Reimers, Alexandra Thein Grünen (greens): Franziska Katharina Brantner, Rebecca Harms (sort.), Franziska Maria Keller, Barbara Elisabeth Lochbihler, Heidemarie-Rose Rühle (sort.), Elisabeth Schroedter (sort.), Helga Trüpel (sort.) Die Linke (GUE) : Cornelia Ernst, Sabine Lösing, Sabine Wils, Gabriele Zimmer (sort.) Austria: ÖVP (EEP): Elisabeth Köstinger, Hella Ranner, SPÖ (PASD): Karin Kadenbach, Evelyn Regner Grüne (Greens): Evelin Lichtenberger (sort.), Ulrike Lunacek, Liste Hans-Peter Martin (NI) : Angelika Werthmann Belgium: CDH (EPP) : Anne Delvaux CD&V (EPP) : Marianne Thyssen (sort.) PS (PASD) : Véronique de Keyser (sort.) SP.A (PASD) : Kathleen Van Brempt MR (ALDE): Frédérique Ries (sort.) ECOLO -greens : Isabelle Durant VLD (ALDE) : Annemie Neyts-Uyttebroeck (sort.) N-VA (Greens) : Frieda Brepoels Bulgaria: GERB (EPP) : Iliana Ivanova, Rumyana Jeleva (sort.), Maria Nedeltcheva, Blue coalition (EPP) : Nadejda Mihaïlova BSP (PASD) -

Minutes of the Sitting of 13 October 2011
10.2.2012 EN Official Journal of the European Union C 37 E/21 Thursday 13 October 2011 MINUTES OF THE SITTING OF 13 OCTOBER 2011 (2012/C 37 E/02) Contents Page 1. Opening of the sitting . 22 2. Decisions concerning certain documents . 22 3. The future of VAT (debate) . 23 4. American Jobs Act (debate) . 23 5. Dog population management in the European Union (written declaration) . 24 6. Voting time . 24 6.1. EU-Cape Verde agreement on certain aspects of air services *** (Rule 138) (vote) . 24 6.2. Insurance guarantee schemes (Rule 138) (vote) . 24 6.3. The future of VAT (Rule 138) (vote) . 25 6.4. Appointment of a member of the Executive Board of the European Central Bank (vote) 25 6.5. EU guarantee to the EIB against losses under loans and loan guarantees for projects outside the EU ***II (vote) . 25 6.6. Subscription to additional shares in the capital of the EBRD ***I (vote) . 26 6.7. Firearms, their parts and components and ammunition: implementation of the UN Firearms Protocol ***I (vote) . 26 6.8. Exceptional trade measures for the EU’s Stabilisation and Association process ***I (final vote) . 26 6.9. Preparation for the European Council meeting (vote) . 27 6.10. Accession of Bulgaria and Romania to Schengen (vote) . 27 7. Council position at first reading . 27 8. Verification of credentials . 28 9. Explanations of vote . 28 10. Corrections to votes and voting intentions . 28 11. Documents received . 29 12. Written declarations included in the register (Rule 123) . 29 13. Forwarding of texts adopted during the sitting . -
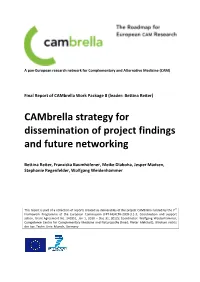
Cambrella Strategy for Dissemination of Project Findings and Future Networking
A pan-European research network for Complementary and Alternative Medicine (CAM) Final Report of CAMbrella Work Package 8 (leader: Bettina Reiter) CAMbrella strategy for dissemination of project findings and future networking Bettina Reiter, Franziska Baumhöfener, Meike Dlaboha, Jesper Madsen, Stephanie Regenfelder, Wolfgang Weidenhammer This report is part of a collection of reports created as deliverables of the project CAMbrella funded by the 7th Framework Programme of the European Commission (FP7-HEALTH-2009-3.1-3, Coordination and support action, Grant-Agreement No. 241951, Jan 1, 2010 – Dec 31, 2012); Coordinator: Wolfgang Weidenhammer, Competence Centre for Complementary Medicine and Naturopathy (head: Dieter Melchart), Klinikum rechts der Isar, Techn. Univ. Munich, Germany CAMbrella Work Package 8 Report Page 2 Bettina Reiter1, Franziska Baumhöfener2, Meike Dlaboha2, Jesper Madsen3, Stephanie Regenfelder4, Wolfgang Weidenhammer4: CAMbrella strategy for dissemination of project findings and future networking Final Report of CAMbrella Work Package 8 (leader: Bettina Reiter) 1 Viennese Academy for Integrative Medicine, Gamed, Vienna, Austria 2 Bavarian Research Alliance GmbH (BayFOR), Munich, Germany 3 Centre for Cross-disciplinary Evaluation Studies of CAM (CCESCAM), Department of Public Health, University of Southern Denmark, Odense, Denmark 4 Competence Centre for Complementary Medicine and Naturopathy (CoCoNat), Techn. Univ. Munich, Germany 2012 Contact: Viennese Academy for Integrative Medicine, Gamed, Vienna, Austria http://www.gamed.or.at/g_home.php -

Stimmzettel Für Die Wahl Der Abgeordneten Des Europäischen Parlaments Am 7
Stimmzettel für die Wahl der Abgeordneten des Europäischen Parlaments am 7. Juni 2009 im Land Bremen Sie haben 1 Stimme Bitte hier ankreuzen SPD Sozialdemokratische Partei Deutschlands - Gemeinsame Liste für alle Länder - 1 1. Martin Schulz, Buchhändler, Würselen (NW) 6. Bernd Lange, Abteilungsleiter, Burgdorf (NI) 2. Evelyne Gebhardt, MdEP/Übersetzerin, Mulfingen (BW) 7. Jutta Steinruck, MdL/DGB-Regionsvorsitzende, Ludwigshafen am Rhein (RP) 3. Bernhard Rapkay, MdEP/Referent, Dortmund (NW) 8. Udo Bullmann, MdEP/Politikwissenschaftler, Gießen (HE) 4. Jutta Haug, MdEP/Wirtschafts- und Finanzberaterin, Herten (NW) 9. Dagmar Reichenbach (Roth-Behrendt), MdEP/Juristin, Potsdam (BB) 5. Wolfgang Kreissl-Dörfler, MdEP/Landwirt, München (BY) 10. Jens Geier, Angestellter, Essen (NW) CDU Christlich Demokratische Union Deutschlands - Liste für das Land Bremen - 1. Carl Kau, Bankkaufmann, Bremen 2 2. Dr. Iris Spieß, Geschäftsführerin VDI, Bremen 3. Andreas Tserkezidis, selbst. Gastronom, Bremen 4. Vicky Wollny, Studentin, Bremen 5. Bernd Wundersee, Dipl.-Ingenieur, Bremen GRÜNE BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN - Gemeinsame Liste für alle Länder - 1. Rebecca Harms, MdEP, Waddeweitz (NI) 6. Michael Cramer, MdEP, Berlin (BE) 3 2. Reinhard Bütikofer, Politiker, Berlin (BE) 7. Franziska Maria Keller, Studentin, Guben (BB) 3. Heidemarie-Rose Rühle, MdEP, Stuttgart (BW) 8. Werner Gustav Schulz, Dipl.-Ingenieur, Berlin (BE) 4. Sven Giegold, Wirtschaftswissenschaftler, Dörverden (NI) 9. Dr. Helga Trüpel, MdEP, Bremen (HB) 5. Barbara Elisabeth Lochbihler, Politologin/Sozialpädagogin, Berlin (BE) 10. Martin Häusling, Biobauer, Bad Zwesten (HE) FDP Freie Demokratische Partei - Gemeinsame Liste für alle Länder - 1. Dr. Silvana Koch-Mehrin, Unternehmensberaterin, Stuttgart (BW) 6. Alexander Pickart Alvaro, MdEP, Düsseldorf (NW) 4 2. Alexander Graf Lambsdorff, Diplomat, Bonn (NW) 7. -

Ranking European Parliamentarians on Climate Action
Ranking European Parliamentarians on Climate Action EXECUTIVE SUMMARY CONTENTS With the European elections approaching, CAN The scores were based on the votes of all MEPs on Austria 2 Europe wanted to provide people with some these ten issues. For each vote, MEPs were either Belgium 3 background information on how Members of the given a point for voting positively (i.e. either ‘for’ Bulgaria 4 European Parliament (MEPs) and political parties or ‘against’, depending on if the text furthered or Cyprus 5 represented in the European Parliament – both hindered the development of climate and energy Czech Republic 6 national and Europe-wide – have supported or re- policies) or no points for any of the other voting Denmark 7 jected climate and energy policy development in behaviours (i.e. ‘against’, ‘abstain’, ‘absent’, ‘didn’t Estonia 8 the last five years. With this information in hand, vote’). Overall scores were assigned to each MEP Finland 9 European citizens now have the opportunity to act by averaging out their points. The same was done France 10 on their desire for increased climate action in the for the European Parliament’s political groups and Germany 12 upcoming election by voting for MEPs who sup- all national political parties represented at the Greece 14 ported stronger climate policies and are running European Parliament, based on the points of their Hungary 15 for re-election or by casting their votes for the respective MEPs. Finally, scores were grouped into Ireland 16 most supportive parties. CAN Europe’s European four bands that we named for ease of use: very Italy 17 Parliament scorecards provide a ranking of both good (75-100%), good (50-74%), bad (25-49%) Latvia 19 political parties and individual MEPs based on ten and very bad (0-24%). -

Minutes of the Sitting of 21 October 2013
4.2.2014 EN Official Journal of the European Union C 32 E/1 Monday 21 October 2013 IV (Notices) NOTICES FROM EUROPEAN UNION INSTITUTIONS, BODIES, OFFICES AND AGENCIES EUROPEAN PARLIAMENT 2013-2014 SESSION Sittings of 21 to 24 October 2013 STRASBOURG MINUTES OF THE SITTING OF 21 OCTOBER 2013 (2014/C 32 E/01) Contents Page 1. Resumption of the session . 2 2. Approval of the minutes of the previous sitting . 2 3. Request for the defence of parliamentary immunity . 2 4. Request for urgent procedure . 2 5. Signature of acts adopted under the ordinary legislative procedure (Rule 74) . 3 6. Follow-up to a request for the waiver of immunity . 4 7. Documents received . 4 8. Questions for oral answer (submission) . 6 9. Petitions . 6 10. Order of business . 7 11. Climate change conference (debate) . 8 12. Application and enforcement of international trade rules ***I (debate) . 9 13. EU trade policy towards countries of the Eastern Partnership (debate) . 10 14. Trade between the Community and third countries in drug precursors ***I (debate) . 10 C 32 E/2 EN Official Journal of the European Union 4.2.2014 Monday 21 October 2013 Contents (continued) Page 15. One-minute speeches on matters of political importance . 11 16. Sexual and reproductive health and rights (short presentation) . 11 17. Human rights in the Sahel region (short presentation) . 11 18. Local authorities and civil society (short presentation) . 12 19. Rethinking education (short presentation) . 12 20. EU pre-accession funds: judicial systems and the fight against corruption (short presentation) 12 21. Agenda of the next sitting . -

Download File
REVIEW OF ACTIVITIES European United Left/Nordic Green Left Group in the European Parliament 2012-2014 Photos: GUE/NGL; European Parliament Compiled by Gay Kavanagh Layout & design by Charli Aron © GUE/NGL 2014 Contents Introduction 2 The Economic & Financial Crisis 3 Budget & Bugetary Control 11 Employment & Social Policy 15 Environment, Public Health & Consumer Protection 22 Foreign Policy & Peace 29 Civil Liberties, Fundamental & Human Rights 39 Gender Equality 45 Development 48 International Trade 49 Regional Development 52 Agriculture & Fisheries 53 Industry & Energy 55 Transport 58 Culture & Education 60 GUE/NGL Study Days 62 Reports & Opinions by GUE/NGL MEPs (2012-2014) 63 THE EUROPEAN UNITED LEFT • NORDIC GREEN LEFT ACTIVITY REVIEW 2012 - 2014 1 Introduction The second part of the European Parliament’s 7th term of office (2012-2014) saw the continuation of the disastrous economic and social crisis that rocked the European Union to its foundations and affected the livelihoods of millions of EU citizens, as well as a series of unsuccessful attempts to solve this crisis. The Confederal Group of the European United Left/Nordic Green Left (GUE/NGL)1 continued to reiterate its message that the answer to this crisis was not the imposition of even greater austerity but more policies that put the interests of ordinary people above those of bankers, shareholders and the financial elite. Among the measures devised by the EU institutions to counter the crisis was the creation of yet another Treaty, the so-called Fiscal Compact, to ensure greater stability, coordination and governance in economic and monetary union; the European Semester, a mechanism whereby member states are asked at six-monthly intervals to align their budgetary and economic policies with the objectives and rules agreed at EU level; structural reform of the EU banking sector as well as steps towards the creation of a Banking Union.