~S4(Hsenundanhalt
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

Pedigree of the Wilson Family N O P
Pedigree of the Wilson Family N O P Namur** . NOP-1 Pegonitissa . NOP-203 Namur** . NOP-6 Pelaez** . NOP-205 Nantes** . NOP-10 Pembridge . NOP-208 Naples** . NOP-13 Peninton . NOP-210 Naples*** . NOP-16 Penthievre**. NOP-212 Narbonne** . NOP-27 Peplesham . NOP-217 Navarre*** . NOP-30 Perche** . NOP-220 Navarre*** . NOP-40 Percy** . NOP-224 Neuchatel** . NOP-51 Percy** . NOP-236 Neufmarche** . NOP-55 Periton . NOP-244 Nevers**. NOP-66 Pershale . NOP-246 Nevil . NOP-68 Pettendorf* . NOP-248 Neville** . NOP-70 Peverel . NOP-251 Neville** . NOP-78 Peverel . NOP-253 Noel* . NOP-84 Peverel . NOP-255 Nordmark . NOP-89 Pichard . NOP-257 Normandy** . NOP-92 Picot . NOP-259 Northeim**. NOP-96 Picquigny . NOP-261 Northumberland/Northumbria** . NOP-100 Pierrepont . NOP-263 Norton . NOP-103 Pigot . NOP-266 Norwood** . NOP-105 Plaiz . NOP-268 Nottingham . NOP-112 Plantagenet*** . NOP-270 Noyers** . NOP-114 Plantagenet** . NOP-288 Nullenburg . NOP-117 Plessis . NOP-295 Nunwicke . NOP-119 Poland*** . NOP-297 Olafsdotter*** . NOP-121 Pole*** . NOP-356 Olofsdottir*** . NOP-142 Pollington . NOP-360 O’Neill*** . NOP-148 Polotsk** . NOP-363 Orleans*** . NOP-153 Ponthieu . NOP-366 Orreby . NOP-157 Porhoet** . NOP-368 Osborn . NOP-160 Port . NOP-372 Ostmark** . NOP-163 Port* . NOP-374 O’Toole*** . NOP-166 Portugal*** . NOP-376 Ovequiz . NOP-173 Poynings . NOP-387 Oviedo* . NOP-175 Prendergast** . NOP-390 Oxton . NOP-178 Prescott . NOP-394 Pamplona . NOP-180 Preuilly . NOP-396 Pantolph . NOP-183 Provence*** . NOP-398 Paris*** . NOP-185 Provence** . NOP-400 Paris** . NOP-187 Provence** . NOP-406 Pateshull . NOP-189 Purefoy/Purifoy . NOP-410 Paunton . NOP-191 Pusterthal . -
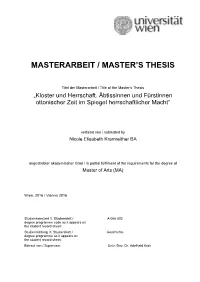
Masterarbeit / Master's Thesis
MASTERARBEIT / MASTER’S THESIS Titel der Masterarbeit / Title of the Master‘s Thesis „Kloster und Herrschaft. Äbtissinnen und Fürstinnen ottonischer Zeit im Spiegel herrschaftlicher Macht“ verfasst von / submitted by Nicole Elisabeth Kramreither BA angestrebter akademischer Grad / in partial fulfilment of the requirements for the degree of Master of Arts (MA) Wien, 2016 / Vienna 2016 Studienkennzahl lt. Studienblatt / A 066 803 degree programme code as it appears on the student record sheet: Studienrichtung lt. Studienblatt / Geschichte degree programme as it appears on the student record sheet: Betreut von / Supervisor: Univ.-Doz. Dr. Adelheid Krah Danksagung An dieser Stelle möchte ich meine Dankbarkeit an all jene richten, die mich im Rahmen meines Masterstudiums und auch der Masterarbeit begleitet haben. Ein besonderes Dankeschön gilt meiner Betreuerin, Fr. Univ.-Doz. Dr. Adelheid Krah, die durch ihre Lehrveranstaltungen meine Begeisterung für die mittelalterliche Geschichte geweckt hat und mir in allen Bereichen des Studiums stets eine verständnisvolle und inspirierende Ansprechpartnerin war. Ein besonderer Dank gilt meiner Familie, insbesondere meinem Mann Christian und meiner Tochter Victoria, die mir die Zeit ermöglicht haben, meine Studien zu vollenden. Abschließend möchte ich mich noch bei meiner Chefin, Univ.- Prof. Dr. Andrea Laslop bedanken, die mich stets ermuntert hat, meinen akademischen Weg weiter zu beschreiten. Inhaltsverzeichnis 1. Einleitung ...................................................................................................................................................... -

Die Anfänge Askanischer Herrschaft Im Raum Köthen
Die Anfänge askanischer Herrschaft im Raum Köthen Von Helmut Assing, Potsdam Wenn hier vom Raum Köthen die Rede ist, so soll darunter die Landschaft verstan- den werden, die von Elbe, Mulde, Fuhne und Saale begrenzt wird und in deren Mittelpunkt Köthen liegt. Sie bildete im 10./11. Jh., d.h. in der Zeit, in die die An- fänge der askanischen' Herrschaft fallen, den sog. Gau Serimunt. Der Zweck die- ses Beitrages kann deshalb auch so formuliert werden, daß es gilt, den Herrschafts- beginn der Askanier im Gau Serimunt zu untersuchen. Obwohl in zahlreichen Veröffentlichungen dieses Thema gestreift wird, hat doch nur Otto v. Heinemann vor fast 130 Jahren eine auf tiefgründiger Quellenanalyse beruhende Lösung angeboten‘. Alle anderen Autoren? haben im wesentlichen seine Ergebnisse übernommen, mitunter in einigen Details kleine Korrekturen an- gebracht. Der vorliegende Beitrag konzentriert sich daher — nach einem ersten kurzen Einblick in die Quellen — zunächst auf Heinemanns Arbeit und fragt, wie glaubwürdig die dortige Auffassung ist. In neuer Beleuchtung einiger wichtiger Quellen wird dann ein eigener Lösungsansatz zur Diskussion gestellt. Es wird in der Literatur zuwenig hervorgehoben, daß vor Albrecht dem Bären, der nach dem Tode seines Vaters 1123 die Herrschaft in den askanischen Territorien Ostsachsens® übernahm, keine definitiven Quelleninformationen zu irgendwel- chen askanischen Herrschaftsrechten? in Serim'ınt zu finden sind. Doch Albrecht steht längst nicht am Anfang der Überlieferung. Er gehörte der vierten Askanier- generation an, von der wir namentlich aus den Quellen wissen. Die älteste Erwäh- nung eines Askaniers stammt aus dem Jahre 1036, als Graf Esico in einer Urkunde Kaiser Konrads II. erscheint. Er war der Urgroßvater Albrechts des Bären und Vater des Grafen Adalbert, dessen Sohn Otto wiederum Albrechts Vater war”. -

Gotthard Matysik
Westgermanisch-deutscher Volksstamm in Holstein. Historische Erwähnung im 2. Jh. n. Chr. durch den griechischen Geographen u. Astronomen Ptolemäus. Sachsen – Ableitung von „Schwertgenossen“ Im 1. Jh. n. Chr. erfolgte der Einbruch der Chauken über See in das Land an Unterelbe u. Unterweser. 100 Jahre später ging das Volk der Chauken im Volk der Sachsen auf, verschmolzen mit Chauken, Langobarden, Cheruskern u. anderen Stammesteilen. Die nach Süden vordringenden Sachsen wurden auch Nordalbingier genannt. Sie rückten von den Langobarden freigezogenen Raum in Norddeutschland nach. Konflikte mit den Thüringern folgte, die ebenfalls das verlassene Gebiet der Langobarden beanspruchten. Auch die Friesen ließen sich nicht verdrängen. Im 3. Jh. wurden Raubzüge zur See gemeinsam mit den Saliern an der gallischen Küste unternommen, vermutlich auch mit Angeln u. Jüten. 355 erzwang Mitkaiser Julian ihre Zurückdrängung über den Rhein. Köln wurde wieder römisch. 357 kam es bei Straßburg zur römischen Entscheidungsschlacht gegen die Sachsen. 386 kamen die Sachsen mit den Franken u. Burgundern nach Gallien. Um 400 setzten sich die Sachsen an der Küste Galliens, der heutigen Bretagne, fest. Im 5. Jh. wurde zusammen mit Angeln u. Jüten England erobert (Angelsachsen). Grenzstreitigkeiten mit den Franken führte zu den Kriegen mit Ks. Karl d. Gr. (772-804) u. zur Unterwerfung der Sachsen unter Widukind, ihrer Christianisierung u. Eingliederung in das Frankenreich. Sächsische Geschlechter: Liudolfinger 880 - 961 Auch ottonisches Geschlecht genannt. Nach Zerfall des Frankenreiches entwickelte sich unter Führung der Liudolfinger das Stammesherzogtum Sachsen Billunger 961 - 1106 Askanier Sachsen-Wittenberg 1180 - 1422 Askanische Linie Sachsen-Lauenburg bis 1689 Wettiner Ernestinische Linie Seit 1463 Nachkommen des Kurfürsten Ernst von Sachsen Wettiner Albertinische Linie Seit 1464 Jüngerer Zweig. -

• Übersicht. Xxxin
• Übersicht. XXXII. 453. Herzogtum. Fürst beruft Hoftag seines Sprengeis als Vertreter des Königs. Hervortreten des'älteren Herzogtums. Verschiedenheit herzog- licher Befugnisse. Bedeutung der vollen Herzogsgewalt. 454. Herzog Stell- vertreter des Königs. Königliche Ehren des Herzogs. Strafbestimmungen unter Königsbann. 455. Königsdienste von Bischöfen und sonst. 456. Herzog Vertreter des Landes beim Könige. 457. Heerführer. 458. Höchster Gerichts- herr als Herr der Grafschaften. Nicht-herzogliche Grafschaften gehören nicht zum Herzogtume. 459. Appellation von Grafen an den Herzog. 460. Vertreter des Herzogs im Gerichte. Bayrischer Pfalzgraf und Landgraf. 461. Herzog richtet über Eigen. Einweisung durch herzogliche Boten. Ebenso konkurriert der König überall mit dem Herzoge. Sachsenspiegel kennt nur Appellation von Grafen an König. 462. Recht des Königs und Grafen auf erbloses Gut; des Herzogs in Bayern, Österreich, Aglei. 463. In Bayern noch im drei- zehnten Jahrhundert allgemeiner Richter. Acht des Herzogs gilt für das ganze Land. 464. Recht der Landesverweisung. 465. Aufrechterhaltung des Landfriedens. Geleitsrecht. "Westfalen. Bayern. Lothringen. 466. Herzog Richter über Fürsten. Strafgewalt über Fürsten. 467. Vorrechte bei der Königswahl. 468. Huldigung beim Regierungsantritte. Wahl oder Aner- kennung des Herzogs durch das Land. Absonderliche Gebräuche in Kärnten. Übung herzoglicher Rechte in der Hauptstadt. 469. Ergebnisse. Recht, Hof zu gebieten. xxxin. 470. BayrischeTage. Agilolfinger. Karolinger. Tage der Sendboten. 471. Recht, Bischöfe zu belehnen. Einfluß der Kirchenverfassung auf die Landesverfassung. 472. Größte Ausdehnung entsprechend dem Reichssprengel. http://d-nb.info/365802352 VI Ältere Hoftage. "Wölfische Hoftage. 473. Wittelsbachische Hoftage. 474. Auf- hören seit Teilung des Landes. Spätere Zeugnisse für Einheit des Landes. 475. Hauptort Regensburg. Später Straubing. Nicht in Bischofsstädten. 476. Verbindung mit Kämten und Italien. -

Inhaltsübersichten Der Handschriften Coburg Landesbibliothek, Ms. Cas
Inhaltsübersichten der Handschriften Coburg Landesbibliothek, Ms. Cas. 9–11 und Weimar Thüringisches Hauptstaatsarchiv, EGA, Reg. O 21 Vorbemerkung: Die Ansetzung der Namen orientiert sich an den Europäischen Stammtafeln, Neue Folge, hrsg. von Detlev Schwennicke, Bd. I ff., Marburg; Frankfurt a. M. 1981 ff. (im Folgenden als ESt abgekürzt), denen auch Lebensdaten und sonstige erklärende Angaben entnommen wurden. Die Namensansetzungen der angelsächsischen Fürsten in Reg. O 21 folgen dem deutschen Text der Ausgabe Beda der Ehrwürdige: Kirchengeschichte des englischen Volkes. Übers. von G. Spitzbart. 2. Aufl. Darmstadt 1997. Für die Historia ecclesiastica gentis Anglorum des Beda Venerabilis wird die Abkürzung Beda, Hist. eccl. verwendet, für die Historia regum Britanniae des Galfridus Monemu- tensis die Abkürzung Galfr. Mon., Hist. Coburg Landesbibliothek, Ms. Cas. 9 Chronik der Sachsen: Widukind und seine Nachfahren bis ins 14. Jh. Widukind (ESt XIX, 2000, Taf. 1A) 2r–4v leer 5r–40 v Widukind. Bei Spalatin Sohn Wernikes (Reg. O 21, 141 rv ) und Bruder Bruns (Reg. O 21, 142 r-143 r) 41 r–64 v leer 65 r–67 v Widukind (Fortsetzung) Widukinds heidnischer Sohn Widukind II. und seine Nachfahren 68 r–71 v Widukind II. Bei Spalatin Widukinds heidnischer Sohn. In ESt nicht nachgewie- sen. 72 rv Friedrich von Bautzen. Bei Spalatin Sohn Widukinds II. und Bruder Titgreins. In ESt nicht nachgewiesen . 73 r leer 73 v–74 v Titgrein von Bautzen. Bei Spalatin Sohn Widukinds II. und Bruder Friedrichs von Bautzen. In ESt nicht nachgewiesen . 75 rv Tetmar von Bautzen. Bei Spalatin Sohn Titgreins. In ESt nicht nachgewiesen. 76 r leer Widukinds christlicher Sohn Wiprecht und seine Enkel als Stammväter sächsischer Geschlech- ter (Immedinger, Aledramiden, Wettiner) 76 v–78 r Wiprecht. -

Jeroen De Waal
een genealogieonline publicatie Jeroen de waal door J, de Waal 5 augustus 2021 Jeroen de waal J, de Waal Jeroen de waal Generatie 1 1. Marinus VERWEIJ, zoon van Adriaan VERWEIJ (volg 2) en Tannetje Zweedijk (volg 3), is geboren op 29 December 1853 in Rilland, Zeeland, Netherlands. Hij is boerenknecht van beroep. Marinus is overleden op 40 jarige leeftijd op 21 augustus 1894 in Heerewaarden,Gelderland,Netherlands. Generatie 2 2. Adriaan VERWEIJ, zoon van Cornelis Verweij (volg 4) en Maria Kloosterman (volg 5), is geboren op 18 september 1821 in Wolphaartsdijk, Zeeland, Netherlands. Hij is arbeider van beroep. Adriaan is overleden op 36 jarige leeftijd op 18 December 1857 in ’s-Heer Arendskerke, Zeeland, Netherlands. 3. Tannetje Zweedijk, dochter van Marinus Zweedijk (volg 6) en Jannetje van De Peerel (parel) (volg 7), is geboren op 10 mei 1825 in ’s-Heer Hendrikskinderen, Zeeland, Netherlands. Zij is zonder van beroep. Tannetje is overleden op 76 jarige leeftijd op 6 juli 1901 in ’s-Heer Arendskerke, Zeeland, Netherlands. Generatie 3 4. Cornelis Verweij, zoon van Brandijn Cornelisz Verweij (volg 8) en Jacomina Cornelisdr Mulder (volg 9), is geboren op 23 oktober 1782 in Bommel, Gelderland, Netherlands. Hij is arbeider van beroep. Cornelis is overleden op 69 jarige leeftijd op 22 augustus 1852 in ’s-Heer Hendrikskinderen. 5. Maria Kloosterman, dochter van Marinus (Marinis) Kloosterman (volg 10) en Adriana Deumisse Tramper (volg 11), is geboren op 29 november 1793 in Wolphaartsdijk, Zeeland, Netherlands. Zij is arbeidster van beroep. Maria is overleden op 33 jarige leeftijd op 25 juli 1827 in Wolphaartsdijk, Zeeland, Netherlands. -
Naturerleben an Der Str Der Romanik MSH 2018 WEB.Pdf
Ich hôrt ûf der heide Lûte stimme und süezen klanc. dá von wart ich beide fröiden rîch und trûrens kranc. Nâch der mîn gedanc sére ranc unde swanc, die vant ich ze tanze dâ si sanc. Âne leide ich dô spranc. HEINRICH VON MORUNGEN († 1222) Im Jahr 2018 verbindet die Tourismusroute „Straße der Romanik“ bereits seit 25 Jahren geschichtsträch- tige Orte in Sachsen- Anhalt. Bundespräsident RICHARD VON WEIZSÄCKER eröffnete sie am 7. Mai 1993 in Magdeburg. Es war der 1020. Todestag von Kaiser OTTO I., der 968 das Erzbistum Magdeburg gegründet hatte. Magde- burg ist heute Schnitt- punkt der Nord- und der Südroute der „Straße der Romanik“. Mit dem Kloster in Klostermans- feld, der Burg in Allstedt, der Pfarrkirche St. Ulrici Sangerhausen, dem Kloster Helfta, dem Marienportal der Kirche Seeburg sowie der Königspfalz Tilleda befinden sich im Gebiet des Landkreises Mansfeld-Südharz sechs Stationen der Südroute. Andere bedeutende Orte aus der Zeit der Romanik blieben jedoch unberücksichtigt. Dazu zählen beispielsweise Wallhausen, Geburtsort von OTTO I. und die Ruine Alt-Morungen, dem wahr- scheinlichen Geburtsort des Minnesängers HEINRICH VON MORUNGEN. Auch auf solche Orte möchte der Regionalverband Harz als Träger des UNESCO Global Geoparks Harz . Braunschweiger Land . Ostfalen und des Naturparks Harz aufmerksam machen. Weitere Faltblätter aus der Reihe „Naturerleben und Romanik“ können unter http://www.harzregion.de/de/natur-erleben.html gelesen oder heruntergeladen werden. Ich hôrt ûf der heide Lûte stimme und süezen klanc. dá von wart ich beide fröiden rîch und trûrens kranc. Nâch der mîn gedanc sére ranc unde swanc, die vant ich ze tanze dâ si sanc. -

Die Einteilung Des Landes Zwischen Unterer Saale Und Mulde in Gaue Und Archidiakonate
H. GRÖSSLER: DIE EINTEILUNG- DES LANDES ZWISCHEN UNTERER SAALE UND MULDE USW. 17 Die Einteilung des Landes zwischen unterer Saale und Mulde in Gaue und Archidiakonate. (Mit einer Karte.) Von Prof. Dr. Hermann Größler in Eisleben. A. Die Einteil:ung in Gaue. Die Abgrenzung der bischöflicl~en Sprengel und ihrer Unterbezirke, der Archidiakonate, in dem Lande zwischen unterer Saale und _Mulde ist nicht etwa als eine Sache der Willkür seitens ihrer Urheber an zusehen, sondern hat sich, namentlich auf ehemals slawischem Boden, ursprünglich genau an die Abgrenzung der Gaue und Grafschaften, bezw. der Burgwartbezirke angeschlossen, _der Art, daß erstens jeder bischöf• liche Sprengel aus einer Anzahl schon früher abgegrenzter Landschaften oder Gaue zusammengesetzt wurde, welche einzeln oder zu mehreren einen geistlichen Unterbezirk ausmachten, dem ein Archidiakonus des Bischofs vorstand, und der darum als Archidiakonat oder Bann be zeichnet wurde, und zweitens, daß jedem Gaugrafen ein .A.rchidiakonus als geistlicher Gerichtsherr beigegeben war, der nicht selten an der weltlichen Dingstätte des Grafen auch sein geistliches Gericht abhielt. Das erhellt aus verschiedenen Kapitularien des achten Jahrhunderts, auf welche zuerst Böttger 1 hingewiesen hat. Ein Oapitulare Karlmanns von 742 bestimmt: „Decrevimus, ut secundum canones unusquisque episcopus in sua parochia sollicitudinem exhibeat adiuvante gra vione, qui defensor ecclesie est, ut populus dei paganias non faciat." Und ein Oapitulare Karls d. Gr. von 802 verordnet: „Volumus, ut epi scopi et comites concordiam et dilectionem inter se habeant, - ut episcopus suo comiti, ubi ei necessitas poposcerit, adjutor et exortator existat, qualiter suum ministerium explere possit. Similiter et comes faciat contra suum episcopum, ut in omnibus ei ad jutor sit, qualiter infra (d. -

Von Den Teufelsmauern Bei Blankenburg Und Bei Thale Am Harz
Von den Teufelsmauern bei Blankenburg und bei Thale am Harz. Von R. Stei°nhoff, · Oberlehrei' in Blankenburg a. H. Die Kette von rnauerartig aufsteigenden festen, oft plattenförmig abgesonderten Quadersandsteinfelsen, welche zuerst bei Neinstedt und Weddersleben an der Bode unterhalb von 'l'hale und dann zwischen Timmenrode und Blankenburg· auftritt, gegen ihr Nordwestende bei Blankenburg eine Höhe von 290 m erreicht, de1p Senon der Kreidefor mation angehört und deshalb so prallig· hervortritt, weil die ihr 'ursprünglich zugeordneten Schichten weichem Gesteins w'eggewaschen sind,1 hat sicher von jeher die Augen der Harzbesucher , auf sich gezogen. Der Sachsen Merseburg'sche Kammerrat v. Rohr, der 1734 den Harz bereiste, um dort für seinen Fürsten eine Zufluchtsstätte während des „Französischen an.,. drohenden Krigs'.'Ungewitters" zu suchen, beschreibt zuerst unsern Gebirgs zug ausführlich; er meint: 2 „Diese Felsen-Mauern sind allerdings vor ein besonder Wunderwerck der Natur zu achten, und habe ich dergleichen sonst nirgends in einer andern Provinz wahrgenommen.3 Es geben selbige nach dem Unterschiede von 30 oder 40 Schritten, wenn man an ihnen I Guthe-Renner, Braunschweig u. Hannover S. 320, wo die Gegensteine bei Ballenstedt nicht .- was man gewöhnlich thut - dazu gerechnet werden. ' ll Merckwürdigkeiten des Unter-flartzes2 1748, S.36: vgl.Zückert, Natur gesch. einiger Provinzen des Unterharzes 1763, S. 105. Harz-Album 2 S. 128. 3 Der Feldprediger Wagner in Rathenau (vgl Müller, Streifereien in den Harz I, S. 181 und darüber He y s e, Beiträge zur Kenntniss des Harzes 2 S 24, 2), Reise durch den Harz und die Hessischen Lande 1197, S. 08, will ein ähnliches und nicht minder täuschendes Mauerwerk der Natur in der Nähe des Zackenfalls ohn weit Schreibersaue im Riesengebirge gesehen haben; Wadzeck, Reise von Berlin nach dem Harze 1824, S. -

Stammeskundliche Untersuchungen Des Goslarer Gelehrten Johann Michael HEINECCIUS Vor 300 Jahren 7-45 Dortmunder Beitr
ZOBODAT - www.zobodat.at Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database Digitale Literatur/Digital Literature Zeitschrift/Journal: Dortmunder Beiträge zur Landeskunde Jahr/Year: 1999 Band/Volume: 33 Autor(en)/Author(s): Laub Gerhard Artikel/Article: Stammeskundliche Untersuchungen des Goslarer Gelehrten Johann Michael HEINECCIUS vor 300 Jahren 7-45 Dortmunder Beitr. Landeskde. naturwiss. Mitt. 33 7-46 Dortmund, 1999 Stammeskundliche Untersuchungen des Goslarer Gelehrten Johann Michael HEINECCIUS vor 300 Jahren Gerhard LAUB, Goslar Zusammenfassung Vor 300 Jahren hat der Goslarer Diakon Johann Michael HEINECCIUS eine gehaltvolle Ab handlung über den wahrscheinlichen Ursprung der Bewohner des Gebietes um Goslar von vorgeschichtlicher bis in die karolingische Zeit verfasst. Mangels archäologischer Entdeckun gen musste der Autor sich auf einschlägige Berichte oder sonstige Nachrichten antiker, mit telalterlicher und zeitgenössischer Schriftsteller stützen. Mit Hilfe von sehr gründlichen Unter suchungen gelang es ihm herauszufinden, dass seit wenigstens CAESAR’s Zeiten Goslars Umgebung zum Cheruskerland gehört hat, das jedoch wenige Jahrhunderte später Sachsen eingenommen haben, nachdem sie ihre ursprüngliche Heimat zwischen Elbe und Schlei ver lassen hatten. HEINECCIUS’ lateinischer Text wird hier in deutscher Übersetzung wiedergegeben, der zweck dienliche Anmerkungen und Erläuterungen angehängt sind. Abstract 300 years ago, the Goslarian deacon Johann Michael HEINECCIUS wrote a substantial trea tise on the probable origin -

1. Kapitel Ältesten Politischen Und Kirchlichen Zustände Unserer Gegend (Bis Etwa 1500 U
1. Kapitel Ältesten politischen und kirchlichen Zustände unserer Gegend (bis etwa 1500 u. Ztr.) Politische Zustände: Zu Beginn unserer Zeitrechnung lag unser Mansfelder Land inmitten des großen germanischen Reiches der Hermunduren. Dann flutete die Völkerwanderung darüber hinweg. Und als diese verebbt war, war das große Reich der Thüringer (Toringer oder Duringe) entstanden, das sich von der oberen Donau bis zur unteren Elbe bei Havelberg erstreckte. Am Rhein hatte sich auf dem Boden altrömischer Kultur ebenfalls ein neues Reich, das Reich der Franken, gebildet, das namentlich durch das Christentum eine gewaltige Stoßkraft erhielt und nach und nach alle Nachbarvölker unterjochte. Bei seinem weiteren Vordringen nach Osten kam es zwischen den Franken und den Thüringern zu erbitterten Kämpfen. Aus dem entscheidenden Endkampf bei Burgscheidungen im Jahre 531 gingen die Franken und die mit ihnen Verbündeten Sachsen als Sieger hervor. Das ganze nördlich der Unstrut gelegene Gebiet des überwundenen Reiches, also ganz Nordthüringen zwischen Elbe, Saale, Unstrut, Helm, Harz und Ocker (einschließlich der jetzigen Altmark), dessen Kernge- biet im Mansfeldischen bei Bösenburg lag, fiel den Sachsen als Siegespreis für ihre den Fran- ken geleistete Kriegshilfe zu. Die Sachsen mussten aber einen Jahreszins von 500 Kühen an die Franken entrichten. 37 Jahre später (568) verließ ein starker Heerhaufe der Sachsen die gewonnenen Wohnsitze wieder, um sich dem großen Heereszug des Langobardenkönigs Alboin anzu- schließen. Aber schon 577 kehrten sie zurück und nahmen das von ihnen verlassene Gebiet wieder in Anspruch. Da es inzwischen jedoch von den Franken durch neue Ansiedler, hauptsächlich Schwaben und Friesen, besetzt worden war, setzten ihnen diese bei ihrer Ankunft heftigen Wiederstand entgegen.