Deutschland – Österreich – Schweiz
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

84 003 Dfie Broschuere Patro
2021 1 VORWORT Geschätzte Leserinnen und Leser, liebe Freunde der Patrouille Suisse Anfang 2020 überraschte das neue Coronavirus die Welt und entwickelte sich zu einer globalen Pandemie. Wir alle mussten unser persönliches Verhalten anpassen und unsere Aktivitäten wie auch das gesellschaftliche Leben massiv einschränken. Nun stehen wir aufgrund der verschiede- nen Mutationen des Virus vor einer 3. Welle und wissen nicht, wie der Frühling wird – bis dann endlich dank einem ausreichenden Impfschutz die weitere Verbreitung des Virus eingedämmt wer- den kann. Wir starten daher mit grosser Unsicherheit in die Vorführsaison 2021. Im letzten Herbst konnten wir das Referendum über die Beschaffung eines neuen Kampfflugzeuges nur äusserst knapp für uns entscheiden. Damit ist jedoch ein wesentlicher Schritt zur Erneuerung der Mittel der Luftwaffe getan. Ich danke der Schweizer Bevölkerung für diese wichtige Unterstützung! Vor den Sommerferien dürfen wir den Typenentscheid durch den Bundesrat erwarten. Wir sind alle sehr gespannt! Noch fliegt aber der über 40-jährige F-5 Tiger in rot-weisser Bemalung, sinnbildlich für die Schweiz und deren Werte. Ich hoffe, dass die Piloten der Patrouille Suisse diesen Sommer wieder viele Zuschauerinnen und Zuschauer mit ihrem Können an Anlässen und Airshows im In- und Ausland begeistern dürfen. Dem Leader, Hauptmann Michael Duft alias «Püpi», und seinen Bambini, unter der Führung des Kommandanten Oberstleutnant Nils «Jamie» Hämmerli, wünsche ich an dieser Stelle bereits jetzt viel Erfolg! Ihnen, geschätzte Leserinnen und Leser, wünsche ich gute Gesundheit und viel Freude an den traumhaften und unvergesslichen Flugvorführungen der Patrouille Suisse! Divisionär Bernhard Müller Kommandant Schweizer Luftwaffe AVANT-PROPOS Chères lectrices, chers lecteurs, chères amies et chers amis de la Patrouille Suisse, Début 2020, le nouveau coronavirus déclenchait une pandémie qui allait prendre le monde au dépourvu. -
Armaments Strategy
Swiss Federal Department of Defence, Civil Protection and Sport DDPS [Enter here] ARMAMENTS STRATEGY dated January 1, 2020 CONTENTS 1 INTRODUCTION 3 2 STRATEGIC GOALS AND AREAS OF ACTIVITY 4 2.1 PRINCIPLES OF PROCUREMENT 4 2.2 COOPERATION WITH THE PRIVATE SECTOR 5 2.3 SECURITY-RELEVANT TECHNOLOGY AND INDUSTRIAL BASE (STIB) 6 2.3.1 DOMESTIC PROCUREMENTS 7 2.3.2 APPLICATION-ORIENTED RESERACH / INNOVATION SUPPORT 8 2.3.3 INFORMATION EXCHANGE WITH INDUSTRY 9 2.3.4 EXPORT CONTROL POLICY 10 2.4 INTERNATIONAL COOPERATIONS 10 2.5 OFFSET 11 2.6 COMMUNICATION 12 3 STRATEGIC GOALS OF THE FEDERAL COUNCIL FOR RUAG MRO SWITZERLAND 12 4 FINAL PROVISIONS 12 Armaments Strategy Page 2/13 1 INTRODUCTION The armaments strategy is based on the Federal Council's principles for the armaments policy of the DDPS of October 24, 2018. The armaments policy is an element of Switzerland’s security policy. The armaments policy focuses both on the needs of the Armed Forces and other state security institutions according to critical expertise, security-relevant core technologies, technologically complex systems as well as goods, buildings and services and on the guarantee of industrial key capabilities and capacities for ensuring reliable operation and the deployment and sustainability of established army systems. The armaments policy ensures that the Armed Forces and other federal state security institutions will be supplied in good time, and in accordance with economic principles and in a transparent manner, with the necessary equipment and armaments as well as the required services. Among other things, this requires the availability of defined core technologies and the maintenance of corresponding industrial capacities in Switzerland.1 The armaments strategy defines how the Federal Council’s principles for the DDPS’ armaments policy will be implemented and the needs and requirements of the Armed Forces and other federal state security institutions will be met. -

Annual Report 2018 Eidgenössische Finanzkontrolle Contrôle Fédéral Des Finances Controllo Federale Delle Finanze Swiss Federal Audit Office
EIDGENÖSSISCHE FINANZKONTROLLE CONTRÔLE FÉDÉRAL DES FINANCES CONTROLLO FEDERALE DELLE FINANZE SWISS FEDERAL AUDIT OFFICE 2018 ANNUAL REPORT BERN | MAY 2019 SWISS FEDERAL AUDIT OFFICE Monbijoustrasse 45 3003 Bern – Switzerland T. +41 58 463 11 11 F. +41 58 453 11 00 [email protected] twitter @EFK_CDF_SFAO WWW.SFAO.ADMIN.CH DIRECTOR’S FOREWORD FROM WHISTLEBLOWING TO PARTICIPATORY AUDITING In 2008, federal employees were not form www.whistleblowing.admin.ch. It is legally required to report the felonies now the IT system that ensures the an- they encountered to the courts. The onymous processing of reports. These experts of GRECO, a Council of Europe reports come from federal employees, anti-corruption body, pointed out this but also from third parties who have wit- shortcoming at that time in their evalu- nessed irregularities. ation report on Switzerland. For the SFAO, processing this infor- To remedy this shortcoming, the Federal mation is not simple. It is necessary to Office of Justice, in close cooperation sift through the information and critic- with the Federal Office of Personnel and ally verify onsite whether it is plausible. the Swiss Federal Audit Office (SFAO), Some reports may actually be intended introduced on 1 January 2011 the new to harm someone. It is then necessary Article 22a of the Federal Personnel to identify the appropriate time to initiate Act and the obligation to report felonies possible criminal proceedings and avoid and misdemeanours prosecuted ex of- obstructing them by alerting the perpe- ficio. This is when whistleblowing was trators of an offence. In any case, noth- launched at the federal administrative ing that could put the whistleblower in level. -

High Temporal Resolution Radar Observations of Various Scatterers in the Atmosphere at 10 Ghz: Experiences in Mediterranean Semi-Arid Regions and in the Western Alps
HIGH TEMPORAL RESOLUTION RADAR OBSERVATIONS OF VARIOUS SCATTERERS IN THE ATMOSPHERE AT 10 GHZ: EXPERIENCES IN MEDITERRANEAN SEMI-ARID REGIONS AND IN THE WESTERN ALPS M. Gabella1, E. Morin2, A. Leuenberger1, R. Notarpietro3,4, M. Branca4, J. Figueras1, M. Schneebeli1, U. Germann1 1Radar Satellite and Nowcasting, MeteoSwiss, via ai Monti 146, CH-6605 Locarno Monti, Switzerland. 2Department of Geography, The Hebrew University of Jerusalem, Jerusalem, Israel. 3Electronics Department, Politecnico di Torino, Torino, Italy. Corresponding author: Marco Gabella, Phone +41-91-7562319, [email protected] Session: Developments in observing technologies. Abstract Radar is a unique tool to get real time overview on the current weather situation; however, high spatial resolution observations can only be achieved at short ranges, the angular resolution being an important limiting factor. How to tackle the emerging needs for high spatio-temporal resolution? Short-range, fast- scanning, X-band, mini radars can be a solution, especially for monitoring in details small basins prone to flash flood, towns and valleys. Cost, radiation and installation issues motivate the use of small antennas that can easily be installed on existing infrastructures or even on a truck. The paper presents lessons gained in various climates and with different X-band systems: low-cost, portable, single elevation, 10 kW systems delivering one precipitation map per minute as well as a sophisticated, fast 3D scanning, 75 kW Doppler, polarimetric radar on wheel aiming at the detection of both distributed (precipitation particles) and isolated scatterers (airplanes). The areas under surveillance include complex orography regions in the “wet” Western Alps and in the Be'er Sheva semi-arid region (Israel). -

Flugplatz Nidwalden Variantendiskussion: Bericht Phase 2: Evaluation Bestvariante
Kanton Nidwalden, Korporationen Buochs, Stans, Ennetbürgen Flugplatz Nidwalden Variantendiskussion: Bericht Phase 2: Evaluation Bestvariante Zürich/Bern, 11. Januar 2016 Markus Maibach, Martin Peter, Remo Zandonella (INFRAS) Adrian Müller, Stefan Gerber, Nathalie Widmer (Bächtold&Moor) Bächtold & Moor INFRAS Ingenieure und Planer Forschung und Beratung Giacomettistrasse 15, CH-3000 Bern 31 Binzstr. 23 CH-8045 Zürich www.baechtoldmoor.ch www.infras.ch |2 Inhaltsverzeichnis Zusammenfassung und Bestvariante _______________________________________________ 4 1. Einleitung _____________________________________________________________ 10 1.1. Ausgangslage __________________________________________________________ 10 1.2. Ziel und Ergebnis Phase 2 ________________________________________________ 10 Teil I: Varianten_______________________________________________________________ 12 2. Grundlagen und Vorgehen _______________________________________________ 12 2.1. Räumliche Vorgaben ____________________________________________________ 13 2.1.1. Varianten Nord ________________________________________________________ 13 2.1.2. Varianten Süd__________________________________________________________ 14 2.1.3. Übersichtsplan Flugplatz Buochs ___________________________________________ 15 2.2. Umweltrelevante Schwerpunkte ___________________________________________ 16 2.2.1. Grundwasser- und Gewässerschutz _________________________________________ 16 2.2.2. Ökologie ______________________________________________________________ 18 2.2.3. Fruchtfolgeflächen -
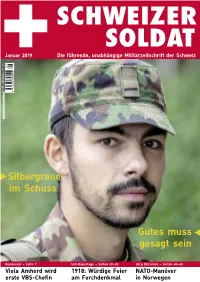
PDF Jan 2019.Pdf
Januar 2019 Die führende, unabhängige Militärzeitschrift der Schweiz 8.– r. |F gang Jahr 4. |9 eizer-soldat.ch www.schw ▲ Silbergraue im Schuss Gutes muss gesagt sein ▲ Bundesrat –Seite7 Uof-Reportage –Seiten 32–33 JürgKürsener –Seiten 40–45 Viola Amherdwird 1918: Würdige Feier NATO-Manöver ersteVBS-Chefin am Forchdenkmal in Norwegen RUAG ARANEA Communication Expert Wirgarantieren schnelle Kommunikation. www.ruag.com/defence 3 Januar 2019 |SCHWEIZER SOLDAT Inhalt SPRENGSATZ Der Berner Ex-Regierungsrat und Ex- KdtHQRgt 2Hans-JürgKäser veröf- fentlicht auf seiner HomepageZitate. Unser Kopf ist rund, damit das Denken die Richtung ändern kann. Picabia Wenn kühne Flieger in freiem Gelände landen: Franz Knuchels Bilder Seite31. Selbstkritik ist die besteKritik; Kritik durch andereist eine Notwendigkeit. Karl Popper Schweiz Ausland Leben ist das, wasdir passiert, während 7 Viola AmherdwirdersteVBS-Chefin 38 Krise um die Krim: du anderePläne schmiedest. 9 Flieger –Wie weiter? Kiewmit Kriegsrecht John Lennon 10 Der Armeechef im SBB-Werk 40 Wie die NATO reagiert: «TRIDENT JUNCTURE» Team-Arbeit setzt Team-Geist voraus, 11 LW AT Br: Erster Jahresrapport 46 Israel: Kochavi wird wassich nicht anordnen, wohl aber vor- 12 Schildbürgerstreich im Nationalrat: 22. Generalstabschef leben lässt. Kredit für Schutzwestengekürzt 48 In Slowenien führt erstmals Albert Ackermann 13 Rekruten setzten sich für Wm ein eine Frau eine NATO-Armee 14 Kommando Ausbildung: 49 George H.W.Bush – Nach Diskussionen zu Ergebnissen, Schwungvoller Rapport Pilot, Patriot, Präsident nach Ergebnissen zu Entscheidungen 16 Lehrverband FU und nach Entscheidungen zu Taten. bereit für die Zukunft Geschichte Helmut Schmidt 20 Studenten übel benachteiligt 21 Heli-Unfall 2016: Verfahren eingestellt 50 1918: Krieg verloren, der Kaiser stürzt Stehe an der Spitze um zu dienen, nicht um zu herrschen! 22 In einer Welt des Idealismus: 52 Wie angeworfen war die Grippe da fasziniert die Kameradschaft Bernhardvon Clairvaux 26 SWISSINT: VonF.Keller zu F. -
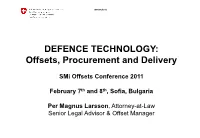
Strategic Goals of Swiss Offset Procurement
armasuisse DEFENCE TECHNOLOGY: Offsets, Procurement and Delivery SMi Offsets Conference 2011 February 7th and 8th, Sofia, Bulgaria Per Magnus Larsson, Attorney-at-Law Senior Legal Advisor & Offset Manager - Agenda • General Basis • Definition of Swiss Offset • Reference Frame for Swiss Offset • Strategic Goals of Swiss Offset • Security-Relevant Technology and Industry Base (STIB) • Conclusions armasuisse DEFENCE TECHNOLOGY: Offsets, Procurement, Delivery 2 Aktenzeichen: Per Magnus Larsson MS 35618/01 - General Basis Offset Organization within armasuisse armasuisse is a group within the Federal Department of Defence, Civil Protection and Sport (DDPS) of the Swiss federal Administration and as such reporting directly to the Head of Department (Minister of the MoD): • armasuisse • Federal Office of Topography – swisstopo • Federal Office of Defence Procurement • Central Services • Legal Affairs, Transport and Customs • Legal Affairs and Offsets • Offset Office Bern armasuisse DEFENCE TECHNOLOGY: Offsets, Procurement, Delivery 3 Aktenzeichen: Per Magnus Larsson MS 35618/01 - General Basis Competence in procurement and technology armasuisse is the federal competence center for: • Procurement of technologically complex systems and materials • Defence technology and quality assurance • Real Estate DDPS • Geographical reference data of Switzerland With its services, armasuisse aims at optimum customer satisfaction, both within the federal administration and externally. armasuisse provides its services on time, independently, efficiently and -
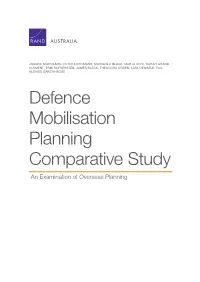
Defence Mobilisation Planning Comparative
AUSTRALIA JOANNE NICHOLSON, PETER DORTMANS, MARIGOLD BLACK, MARTA KEPE, SARAH GRAND CLEMENT, ERIK SILFVERSTEN, JAMES BLACK, THEODORA OGDEN, LIVIA DEWAELE, PAU ALONSO GARCIA-BODE Defence Mobilisation Planning Comparative Study An Examination of Overseas Planning The research described in this RAND Australia report was prepared for Australian Department of Defence and was conducted within RAND Australia under Contract SON2901652. About RAND Australia RAND Australia’s mission is to help improve policy and decisionmaking through research and analysis. RAND’s publications do not necessarily reflect the opinions of its research clients and sponsors. To learn more about RAND Australia, visit www.rand.org/australia Published by the RAND Corporation, Santa Monica, Calif. © 2021 RAND Australia R® is a registered trademark. For more information on this publication, visit www.rand.org/t/RRA1179-1 Preface The Vice Chief of Defence Force (VCDF) has established a small Directorate within Force Design Division in response to significant changes in Australia’s strategic outlook, to ensure a contemporary mobilisation planning framework across Defence. This mobilisation planning process will be conducted over two and a half years and will include several research activities. In June 2020, RAND Australia was engaged by the Australian Department of Defence to undertake a series of material studies and analysis activities. RAND Australia was asked to undertake a comparative study of mobilisation planning in selected countries to discern principles for mobilisation planning. For this a comprehensive international literature review was undertaken spanning the United States, Switzerland, Sweden, Finland, and Singapore. To present the results so that they could be readily compared against each other, a research framework was constructed comprising examination of four areas: Planning Model, Activation, Attributes and Principles, and Forecast Trends. -

Cybersecurity in Switzerland: Challenges and the Way Forward for the Swiss Armed Forces
Connections: The Quarterly Journal ISSN 1812-1098, e-ISSN 1812-2973 Marie Baezner, Connections QJ 19, no. 1 (2020): 63-72 https://doi.org/10.11610/Connections.19.1.06 Policy Article Cybersecurity in Switzerland: Challenges and the Way Forward for the Swiss Armed Forces Marie Baezner Center for Security Studies, ETH Zurich Abstract: The cybersecurity policy of Switzerland is focused on enhancing competencies and knowledge, investing in research and the resilience of critical infrastructures, threat monitoring, supporting innovation, promot- ing standards, and increasing awareness – all in the framework of public- private, inter-regional, and international cooperation. The armed forces support this policy by developing threat intelligence and attribution capa- bilities, readiness to undertake active measures in cyberspace, and to en- sure operational availability under any circumstances. Keywords: cyber risks, cybersecurity strategy, resilience, crisis manage- ment, law enforcement, cyber defence, cyber operations. Policy Highlights Like in any other European state, cybersecurity has grown in importance in Swiss politics. And although Switzerland’s cybersecurity and defense policies are still a work in progress, the nation has made tremendous efforts in getting cybersecu- rity policies, roles, and responsibilities right. Published in 2018, the “National Strategy for the Protection of Switzerland against Cyber Risks” 1 is the main policy document that guides Swiss ambitions and replaced the 2012 strategy.2 Overall, the strategy sets seven strategic goals 1 Swiss Federal Council, National Strategy for the Protection of Switzerland against Cyber Risks (NCS) 2018-2022 (Bern: Federal IT Steering Unit FITSU, April 2018), https://www.isb.admin.ch/dam/isb/en/dokumente/ikt-vorgaben/strategien/ncs/ Nationale_Strategie_Schutz_Schweiz_vor_Cyber-Risiken_NCS_2018-22_EN.pdf. -

URBANITY Megacity Energy Mobility Information Communication Force-Effect
Schweizerische Eidgenossenschaft Federal Department of Defence, Confédération suisse Civil Protection and Sport DDPS Confederazione Svizzera armasuisse Confederaziun svizra Science and Technology S+T THE DEFTECH PUBLICATION ABOUT FORESIGHT IN DEFENCE URBANITY Megacity Energy Mobility Information Communication Force-Effect Publication n° 001 of the decade January - 2020 Contributors Maison d’Ailleurs Swissnex San Francisco Centredoc IABG URBANITY Megacity | Energy | Mobility | Information | Communication | Force-Effect Details of the publication Contact Dr. Quentin Ladetto Research Director - Technology Foresight Tel. +41 58 468 28 09 [email protected] https://deftech.ch http://sicherheitsforschung.ch Publisher armasuisse, Science and Technology, Feuerwerkerstrasse 39, CH-3602 Thoune Editorial Research Management and Operations Research, tel. +41 58 468 29 11, www.armasuisse.ch/wt See contributors below Production Maison d’Ailleurs, Museum of science fiction, utopia and extraordinary journeys Translation Versions Originales Sàrl, Neuchâtel Reprinting Reprinting: exclusively by permission from the editorial department © armasuisse ISBN 978-3-9525175-0-5 Contributors Maison d’Ailleurs (House of Elsewhere), which was founded in 1976 in Yverdon-les-Bains (Switzerland), is the only museum of its kind in Europe. The museum has more than 130’000 objects related to Science Fiction, Utopia and Pop Culture in its collections. The museum is therefore one of the most important research centres in the field. Every year Maison d’Ailleurs holds several exhibitions, presenting important artists and exploring the main sci-fi themes such as flying cars, futuristic urbanism, video games or superheroes… Marc Atallah - Frederic Jaccaud - Danilo Pierotti swissnex San Francisco is part of the swissnex global network connecting the dots in education, research, and innovation. -

Eidgenössischer Staatskalender Annuaire Fédéral Annuario Federale
Schweizerische Eidgenossenschaft Confédération suisse Confederazione Svizzera Confederaziun svizra Eidgenössischer Staatskalender Annuaire fédéral Annuario federale Register Stand 4. März 2013 Etat au 4 mars 2013 Stato 4 marzo 2013 Herausgegeben von der Schweizerischen Bundeskanzlei Publié par la Chancellerie fédérale Pubblicato dalla Cancelleria federale °c Bundeskanzlei °c Chancellerie fédérale °c Cancelleria federale BBL, Verkauf Bundespublikationen, CH-3003 Bern OFCL, Vente Publications fédérales, CH-3003 Berne UFCL, Vendita Pubblicazioni federali, CH-3003 Berna www.bbl.admin.ch/bundespublikationen Art.-Nr. 104.055 I. Teil Ire partie I parte Organigramm der Bundesverwaltung Verzeichnis der Organisationseinheiten und Abkürzungsverzeichnis Feiertage, Telex- und Telefaxnummern Organigramme de l’administration fédérale Index des unités organisationnelles et abréviations 5 Jours fériés, numéros télex et téléfax Organigramma dell’Amministrazione federale Elenco delle unità organizzative e abbreviazioni Giorni festivi, numeri telex e telefax II. Teil IIe partie II parte Bundesversammlung, Bundesrat, Eidgenössische Gerichte Bundesanwaltschaft, Aufsichtsbehörde über die Bundesanwaltschaft Assemblée fédérale, Conseil fédéral, Tribunaux fédéraux Ministère public de la Confédération, Autorité de surveillance 37 du Ministère public de la Confédération Assemblea federale, Consiglio federale, Tribunali della Confederazione Ministero pubblico della Confederazione, Autorità di vigilanza sul Ministero pubblico della Confederazione III. Teil IIIe partie -

IMPORTANT NOTICE: You Must Read the Following Before Continuing
IMPORTANT NOTICE: You must read the following before continuing. THE OFFERING DOCUMENT ATTACHED TO THIS DISCLAIMER IS AVAILABLE ONLY TO INVESTORS WHO ARE LOCATED OUTSIDE THE UNITED STATES AND EITHER (A) “QUALIFIED INVESTORS” (AS DEFINED IN THE PROSPECTUS DIRECTIVE, INCLUDING THE 2010 PD AMENDING DIRECTIVE) (“QUALIFIED INVEST - ORS”) IN THE EUROPEAN ECONOMIC AREA (THE “EEA”) OR (B) OUTSIDE THE EEA, IN EACH CASE IN RELIANCE ON REGULATION S UNDER THE U.S. SECURITIES ACT OF 1933, AS AMENDED (THE “SECURITIES ACT”), AND AS OTHERWISE PERMITTED UNDER APPLICABLE SECURITIES LAWS. IMPORTANT: You must read the following before continuing. The following disclaimer applies to the attached offering document (the “Offering Document”), which has been accessed via internet or otherwise received and you are therefore advised to read this disclaimer carefully before reading, accessing or making any other use of the Offering Document. In accessing the Offering Document, you agree to be bound by the following terms and condi- tions, including any modifications to them from time to time, any time you receive any information, as the case may be, as a result of such access. Capitalized terms used but not defined in this notice have the meanings assigned to such terms in the Offering Document. NOTHING IN THIS ELECTRONIC TRANSMISSION CONSTITUTES AN OFFER OF SECURITIES FOR SALE IN ANY JURISDICTION WHERE IT IS UNLAWFUL TO DO SO. NO ACTION HAS BEEN OR WILL BE TAKEN THAT WOULD, OR IS INTENDED TO, PERMIT A PUBLIC OFFERING OF THE SECURITIES DESCRIBED IN THE OFFERING DOCUMENT IN ANY JURISDICTION OTHER THAN SWITZERLAND. IN PARTICULAR, THE OFFERING HAS NOT BEEN AND WILL NOT BE REGISTERED WITH THE U.S.