'Die Lopades Von Spina
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

Rassegna Bibliografica
RASSEGNA BIBLIOGRAFICA a cura di Alessandro Naso con la collaborazione di Maria Pia Marchese Bastianini 1992-1993 Sezione I OPERE DI SINTESI, REPERTORI, ATTI DI CONVEGNI 1. Atlante archeologico dei mari d’Italia-, voli. I (Liguria, Toscana, Lazio); II {Sardegna, Campania, Basilicata, Calabria); III (Sicilia, Puglia, regioni adriatìche), 1993. 2. Bibliografia topografica della colonizzazione greca in italia, voi. XII (Monte Sant’Angelo-Orsomarso), Pisa-Roma 1993. 3. Bilancio critico su Roma arcaica fra monarchia e leggenda (Atti dei Conve gni Lincei, 100), Roma 1993. 4. Cupra Marittima e il suo territorio in età antica (Suppi, a Picus 3). Atti del Convegno, Tivoli 1993. 5. Giornate intemazionali di studi sull’area elima, I-II, Pisa-Gibellina, 1992. 6. I Messapi. Atti del trentesimo Convegno di studi sulla Magna Grecia, Ta ranto 1993. 7. La civiltà di Chiusi e del suo territorio. Atti del XVII Convegno di Studi Etruschi ed Italici, Firenze 1993. 8. La Sardegna nel Mediterraneo tra il Bronzo medio e il Bronzo recente (XVI- XIII sec. a.C.). Atti del Convegno, Cagliari 1992. 9. La viabilità tra Bologna e Firenze nel tempo. Problemi generali e nuove ac quisizioni. Atti del Convegno, Bologna 1992. 440 Rassegna bibliografica - Sezione I 10. Les archéologues et l'archéologie. Colloque du Bourg-en-Bresse (Caesaro- dunum 27), Tours 1993. 11. Les bois sacrés. Actes du Colloque International du Centre Jean Bérard (Collection du Centre Jean Bérard, 10), Naples 1993. 12. Lo stretto crocevia di culture. Atti del ventiseiesimo Convegno di studi sulla Magna Grecia, Taranto 1993. 13. Safinim. I Sanniti: vicende, ricerche, contributi. Atti del Convegno di stu di, Isernia 1993. -

Etruscan Civilization: a Cultural History Free Download
ETRUSCAN CIVILIZATION: A CULTURAL HISTORY FREE DOWNLOAD Sybille Haynes | 432 pages | 01 Sep 2005 | J. Paul Getty Trust Publications | 9780892366002 | English | United States Etruscan history Temporarily Out of Stock Online Please check back later for updated availability. All skulls were found to be male; their age ranged from 20 to 60 years, with an average age of about thirty. Etruscan life and afterlife. Duckworth Archaeological Histories Series. Post-Roman Kingdoms Odoacer's. Similarly, the 1st-century BC historian Livyin his Ab Urbe Condita Librisaid that the Rhaetians were Etruscans who had been driven into the mountains by the invading Gauls; and he asserted that the inhabitants of Raetia were of Etruscan origin. BC Magna Graecia 8th—3rd c. In the LacusCurtius transcription, the references in Dennis's footnotes link to the texts in English or Latin; the reader may also find the English of some of them on WikiSource or other Internet sites. For a better shopping experience, please upgrade now. By topic. In turn, ancient Roman architecture began with Etruscan styles, and then accepted still further Greek influence. Gli Etruschi in Italian. Roman and Italian names are given, but they are not necessarily etymologically related. Due to the similarities of the Etruscan skulls with some Celtic skulls from South Bavaria and Austria, it seems more likely that the Etruscans were original inhabitants of Etruria than immigrants. An example of the fasces are the remains of bronze rods and the axe from a tomb Etruscan Civilization: A Cultural History Etruscan Vetulonia. Main article: Etruscan society: Rise of the family. Three layers of deities are evident in the Etruscan Civilization: A Cultural History Etruscan art motifs. -
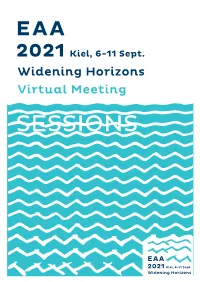
EAA2021 Sessions 14 July-1.Pdf
ORGANISERS 27th EAA Annual Meeting (Kiel Virtual, 2021) - Sessions Names, titles and affiliations are reproduced as submitted by the session organisers and/or authors. Language and wording were not revised. Technical editing: Kateřina Kleinová (EAA) Design and layout: Kateřina Kleinová (EAA) Design cover page: Janine Cordts (Institut für Ur- und Frühgeschichte Universität Kiel) European Association of Archaeologists Prague, June 2021 © European Association of Archaeologists, 2021 Tuesday 7 September 2021 #EAA2021 5 UNDERSTANDING PREHISTORIC DEMOGRAPHY Time: 9:00 - 16:30 CEST, 7 September 2021 Theme: 5. Assembling archaeological theory and the archaeological sciences Format: Regular session Organisers: Armit, Ian (University of York) - Damm, Charlotte (University of Tromso) - Črešnar, Matija (University of Ljubljana) ABSTRACTS 9:00 INTRODUCTION 9:15 THE COLOGNE PROTOCOL: ESTIMATING PAST POPULATION DENSITIES Schmidt, Isabell (University of Cologne) - Hilpert, Johanna (Kiel University - CAU) - Kretschmer, Inga (Landesamt für Denkmalpflege Stuttgart) - Peters, Robin (Landschaftsverband Rheinland) - Broich, Manue - Schiesberg, Sara - Vo- gels, Oliver - Wendt, Karl Peter - Zimmermann, Andreas - Maier, Andreas (University of Cologne) 9:30 DWELLINGS, SETTLEMENT ORGANISATION AND POPULATION FLUCTUATIONS: A MULTI-SCALAR CASE STUDY FROM ARCTIC NORWAY Damm, Charlotte (Arctic University of Norway) 9:45 EXPLORING LOCAL GEOGRAPHICAL CONDITIONS UNDERPINNING REGIONAL DEMOGRAPHIC CHANGE AMONG HUNTER-FISHER-GATHERERS IN SOUTHWEST COASTAL NORWAY (11,500-4300 CAL BP) Lundström, Victor - Bergsvik, Knut (University Museum, University of Bergen) 10:00 TERRITORIES, STRATEGIES AND TWO GENERATIONS Odgaard, Ulla (Independent researcher) 10:15 POPULATION DYNAMICS AND THE EXPANSION OF AGRICULTURE. ASSESSING THE RADIOCARBON GAPS DURING THE NEOLITHIZATION PROCESS IN THE WESTERN MEDITERRANEAN Cortell-Nicolau, Alfredo (Departament de Prehistòria, Arqueologia i Història Antiga. Universitat de València) - Crema, Enrico (Department of Archaeology. -

Edinburgh Research Explorer
Edinburgh Research Explorer Wars of Position Citation for published version: Puzey, G 2011, 'Wars of Position: Language Policy, Counter-Hegemonies and Cultural Cleavages in Italy and Norway', Ph.D., University of Edinburgh. <https://www.era.lib.ed.ac.uk/handle/1842/7544> Link: Link to publication record in Edinburgh Research Explorer Document Version: Publisher's PDF, also known as Version of record Publisher Rights Statement: © Puzey, G. (2011). Wars of Position: Language Policy, Counter-Hegemonies and Cultural Cleavages in Italy and Norway General rights Copyright for the publications made accessible via the Edinburgh Research Explorer is retained by the author(s) and / or other copyright owners and it is a condition of accessing these publications that users recognise and abide by the legal requirements associated with these rights. Take down policy The University of Edinburgh has made every reasonable effort to ensure that Edinburgh Research Explorer content complies with UK legislation. If you believe that the public display of this file breaches copyright please contact [email protected] providing details, and we will remove access to the work immediately and investigate your claim. Download date: 10. Oct. 2021 This thesis has been submitted in fulfilment of the requirements for a postgraduate degree (e.g. PhD, MPhil, DClinPsychol) at the University of Edinburgh. Please note the following terms and conditions of use: • This work is protected by copyright and other intellectual property rights, which are retained by the thesis author, unless otherwise stated. • A copy can be downloaded for personal non-commercial research or study, without prior permission or charge. -

Minorities Formation in Italy
Minorities Formation in Italy GIOVANNA CAMPANI Minorities Formation in Italy Introduction For historical reasons Italy has always been characterized as a linguistically and culturally fragmented society. Italy became a unifi ed nation-state in 1860 after having been divided, for centuries, into small regional states and having been dominated, in successive times, by different European countries (France, Spain, and Austria). As a result, two phenomena have marked and still mark the country: - the existence of important regional and local differences (from the cultural, but also economic and political point of view); the main difference is represented by the North-South divide (the question of the Mezzogiorno) that has strongly in- fl uenced Italian history and is still highly present in political debates; and - the presence of numerous “linguistic” minorities (around fi ve percent of the Italian population) that are very different from each other. In Italy, one commonly speaks of linguistic minorities: regional and local differences are expressed by the variety of languages and dialects that are still spoken in Italy. The term “ethnic” is scarcely used in Italy, even if it has been employed to defi ne minorities together with the term “tribes” (see GEO special issue “the tribes of Italy”). When minorities speak of themselves, they speak in terms of populations, peo- ples, languages, and cultures. The greatest concentration of minorities is in border areas in the northeast and northwest that have been at the centre of wars and controversies during the 20th century. Other minorities settled on the two main islands (where they can sometimes constitute a ma- 1 Giovanna Campani jority, such as the Sardinians). -

Ciencia Y El Arte De Los Etruscos Y La Roma Antigua
Boletín de la Sociedad Entomológica Aragonesa (S.E.A.), nº 53 (31/12/2013): 363–412. LOS ARTRÓPODOS EN LA MITOLOGÍA, LAS CREENCIAS, LA CIENCIA Y EL ARTE DE LOS ETRUSCOS Y LA ROMA ANTIGUA Víctor J. Monserrat Departamento de Zoología y Antropología Física, Facultad de Biología, Universidad Complutense, 28040 Madrid (España). – [email protected] Resumen: Con una breve introducción sobre los primeros asentamientos humanos en la Península Itálica durante el Neolítico, y tras las influencias de los fenicios y los griegos, nos adentramos en la enigmática civilización etrusca, que acabará por generar la fascinante civilización romana. Mucho menos documentada que la de sus conquistadores romanos, los etruscos desarrollaron una civilización hedonista y refinada, y trataremos de ahondar en los artrópodos y sus derivados que formaron parte de sus creencias y costumbres, desde los escarabeos que usaban como sellos y amuletos, al uso de la miel en multitud de sus prácticas, rituales y hábitos. Tras ello damos paso al Imperio Romano, que desde sus rurales inicios llegó a ser el primer imperio de la historia con categoría de estado. Transitaremos por su dilatada historia y su estructura militar, política, social, económica y religiosa, y nos iremos acercando a su zoológico. Comentarenos primero, de forma general, algunos datos sobre sus animales, y posteriormente sus artrópodos en particular, siendo los artrópodos unos animales que formaron parte de las creencias de esta civilización, con una enorme intencionalidad práctica y con mucho menos importancia simbólica, mágica y ritual que en otras civilizaciones mediterráneas previas, como la egipcia, la cretense o la griega. Aun así hablaremos de los artrópodos que hallamos en su mitología y sus deidades, así como los que hallamos entre sus creencias, costumbres, rituales, u ofrendas, en las que los artrópodos participaron y que dejaron constancia en multitud de ejemplos de su magnífica arquitectura, musivaria, escultura, arte mobiliario, pintura, orfebrería o numismática. -

Alessandro Morandi the Etruscan Language : New Acquisitions
Alessandro Morandi The Etruscan language : new acquisitions Światowit : rocznik poświęcony archeologii przeddziejowej i badaniom pierwotnej kultury polskiej i słowiańskiej 7 (48)/A, 31-40 2006/2008 ŚWIATOWIT • TOM vII (XLvIII) • fASC . A • 2006-2008 ALESSANDRO MORANDI (UNIVERSIT DI ROMA “L A SAPIENZA ”) the etRUScAn lAngUAge : n eW AcqUISItIonS (P l. 1 6-19) In the last twenty years many Etruscan inscrip - in the first person, in the well-known archaic, Etruscan, tions have been found, bringing the total number of doc- greek and Latin tradition of the speaking object. Nor is umented exempla to well over 10.000, even if we restrict there any difficulty in linking capi with the Latin capio and ourselves to those of a certain linguistic importance. The the greek kapto in the dual sense o f “contain” and “take”. variety of supports is striking: lead tablets, such as that of The stele of Saturnia, discovered in 1984 but edit - Pech Maho 1; cippi, of which there is an exceptionally beau - ed in 1999, again has the verb zinece/tinece , already familiar tiful, though fragmentary, one from Tragliatella, between from other monumental inscriptions, probably meaning Cerve teri and veio 2; and the important stele of Saturnia 3, “had done”; in the sense that the figures mentioned in the which has a fairly long text. We now even have the bronze- funeral text took upon themselves to have this commemo - plated lead weight of a balance, the so-called aequipondium rative stele erected on behalf of Larth Laucies, their father. of Cerveteri 4. Each of these documents supplies important The verb in question is also known from the Rhaetian in elements for our knowledge of Etruscan. -

Glass in Northern Adriatic Area from Roman to Medieval Period: a Geochemical Approach for Provenance and Production Technologies
Sede Amministrativa: Università degli Studi di Padova Dipartimento di Scienze dell’Antichità SCUOLA DI DOTTORATO DI RICERCA IN STUDIO E CONSERVAZIONE DEI BENI ARCHEOLOGICI E ARCHITETTONICI INDIRIZZO: Scienze e Tecnologie Per i Beni Archeologici e Architettonici CICLO XXIV GLASS IN NORTHERN ADRIATIC AREA FROM ROMAN TO MEDIEVAL PERIOD: A GEOCHEMICAL APPROACH FOR PROVENANCE AND PRODUCTION TECHNOLOGIES Direttore della Scuola: Ch.mo Prof. Giovanni Leonardi Supervisore: Ch.mo Prof. Gianmario Molin Dottoranda: Filomena Gallo ABSTRACT English Glass is one of the oldest materials produced and extensively used by man, thanks to its unique mechanical and chemical-physical properties. For these reasons it has a great importance in both archaeological and artistic fields. So far, notwithstanding the essential lines of development of glass production are known, there are still some particular ‘critical moments’ in the history of glass production. In this context the present work investigated the evolution of glass technology in a particular geographical area, the northern Adriatic Italy, which, for its peculiar position, had a central role in trades and acted as a commercial hub between the Mediterranean and the Padan and Transalpine area. The sample set, including a total of 178 glasses, covers a large chronological period (6th century BC-15th century AD) and comes from some of the most important sites in the period and in the area considered, such as Aquileia, Adria and Rocca di Asolo. Few samples coming from Tuscan sites (San Genesio, Pieve di Pava and Pieve di Coneo), similar in age and types to Aquileia glasses, were also analyzed, in order to have a comparison among eastern and western Italy. -
© 2011 Ottavio Balena ALL RIGHTS RESERVED
© 2011 Ottavio Balena ALL RIGHTS RESERVED GIOVANNI GIOVIANO PONTANO: MORALISMO E GIOVIALITÀ By OTTAVIO BALENA A Dissertation submitted to the Graduate School-New Brunswick Rutgers, The State University of New Jersey in partial fulfillment of the requirements for the degree of Doctor of Philosophy Graduate Program in Italian Written under the direction of Professor David Marsh and approved by ________________________ ________________________ ________________________ ________________________ New Brunswick, New Jersey May, 2011 ABSTRACT OF THE DISSERTATION Giovanni Gioviano Pontano: Moralismo e Giovialità by Ottavio Balena Dissertation Director Professor David Marsh If there is an author in the history of the Italian Quattrocento that truly tried to theorize in his writings the multiple manifestations of “life” by synthesizing and refining the complexity of its themes, this is by all means Giovanni Gioviano Pontano. In true light of the humanistic atmosphere of the time, where between life and art one must have chosen art, Pontano embraced art as the fundamental medium through which he could convey and articulate the object of his doctrinal meditations: life, where everything is connected and disposed harmoniously; life, where the active, moral and jovial participation of all individuals is essential to the establishment of society. Since Pontano was a proliferous writer that left behind an abundant production of poetical and philosophical masterpieces, the main objective of this dissertation is to identify which of his works are best suited to narrate his life in conjunction to his humanistic ideals. Leaving behind traditional methodologies, especially those echoing the influence of the Italian Romanticism, this dissertation emphasizes the importance to evaluate Pontano without relying so much on past literary criticism, because it can easily suggest that he was an ambiguous writer, a lascivious poet, a great teacher of morality and a man of profound religious believes: hence the confusion about his true identity and inspiring muse. -

Introduzione 17 La Prima Pompei
Introduzione Introduction 17 La prima Pompei: la città nuova 18 The first Pompeii: the new Etruscan etrusca in una Campania multietnica city in a multi-ethnic Campania Gli Etruschi in Campania prima The Etruscans in Campania di Pompei before Pompeii 22 Italici, Etruschi e Greci 22 Italics, Etruscans and Greeks 23 La Valle del Sarno: una enclave 24 The Sarno Valley: an Italic italica? enclave? 29 Aristocrazie campane in un 33 Campanian aristocracies in an Mediterraneo orientalizzante Orientalizing Mediterranean Intorno al 600 a.C. Around 600 BCE 38 Qualche fattore preliminare alla 38 Some factors prior to the founding fondazione di Pompei of Pompeii 38 La trasformazione interna delle 40 The internal transformation società della Campania arcaica of the societies of archaic Campania 41 La rete degli scambi in Italia e nel 44 The structuring of trade in Italy Mediterraneo and the Mediterranean 45 Le nuove città arcaiche 47 The new archaic cities La Pompei “etrusca” “Etruscan” Pompeii 50 Pompei, l’urbanesimo dell’alto 52 Pompeii, the urbanism of the early arcaismo e la procedura etrusca di archaic period and the Etruscan fondazione foundation procedure 54 Una documentazione lacunosa ma in 55 An incomplete record but in full pieno rinnovamento renewal Il crepuscolo della Pompei “etrusca” The twilight of “Etruscan” Pompeii 60 La Campania etrusca nella bufera: la 64 Etruscan Campania in turmoil: prima metà del V secolo a.C. the first half of the 5th century BCE 66 Il popolo campano e la 67 The Campanian people and the sannitizzazione della Campania -

La Contestazione Leghista E La Riscoperta Del Tricolore (1990-2011)
La contestazione leghista e la riscoperta del Tricolore (1990-2011) Giorgio Vecchio* Il contributo intende offrire una prima ricostruzione della polemica secessionistica scatena- ta da Umberto Bossi e dalla sua Lega nord, tra gli anni Novanta del XX secolo e i primi an- ni del XXI secolo. L’accento è posto sull’uso della simbologia come strumento comunicativo, ponendo a confronto il sostanziale disinteresse dei partiti tradizionali e la ricerca, da par- te della Lega, di modalità innovative di mobilitazione e trasmissione del messaggio. Il seces- sionismo contenne una forte contrapposizione tra i simboli della Lega e la bandiera naziona- le italiana. Un primo momento culminante si ebbe nel 1995-1997, nel contesto politico seguito alla crisi di “Tangentopoli” e alla rottura politica tra Bossi e Berlusconi. Fu in quel periodo che si affacciarono alla ribalta sia il cosiddetto “sole delle Alpi”, sia l’uso politico dello sport, specie del ciclismo. Il contributo dà spazio alle idee di Gilberto Oneto, ricercatore di simbolo- gie funzionali al leghismo. La parte finale del saggio rimanda alle prime reazioni della classe politica e di parte della società italiana, considerando l’operato del presidente della repubblica Ciampi e del suo successore Napolitano. Si ricordano gli sforzi per rilanciare l’uso del Trico- lore anche al di fuori degli stadi calcistici e per diffondere la conoscenza dell’inno nazionale, favorito pure dall’interpretazione di Roberto Benigni al festival di Sanremo del 2011, in coin- cidenza con le celebrazioni del 150° dell’Unità d’Italia. Parole chiave: Lega Nord, Secessionismo, Tricolore The polemics of the Lega nord and the rediscovery of the “tricolore” (1990-2011) The article examines the controversy aroused by the secessionist policies promoted by Umberto Bossi and the Lega Nord between the 1990s and the beginning of the twenty- first century. -

Larissa Bonfante the Magic of Ivory and Amber. Greek and Etruscan
Volume 22 Winter 2020 the collection of mirrors in the Metropolitan Museum In Memoriam: of Art. She was the founder of the American section of Larissa Bonfante the prestigious Istituto Nazionale di Studi Etruschi e Ita- by Nancy T. de Grummond lici, reaching across the divide of the Atlantic to forge stronger bonds between American and European collea- Mirrors, inscriptions, costume, language, history, so- gues. Conscripted by Jane Whitehead to collaborate in ciety, sexuality, art—these were the areas of Etruscan the editing of the journal Etruscan Studies and the an- studies in which Larissa Bonfante was an internationally nual newspaper Etruscan News (which became the of- admired expert. Her contributions have been influential ficial organ of the American Section of the Istituto) over a period of more than 40 years and will always be Larissa played a most important role in promoting the remembered for what she initiated or added to the dia- publication of scholarly articles and reviews, and in de- logue. She also took an interest in many other aspects veloping a kaleidoscope of the latest news of excava- of cultural studies, some quite surprising. Larissa’s li- tions, exhibitions, books, conferences, awards, vely curiosity and intellect led her to translate the me- achievements, and poetry about the Etruscans, along dieval plays of Hroswitha of Gandersheim (with her with amusing jokes and photos of Archeocats and mo- daughter Alexandra Bonfante -Warren), to study and pu- ving tributes to beloved colleagues who had passed from blish the art of the north Italian ancient culture known our midst. Larissa loved to bring attention to worthwhile as the Situla Peoples, to collaborate on articles on Mi- but neglected corners of classical studies.