C212 Data.Pdf
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-
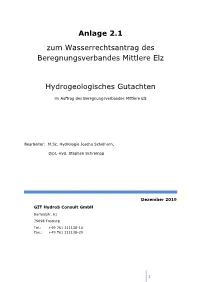
Documentation Standard of Bore Data for Water Corporation
Anlage 2.1 zum Wasserrechtsantrag des Beregnungsverbandes Mittlere Elz Hydrogeologisches Gutachten im Auftrag des Beregnungsverbandes Mittlere Elz Bearbeiter: M.Sc. Hydrologie Joscha Schelhorn, Dipl.-Hyd. Stephen Schrempp Dezember 2019 GIT HydroS Consult GmbH Bertoldstr. 61 79098 Freiburg Tel.: +49 761 211138-10 Fax.: +49 761 211138-29 1 Inhaltsverzeichnis 1 VERANLASSUNG UND ZIELSETZUNG ................................................................. 8 2 EINLEITUNG ....................................................................................................................... 10 2.1 Geologie ............................................................................................................................................ 10 2.2 Porengrundwasserleiter .................................................................................................................... 12 2.3 Kluftgrundwasserleiter ...................................................................................................................... 13 2.4 Trennschicht ...................................................................................................................................... 15 3 BEWERTUNG DER AKTUELLEN DATENGRUNDLAGE IM ELZ-GLOTTER- SCHWEMMFÄCHER ........................................................................................................................ 16 3.1 Böden im Elz-Glotter-Schwemmfächer .............................................................................................. 16 3.2 Grundwasserneubildung -

Heritage Interpretation Als Element Eines Nachhaltigen Tourismus Im Pilotprojekt Interpretationsraum Kandel, Südschwarzwald ‐ Eine Evaluation Mittels GPS‐Tracking
Heritage Interpretation als Element eines nachhaltigen Tourismus im Pilotprojekt Interpretationsraum Kandel, Südschwarzwald ‐ eine Evaluation mittels GPS‐Tracking Inaugural‐Dissertation zur Erlangung der Doktorwürde der Fakultät für Umwelt und Natürliche Ressourcen Albert‐Ludwigs‐Universität Freiburg i. Brsg. vorgelegt von Anna Chatel‐Messer Freiburg im Breisgau 2013 Dekan: Frau Prof. Dr. Barbara Koch Referent: Herr Prof. Dr. Rainer Glawion Korreferent: Herr Prof. Dr. Tim Freytag Gutachter: Herr Prof. Dr. Axel Drescher Disputationsdatum: 14. November 2013 II Für meinen Vater Rudolf III IV Danksagungen Mein herzlicher Dank gilt Herrn Prof. Dr. Rainer Glawion und Herrn Prof. Dr. Tim Freytag, die meine Arbeit betreuten und mich beide sehr in meinem Vorhaben unterstützten. Weiterhin danke ich Herrn Prof. Dr. Axel Drescher, der die Zweitbegutachtung der Arbeit übernommen hat, sowie Frau Prof. Dr. Heidi Megerle, die wertvolle Erfahrungen und Anmerkungen bei‐ steuerte. Monika Nethe hat einen großen Beitrag zu dieser Arbeit geleistet, da sie tagtäglich meine Ansprechpartnerin für Fragen war und mit mir engagiert über die Inhalte diskutierte. Patrick Lehnes machte mich als Erster mit dem Ansatz Heritage Interpretation vertraut und gab mir sehr hilfreiche Gedanken und Erfahrungen weiter. Dr. Thomas Uhlendahl und Dr. Hans‐Jörg Weber danke ich für die Hilfe beim Erstellen des Fragebogens und vielen weiteren wertvollen, fachlichen Tipps. Angelika Schuler danke ich für die Unterstützung bei bürokratischen Hürden und ihre warm‐ herzige Art. Vielen Dank -

Nachruf Schnitts Kommt Es Auf Der Föhrentalstraße Ab
49. JahrgangtWoche 18 Donnerstag, den 02. Mai 2019 Hochgenuss im Südschwarzwald Herausgeber: Gemeindeverwaltung Glottertal. Verantwortlich für den amtlichen Teil: Bürgermeister Herbstritt o. V. i. A. Vorankündigung Panoramafreibad Glottertal Das Panoramafreibad önet am Samstag, den 11. Mai 2019 (Bei schlechtem Wetter eine Woche später, am 18. Mai 2019) Nähere Informationen im kommenden Mitteilungsblatt und auf der Homepage der Gemeinde Glottertal. Kartenvorverkauf startet früher Ab kommendem Dienstag, 07. Mai bis einschließlich Freitag, 10. Mai startet der Kartenvorverkauf direkt an der Kasse im Freibad Glottertal, täglich, in der Zeit von 10.00 bis 16.00 Uhr Vollsperrung Föhrentalstraße II. Bauabschnitt Zu einer weiteren Vollsperrung, im Rahmen des II. Bauab- Nachruf schnitts kommt es auf der Föhrentalstraße ab Die Gemeinde und die Freiwillige Feuerwehr Glottertal trau- Montag, dem 06. Mai - voraussichtlich für 14 Tage - ert um ihren Mitbürger und Kameraden bis einschließlich zum 17.05.2019 Georg Eble Die Vollsperrung erfolgt in Höhe des Schäehofes, talauf- wärts, täglich zwischen 7.30 und 17.00 Uhr. der vergangene Woche im Alter von 91 Jahren verstorben ist. Es ist in dem genannten Zeitraum keine Durchfahrt und keine Im Jahre 1946 trat er in die Wehr ein und war seither ununter- Umfahrung der Baustelle möglich. brochen Mitglied der Freiwilligen Feuerwehr Glottertal. Er war ein langjähriger und geschätzter Kamerad. Wir bitten die Anlieger um Verständnis und Beachtung. Sein vorbildliches und kameradschaftliches Verhalten wird uns in dankbarer Erinnerung bleiben. Gemeinde Glottertal Unser tiefes Mitgefühl gilt seinen Angehörigen. Glottertal, im April 2019 Gemeinde Glottertal Freiwillige Feuerwehr Glottertal Karl Josef Herbstritt Daniel Reichenbach Bürgermeister Kommandant Seite 2 Donnerstag, den 02. Mai 2019 Geschwindigkeitsmessungen Datum: 09.04.2018 folgende Geschwindigkeitsmessung wurde vom Landkreis Zul. -

Unser Beraterteam Ist Für Sie
Hauszeitung der GEPflegt Kirchlichen Sozialstation Elz/Glotter e.V. Ausgabe 28 • 2016 Themen dieser Ausgabe Seiten 2 + 3 Schlaf gut! Mit Schlafhilfen aus der Natur Seite 4 Liebe Leserin, lieber Leser, Neue Ausbildung: Von der Krankenschwester dass unsere Tagespflege das ge zur Pflegefachfrau worden ist, was sie ist, verdanken wir vor allem Jutta Wahl. Sie hat Unsere Beratung ist teilweise die „Glockenblume“ zu einem kostenfrei und wird unter über aus erfolgreichen, beliebten bestimmten Voraussetzungen von Betreuungsangebot gemacht, das den Kostenträgern übernommen. Fotos: Robert Kneschke, fotolia.com Robert Kneschke, Fotos: in Denzlingen heute nicht mehr Umfassend und individuell wegzudenken ist. Mit ihrem Kön nen und ihrem Gestaltungs willen, ihren Ideen und ihrer Weitsich t Unser Beraterteam ist für Sie da! ging Jutta Wahl von Anfang an Pflegesituationen treten häufig Beraterteam der Kirchlichen Sozial daran, das neue Projekt umzuset s tation ElzGlotter e.V., bestehend unverhofft ein. Im hohen Alter, zen. Es gelang ihr, dafür ein starkes aus vier Beraterinnen und Beratern, Team zu begeistern: Pflegefach nach einer Krankheit oder einem bietet den Rat und Hilfesuchenden kräfte, bürgerschaftlich Engagierte Krankenhausaufenthalt. Unterstützung und Klärung rund in Betreuung und Fahr dienst sowie um die gesetzlichen Leistungen und Angehörige und Betroffene sehen junge Menschen im freiwilligen Möglichkeiten, gibt Auskunft über Dienst. Die Tagespflege „Zur ungewohnte Aufgaben auf sich Hilfsangebote in unseren Gemein den Denzlingen, -

Zum Wasserbau Im Mittelalter Beispiele Aus Südbaden
01_nb108_01_64.qxd:Nabla 19.02.2008 12:51 Uhr Seite 40 Zum Wasserbau im Mittelalter Beispiele aus Südbaden 15 km nördlich von Freiburg befinden sich das Glottertal und das Suggental. Hier existierte im 13. Jahrhundert eines der wichtigsten Silberbergwerke des Schwarzwaldes. Besondere Beachtung verdient ein 25 km langer Hangkanal, der das Wasser zu Wasserhebeanlagen führte. Diese Anlagen wurden am Ende des 13. Jahrhunderts errichtet und sind die ältesten, die in Europa be- kannt sind. Am Erhalt dieses einzigartigen Ensembles besteht aus technik - geschichtlichen Gründen ein öffentliches Interesse. Andreas Haasis-Berner Bergbau im Suggental und Glottertal Schließlich lässt die mittelalterliche Bezeichnung dieses Bergwerkes „herzogenberg“ den Bezug Die Erzlagerstätten am Ausgang des Glotter- und zu den Zähringern offenkundig werden. Hier ent- Suggentales wurden bereits in römischer Zeit ge- stand im Laufe der Zeit ein Bad, dessen jüngster nutzt. Im 12. Jahrhundert lässt sich die Nutzung Bau durch die Fernsehserie „Die Schwarzwaldkli- der Blei-Silbererze und ihre Verhüttung nahe dem nik“ bekannt wurde. 918 gegründeten Kloster St. Margarethen von Bei den Bergwerken, deren Reste noch heute in Waldkirch nachweisen. Das Suggental gehörte Form von Verhauen, Pingen (trichterförmige Ver- zum Besitz des Klosters St. Margarethen. Als tiefungen über eingestürzten Schächte) und Hal- Vögte des Klosters haben im Jahre 1290 die Her- den (z.B. die Liegewiese des Freibades im Glot- ren von Schwarzenberg das Verfügungsrecht tertal), im Suggental auch durch ein Besucher- über die mineralischen Rohstoffe ihres Herr- bergwerk sichtbar sind, bildeten sich große schaftsbereiches. Dagegen gehörte das benach- Bergleutesiedlungen. Im Suggental sind sogar barte Glottertal im 13. Jahrhundert den Grafen noch die Reste einer Kirche des 13. -

Wasserversorgungsverband MAURACHERBERG
60 Jahre Wasserversorgungsverband MAURACHERBERG DENZLINGEN EMMENDINGEN GOTTERTAL HEUWEILER REUTE VÖRSTETTEN WALDKIRCH VORWORT Sehr geehrte Damen und Herren, seit nunmehr 60 Jahren versorgt der Wasser- versorgungsverband Mauracherberg unsere Heimatregion zuverlässig mit Trinkwasser bester Qualität. Wasser ist Notwendigkeit, Wasser ist Leben. Wir werden uns mehr und mehr unserer Verant- Minimum anderthalb Liter Wasser braucht wortung für heutige und nachfolgende Gene- jeder Mensch am Tag, um überleben zu kön- rationen bewusst. nen. Das scheint nicht viel, dennoch ist es – leider – so, dass rund vier Milliarden Menschen Die Grundwasserreservoire, die Flüsse und mindestens einen Monat im Jahr nicht ausrei- Bäche, die Seen im Schwarzwald, die das chend Wasser zur Verfügung haben. Zwischen Rückgrat unserer Wasserversorgung bilden, 1,8 bis 2,9 Milliarden Menschen leiden bis zu müssen nach jedem Sommer wieder gefüllt einem halben Jahr unter Wasserknappheit, werden. Das scheint – auf den ersten Blick – 500 Millionen sogar ganzjährig. leicht: es muss ja nur ausreichend regnen. Falsch! Durch die Trockenheit verhärtete Wasser ist notwendig – für den Menschen, Böden lassen Wasser nicht in ausreichendem Tiere, den Anbau von Obst, Gemüse, Getreide, Maße durch sickern. Vermutlich kommen so für Betriebe. Wir, die wir nur den Hahn auf- große Wassermengen nicht in den Reservoiren, drehen müssen, um sauberes Trinkwasser zu tief unter der Erde, an. erhalten, ahnen nicht ansatzweise, welche Herausforderungen die Wasserversorgung 60 Jahre gibt es nun schon den Wasserversor- gerade auch in anderen Teilen der Welt mit gungsverband Mauracherberg. Seit 60 Jahren sich bringt. Aber: es steht zu befürchten, dass sorgt dieser dafür, dass die Mitgliedskom- wir angesichts der Erderhitzung zukünftig zu- munen (Denzlingen, Emmendingen, Glotter- mindest ansatzweise verstehen lernen, wie tal, Heuweiler, Reute, Vörstetten und Wald- wichtig sauberes Wasser ist. -

Heribert Saldik Die Grenzbeschreibungen Des Rotulus
Heribert Saldik Die Grenzbeschreibungen des Rotulus Sanpetrinus Inhaltsverzeichnis Seite Einführung..................................................................................................................................... 1 1. Die Grenzbeschreibungen A und R und ihre hypothetische Vorlage U 1.1 Die Grenzpunkte der Grenzbeschreibung A.........................................................................3 1.2 Die Vorlage U........................................................................................................................... 9 1.3 Die Urkunden zu den Grenzschlichtungen von 1121, 1125 und 1136...............................13 1.4 Die Grenzbeschreibung A..................................................................................................... 17 1.5 Die Grenzbeschreibung R..................................................................................................... 18 2. Die Grenzbeschreibung B 2.1 Die Grenzbeschreibung B und die Urkunde zur Grenzschlichtung von 1265................. 20 2.2 Johann Friedrich Schannats Abschrift................................................................................27 3. Verzeichnis der Abbildungen............................................................................................... 29 4. Literaturverzeichnis.............................................................................................................. 30 Einführung Der Bürgerkrieg (1077–1080) im Gefolge des Investiturstreites zwischen Kaiser und Papst nötigte die auf der päpstlichen -

Ahughes Thesis Submission to Grad School
THESIS PERSISTENCE OF ETHNIC DRESS TRADITIONS IN CONTEMPORARY SOCIETY: AN INTERPRETIVE STUDY OF GERMANY’S BLACK FOREST TRACHTEN Submitted by Amy Sue Hughes Department of Design and Merchandising In partial fulfillment of the requirements For the Degree of Master of Science Colorado State University Fort Collins, Colorado Fall 2014 Master’s Committee: Advisor: Jennifer P. Ogle Co Advisor: Susan J. Torntore Diane C. Sparks Irmgard E. Hunt Copyright by Amy Hughes 2014 All rights reserved ABSTRACT PERSISTENCE OF ETHNIC DRESS TRADITIONS IN CONTEMPORARY SOCIETY: AN INTERPRETIVE STUDY OF GERMANY’S BLACK FOREST TRACHTEN The ethnic dress of Germany’s Black Forest, called Tracht, dates back to the 16th century and has historically been worn by rural inhabitants for social and religious occasions. Although most people living within the Black Forest do not presently wear Trachten (plural for Tracht), some persistence in this tradition exists. Thus, the purpose of this interpretive inquiry was to explore the factors that have supported the persistence of Trachten tradition, specifically related to the wearing and crafting of Trachten by women, in a contemporary society. The work was informed by theory proposing that ethnic dress is not static, but rather, changes across space and time in ways that enable its persistence. A qualitative, ethnographic approach was adopted. During her immersion in the field, the researcher conducted extensive observations to “develop an insider’s view” (Genzuk, 2003, p. 2) of the Trachten tradition. Formal interviews were conducted with 10 individuals: eight adult female Trachten wearers, six of whom also were Trachten handcrafters, and two local Trachten experts. -

DÜRR, Hans Hermann Research Assistant Professor of Hydrobiogeochemical Modeling [email protected]
DÜRR, Hans Hermann Research Assistant Professor of Hydrobiogeochemical Modeling [email protected] PERSONAL PROFILE Personal: Thorough, dedicated, strong team- and networker, accessible, flexible, independent, familiar with multi-cultural and –lingual environments Research: PhD ‘Earth Sciences – Geosciences and natural resources’; hydrology, hydrogeology, geochemistry, geostatistics, specialisation in GIS on varying scales from local to global; land-ocean connection and related nutrient fluxes via different pathways Output: Over 20 peer-reviewed publications mainly in highly cited journals (h- index: 10, according to http://www.researcherid.com/rid/F-6370-2010); several presentations as invited speaker; member of international research committees; over 40 presentations (oral and poster) at conferences, official meetings, or other communications and lectures Computing: Geographic information systems, hydrological and groundwater flow models, data bases, statistics, some programming Languages: German (native speaker), French (excellent), English (fluent), Dutch (good) and Spanish (fair) EMPLOYMENTS 08/2011 – 12/2011 Docent ‘Geohazards’ at the Department of Earth Sciences, Utrecht University 11/2010 – 02/2011 Researcher grant at the KlimaCampus, Hamburg University 06/2010 – 07/2011 Guest Researcher, Department of Earth Sciences, Utrecht University 09/2008 – 05/2010 Post-Doctoral Researcher and EU-FP6-project WP-coordinator at the Department of Physical Geography, Utrecht University 09/2005 – 08/2008 Post-Doctoral Researcher at the Department -

Denzlinger Wanderwege
8. Denzlingen - Elzdamm - Wasser. 9. Fernwanderwege. Schwarzwaldverein (gelbe Raute; Variante über Brühl zunächst mit roter Das Gemeindegebiet von Denzlingen wird von den Raute auf gelben Grund) folgenden Fernwanderwegen berührt; die hiesigen Vom Rondell Città della Pieve entweder auf dem Streckenabschnitte sind in den vorigen Denzlingen Wanderweg nach Sexau (s. Nr. 6) bis zur Elzbrücke, Wegbeschreibun-gen aufgeführt: dann auf dem linken oder rechten Elzdamm Querweg Schwarzwald - Kaiserstuhl - Rhein von flussabwärts nach Wasser; oder zunächst auf dem Donaueschingen nach Breisach (rote Raute auf gelben Querweg bis zu den Gehöften im Brühl und dann am Grund). östlichen Waldrand entlang zum linksufrigen Breisgauer Weinweg von Lahr nach Freiburg (rote Elzdamm. Raute mit grüner Traube). Alternativen ab Wasser: weiter auf dem Elzdamm bis Regionaler Weg von Denzlingen über den Kandel nach Riegel, nach Emmendingen-Stadt oder zurück nach Furtwangen (blaue Raute). Denzlingen durch den Wassermer Wald. Denzlinger Wanderwege Die Gemeinde und der Schwarzwaldverein Denzlingen Ca 600m nach dem Wissereck kann man im Rebwald Anschließend auf dem Bergrücken zwischen Föhren- haben ein völlig neues Wanderwegenetz eingerichtet. zur Glotter bei der Mattenmühle (Wanderparkplatz) und Wildtal durch den Wald aufwärts zum Ochsenlager Durch dieses Angebot wird es Wanderern und Spazier- ab-steigen und dann zum Einbollen-Stadion und schließlich zum Rosskopfturm mit seinem ein- gängern ermöglicht, sich leichter als bisher in der reiz- maligen Panorama. vollen Landschaft -
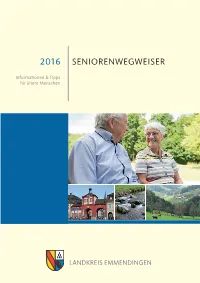
Seniorenwegeweiser (PDF-Datei)
em2016_umschlag.qxp_Layout 1 17.12.15 16:35 Seite 1 Seniorenzentrum Bürkle-Bleiche Mission Mensch. 2016 SENIORENWEGWEISER Informationen & Tipps für ältere Menschen Unsere Angebote: • Stationäre Pflege: 48 komfortable Einzelzimmer und 4 Doppelzimmer 2016 Alle Zimmer verfügen über eine eigene Nasszelle • Kurzzeitpflege: 6 Kurzzeitpflegebetten (bitte rechtzeitig reservieren) • Betreutes Wohnen: 40 Einzimmer- und 19 Zweizimmerwohnungen • Betreuung von de- menziell Erkrankten: Montag, Mittwoch und Freitag von 14.00 bis 18.00 Uhr SENIORENWEGWEISER Abholservice auf Wunsch • Hausnotruf: Sicherheit rund um die Uhr, auch im häuslichen Umfeld Seniorenzentrum Bürkle-Bleiche Lessingstraße 30 – 36 · 79312 Emmendingen Telefon (0 76 41) 92 14-4 LANDKREIS EMMENDINGEN Telefax (0 76 41) 92 14-199 [email protected] LANDKREIS EMMENDINGEN LANDKREIS www.caritas-emmendingen.de em2016_umschlag.qxp_Layout 1 17.12.15 16:35 Seite 2 Einzugsgebiete der dienst in Ih Das kommt e r eg er fl N Kirchlichen Sozialstationen P ä r h e e im Landkreis Emmendingen D mir nicht in die Tonne. Herbolzheim Rheinhausen Broggingen Tutschfelden Wagenstadt Biederbach Oberprechtal Bleichheim Weisweil Nordweil Prechtal Kenzingen Ottoschwanden Oberspitzenbach Bombach Hecklingen Freiamt Katzenmoos Wyhl Forchheim Elzach Heimbach Riegel Malterdingen Oberwinden Endingen Yach Sasbach Köndringen Niederwinden Mundingen Siegelau Königsschaffhausen Leiselheim Teningen Emmendingen Amoltern Bleibach Windenreute Jechtingen Kiechlinsbergen Bahlingen Gutach Sexau Siensbach Nimburg Kollnau Wasser Kollmarsreute Untersimonswald Reute Waldkirch Buchholz i negnlzneDSuggental Obersimonswald Vörstetten Glottertal Altmedikamente gehören nicht in die graue Tonne. 79211 Denzlingen Kirchliche Sozialstation Elz/Glotter e.V. Sie können beim Schadstoffmobil abgegeben werden. Die genauen Tel.: 07666-7311 E-mail: [email protected] 79215 Elzach Termine fi nden Sie im Abfallkalender oder im Internet. -
Mittelalterliche Wasserbauten Im Schwarzwald Und in Der Rheinebene
ZOBODAT - www.zobodat.at Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database Digitale Literatur/Digital Literature Zeitschrift/Journal: Berichte der naturforschenden Gesellschaft zu Freiburg im Breisgau Jahr/Year: 2013 Band/Volume: 103 Autor(en)/Author(s): Haasis-Berner Andreas Artikel/Article: Mittelalterliche Wasserbauten im Schwarzwald und in der Rheinebene 43-51 © Naturforschende Gesellschaft zu Freiburg im Breisgau c/o Institut für Geo- und Umweltnaturwissenschaften; download www.zobodat.at Mittelalterliche Wasserbauten im Schwarzwald und in der Rheinebene 43 Mittelalterliche Wasserbauten im Schwarzwald und in der Rheinebene Andreas Haasis-Berner Kurzfassung Eingriffe in das Gewässernetz für die Wiesenbewässerung lassen sich im Breisgau seit dem Frühmittelalter wahrscheinlich machen. Ab dem 10. Jh. wurden Gewässer zum Schutz vor Hochwasser abgeleitet. Mit der Diversifi kation der Wasserkraft erfolgte ab dem 12. Jh. der Bau von Mühl- und Gewerbekanälen. Stichwörter Frühmittelalter, Diversifi kation, Wasserkraft, Mühlkanäle Medieval water buildings in the Black Forest and in the Upper Rhine Valley Abstract Changes in the water distribution network of the grassland irrigation systems since the early Middle Ages can probably be proven. Since the 10th century A.D. rivers have been drained for the protection against fl ooding. With the diversifi cation of water power since the 12th century the building of water mills and industrial channels was established. Keywords Early Middle Ages, diversifi cation, water, mill-canals © Naturforschende Gesellschaft zu Freiburg im Breisgau c/o Institut für Geo- und Umweltnaturwissenschaften; download www.zobodat.at 44 Andreas Haasis-Berner 1. Einleitung Die Eingriffe ins Gewässernetz seit dem Frühmittelalter bestehen aus zwei Hauptbereichen, der Trinkwasser- und der Brauchwasserversorgung.1 Zur Trinkwasserversorgung dienten Brunnen und Wasserleitungen.