Watergy Im Bestand
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

Shifting Neighbourhood Dynamics and Everyday Experiences of Displacement in Kreuzberg, Berlin
Faculty of Humanities School of Design and the Built Environment Shifting Neighbourhood Dynamics and Everyday Experiences of Displacement in Kreuzberg, Berlin Adam Crowe 0000-0001-6757-3813 THIS THESIS IS PRESENTED FOR THE DEGREE OF Doctor of Philosophy of Curtin University November 2020 Declaration I hereby declare that: I. the thesis is being submitted in partial fulfilment of the requirements for the degree of Doctor of Philosophy II. the research is a result of my own independent investigation under the guidance of my supervisory team III. the research presented and reported in this thesis was conducted in accordance with the National Health and Medical Research Council’s (NHMRC) National Statement on Ethical Conduct in Human Research (2007). The proposed study received human research ethics approval from the Curtin University Human Research Ethics Committee (EC00262), Approval Number HRE2017-0522 IV. the thesis contains no material previously published by any other person except where due acknowledgement has been made V. this thesis contains no material which has been accepted for the award of any other degree or diploma in any university Signature: Adam Joseph Crowe Date: November 12, 2020 ii Abstract This research explores the socio-spatial impacts of shifting housing and neighbourhood dynamics in the gentrifying neighbourhoods of Kreuzberg, Berlin. The locality represents a prime example of an inner-city locality that has been reimagined and transformed by a series of powerful actors including, but not limited to, an increasingly financialised real-estate sector, a tourism industry promoting Kreuzberg as a destination for higher-income groups, and a city-state government embracing and promoting entrepreneurial approaches to urban governance. -

Bezirksregionenprofil Teil I 2017 ______Südliche Luisenstadt
Bezirksregionenprofil Teil I 2017 ___________________________________________________________________________________________________ Südliche Luisenstadt Bezirksregionenprofil Teil I Südliche Luisenstadt Impressum Herausgeber: Bezirksamt Friedrichshain-Kreuzberg von Berlin Koordination: Steuerungsrunde BZRP (Herr Dr. Elvers, Frau Fißler, Herr Heuer, Herr Sommer) Bearbeitung: Jahn, Mack & Partner Berlin, August 2017 2 Bezirksregionenprofil Teil I Südliche Luisenstadt INHALTSVERZEICHNIS ABBILDUNGSVERZEICHNIS ..................................................................................................................................8 0 Einleitung .........................................................................................................................................................10 0.1 Anlass und Ziel des Bezirksregionenprofils (BZRP) .................................................................................10 0.2 Leitthemen einer integrierten Stadtteilentwicklung und Kernindikatoren ..................................................10 0.3 Bereitstellung und Aktualisierung der Indikatoren und Daten ...................................................................11 0.4 Erarbeitung und Fortschreibung ...............................................................................................................11 Teil I – Beschreibung und Bewertung der Bezirksregion (Analyse) ................................................................13 1 Kurzporträt der Bezirksregion – stadträumliche Struktur ...........................................................................13 -

Bürgerinitiativen Stand 2016
Bürgerinitiativen Stand 2016 Name/Anschrift Ansprechpartner Telefon E-Mail Adresse Internet Aktiv im Kiez Herr Dallmann 20067885 [email protected] [email protected] www.sparrplatz-quartier.de/ Aktiv-im-Kiez- Nachbarschaftsladen im e-V SprengelHaus Sprengelstraße 15 13353 Berlin Betroffenenrat "Nördliche Herr Hobrack 2795408 siehe Bürgerverein Luisenstadt siehe Bürgerverein Luisenstadt Luisenstadt" (Vorsitzender) 2754769 Michaelkirchstr. 2 Herr Dr. Duntze 10179 Berlin Frau Krause Betroffenenrat Lehrter Straße Frau Torka 3975238 betroffenenrat@lehrter-strasse- berlin.net www.lehrter-strasse-berlin.net Lehrter Straße 27-30 10557 Berlin Bürgerforum Mitte Herr Laukant [email protected] www.buergerforum-mitte.de (Brunnenstraße 145 [email protected] 10115 Berlin) c/o Herr Laukant Veteranenstr. 10b 10119 Berlin Bürgerinitiative BV Kompakt Frau Chudowa 46309119 [email protected] Graunstr. 28 13355 Berlin Bürgerinitiative Brüsseler Kiez Herr Schneider- 01522 [email protected] c/o Bodenbender 6467124 [email protected] Karl-Heinz Schneider- Frau Breitfeld- [email protected] Bodenbender Markowski Brüsseler Str. 27 a Frau Grimm 13353 Berlin 0176 38933590 Bürgerinitiative Invalidenstraße Matthew Griffin 28599934 [email protected] www.invalidenstrasse.org Bürgerinitiative Obere Herr Lobermeier 4916952 Koloniestraße c/o Herr Lobermeier Koloniestr. 65 13359 Berlin Bürgerinitiative Frau Nake-Mann 36751762 [email protected] Silberahorn.wordpress.com SilberahornPLUS Bürgerinitiative Wilhelmstraße Herr -

Narrative Space - Time Scapes
narrative space - time scapes (NARRABILITIES) Technion Haifa, Israel, Prof. Iris Aravot HafenCity Universität Hamburg, Germany, Prof. Christiane Sörensen narrative space - time scapes content 7 initial situation 11 definitions and terms 17 methods 23 localisation: luisenstadt, berlin 43 localisation: musrara, jersualem 55 prospects 49 references 57 imprint 6 initial situation “The historical and its consequences, the ‘diachronic’, the ‘etymology’ of locations in the sense of what happened at a particular spot or space and thereby changed it – all of this becomes inscribed in space. The past leaves its traces – time has its own script. Yet this space is always, now and for- merly, a present space, given as an immediate whole, complete with its associations and connec- tions in its actuality. Thus production process and product present themselves as two inseparable aspects, not as two separable ideas.” (Henri Lefebvre 1991, p. 37) The processual (inscription, sedimentation, layering of meaning), which Henri Lefebvre ad- dressed in “Production of Space,” and movement, in the form of slow mobilities, embodied mobilities (actors), and local and global virtual flows, are assumed to be key aspects in the constitution of contemporary cityscapes and should be given special attention in this research project (see DFG application). The research focuses on the invisible (life-world, history) as well as the visible (topographic) dimensions of a landscape, which are first to be identified and then analyzed in regard to their nature, their inter connectivity -

“100 Jahre Groß-Berlin” Entwicklungsphasen Bis Zum Groß-Berlin-Gesetz 1920 Inhalt
Referat, Modul B Jörg Kluge WS 19/20 20.03.2020 Folien zum Referat “100 Jahre Groß-Berlin” Entwicklungsphasen bis zum Groß-Berlin-Gesetz 1920 Inhalt 1. Anmerkungen zum Reformversuch des “Gesamtverbandes Groß-Berlin” ( siehe Anlage 1) 2. Skizzierung der Entwicklung der Stadt Berlin bis 1920. 3. Gründung des “Bürgerausschuss” zur Unterstützung des Groß- Berlin-Gesetzes. 4. Welche Interessen hatte der “Bürgerausschuss”? 5. Wie sollte die Stadtverwaltung nach dem „Groß-Berlin- Gesetz“ organisiert werden? 6. Fazit 2 1. Skizzierung der Entstehung der Stadt Berlin und sein Umland bis 1920. 3 4 Historische Stadtteile in Berlin-Mitte, wie sie zuletzt 1920 bestanden. Die Grenzen variierten im Lauf der Zeit. (Die Stadtteile VI bis X und XIX bis XXI sowie große Teile der Stadtteile V, XI, XIII, XIV, XVI und XVII liegen außerhalb des Ortsteils Mitte) I Alt-Berlin II Alt-Kölln (Spreeinsel) III Friedrichswerder IV Dorotheenstadt V Friedrichstadt XI Luisenstadt Quellen: XII Neu-Kölln Inhalt: Berliner Adressbuch, XIII Stralauer Vorstadt (https://digital.zlb.de/viewer/readi XIV Königsstadt ngmo XV Spandauer Vorstadt de/34115495_1920/3321/ XVI Rosenthaler Vorstadt LOG_0230/) XVII Oranienburger Vorstadt Kartengrundlage: Bezirksamt XVIII Friedrich-Wilhelm-Stadt Mitte von Berlin 5 Ab 1862 legte der Hobrecht-Plan die Grundlage für die Erschließung von Wohngebieten für bis zu zwei Millionen Menschen. 6 Quelle: Hegemann, W., Das steinerne Berlin,1930, S. 215 7 Übersicht der gelegenen Dörfer auf dem Gebiet der Stadt Berlin vor 1920 Die Einwohnerzahl stieg in den Vororten viel stärker als in der Stadt Berlin Aus: Berlin Forum 3/90, S.10 8 Zwischenstufe – Der Zweckverband Werbeplakat von Käthe Kollwitz Zweckverband ab 1. -

Dienstag, 02. Juni 2020 Beschluss Des Kreisvorstands Der SPD Berlin
Dienstag, 02. Juni 2020 1 Beschluss des Kreisvorstands der SPD Berlin-Mitte Zukunftsort Berliner Mitte: lebenswert – klimaresilient – gemeinwohlorientiert – geschichtsbewusst – autoarm – kulturstark Unser Plan für eine lebendige und lebenswerte Stadtmitte Die Berliner Mitte ist unter Berücksichtigung der sorgfältig im Partizipationsprozess „Alte Mitte. neue Liebe“ erarbeiteten und vom Abgeordnetenhaus im Jahr 2016 beschlossenen „Bürgerleitlinien für die Berliner Mitte“ behutsam zu reurbanisieren. Hierbei sind die Bereiche Molkenmarkt, Nikolaiviertel, Museumsinsel, Humboldtforum, Alt-Cölln, Fischerinsel, Spittelmarkt und Leipziger Straße, Unter den Linden, Spandauer Vorstadt, Alexanderplatz, Karl-Marx-Allee und Nördliche Luisenstadt konzeptionell einzubeziehen. Das Spreeufer ist, als verbindendes Element der Stadtmitte, in das Konzept mit einzubeziehen. Rathaus- und Marx-Engels-Forum: Für den anstehenden Wettbewerb zur Gestaltung von Rathaus- und Marx-Engels-Forum sind – aufbauend auf den zehn Bürgerleitlinien – folgende Aspekte zu berücksichtigen: Verkehr: Der Autoverkehr ist zugunsten von Fußgängern, Radfahrer*innen und dem öffentlichen Nahverkehr radikal auf ein Minimum zu reduzieren. Die Karl-Liebknecht-Straße wird je Richtung auf Tram und eine überbreite Mischspur für Bus, Taxi und notwendigen Anliegerverkehr sowie einen Radweg reduziert. Dies macht die Pflanzung von zwei Reihen Straßenbäumen möglich. Die Spandauer Straße wird eine die beiden Grünflächen verbindende Platzfläche, die die Ausweichstrecke für die neue Tram Richtung Mühlendammbrücke aufnimmt. Die reguläre Strecke der Tram wird über die Rathausstraße Richtung Alexanderplatz geführt. Fußgänger*innen sollen Vorfahrt erhalten. Alle öffentlichen Flächen sollen in vorbildlicher Weise barrierefrei gestaltet werden. Kultur und Geschichte: Die vorhandenen Denkmäler (auch Luther-Denkmal, Mendelssohn- Denkmal, die beiden Arbeiter vis-a-vis zum Rathaus, das Marx-Engels-Denkmal) sollen erhalten bleiben. Der Neptunbrunnen soll an seinem derzeitigen Platze erhalten bleiben. -

Hotel Berlin
HOTEL BERLIN: THE POLITICS OF COMMERCIAL HOSPITALITY IN THE GERMAN METROPOLIS, 1875–1945 by Adam Bisno A dissertation submitted to Johns Hopkins University in conformity with the requirements for the degree of Doctor of Philosophy Baltimore, Maryland December, 2017 © 2017 Adam Bisno ii Dissertation Advisor: Peter Jelavich Adam Bisno Hotel Berlin: The Politics of Commercial Hospitality in the German Metropolis, 1875–1945 Abstract This dissertation examines the institution of the grand hotel in Imperial, Weimar, and Nazi Berlin. It is a German cultural and business history of the fate of classical liberalism, which in practice treated human beings as rational, self-regulating subjects. The major shareholders in the corporations that owned the grand hotels, hotel managers, and hotel experts, through their daily efforts to keep the industry afloat amid the vicissitudes of modern German history, provide a vantage point from which to see the pathways from quotidian difficulties to political decisions, shedding light on how and why a multi-generational group of German businessmen embraced and then rejected liberal politics and culture in Germany. Treating the grand hotel as an institution and a space for the cultivation of liberal practices, the dissertation contributes to the recent body of work on liberal governance in the modern city by seeing the grand hotel as a field in which a dynamic, socially and culturally heterogeneous population tried and ultimately failed to determine the powers and parameters of liberal subjectivity. In locating the points at which liberal policies became impracticable, this dissertation also enters a conversation about the timing and causes of the crisis of German democracy. -

The Berlin Reader
Matthias Bernt, Britta Grell, Andrej Holm (eds.) The Berlin Reader Matthias Bernt, Britta Grell, Andrej Holm (eds.) The Berlin Reader A Compendium on Urban Change and Activism Funded by the Humboldt University Berlin, the Rosa Luxemburg Foundation and the Leibniz Institute for Regional Development and Structural Planning (IRS) in Erkner. An electronic version of this book is freely available, thanks to the support of libraries working with Knowledge Unlatched. KU is a collaborative initiative designed to make high quality books Open Access for the public good. The Open Access ISBN for this book is 978-3-8394-2478-0. More information about the initiative and links to the Open Access version can be found at www.knowledgeunlatched.org. This work is licensed under the Creative Commons Attribution-NonCommercial-No- Derivatives 4.0 (BY-NC-ND) which means that the text may be used for non-commer- cial purposes, provided credit is given to the author. For details go to http://creative- commons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ To create an adaptation, translation, or derivative of the original work and for commer- cial use, further permission is required and can be obtained by contacting rights@ transcript-verlag.de Creative Commons license terms for re-use do not apply to any content (such as graphs, figures, photos, excerpts, etc.) not original to the Open Access publication and further permission may be required from the rights holder. The obligation to research and clear permission lies solely with the party re-using the material. © 2013 transcript -

160223 Leitlinien Spreeufer Nördliche Luisenstadt Überarbeitung
Nördliche Luisenstadt Mehrstufiges Beteiligungsverfahren zur Spreeuferentwicklung in der Nördlichen Luisenstadt Leitlinien und Empfehlungen zur künftigen Nutzung und Gestaltung des Spreeufers Überarbeitung, Stand: 23. Februar 2016 Vorbemerkungen zur Überarbeitung Das erste Papier zu den Leitlinien und Empfehlungen wurden in der Abschlussveranstaltung des Work- shopverfahrens zur Spreeuferentwicklung am 3. Dezember 2015 vorgestellt und erörtert. Die Teilnehmer der Veranstaltung hatten dabei die Möglichkeit, Anmerkungen und Kommentare zu formulieren. Diese wurden dokumentiert und im Nachgang der Veranstaltung durch das Koordinationsbüro und das Be- zirksamt Mitte ausgewertet. Im Ergebnis einer Abwägung der geäußerten Anmerkungen und Kommentare erfolgte im Februar 2016 eine Überarbeitung des Leitlinien- und Empfehlungspapiers. Der nachfolgende Text stellt das überarbeitete Papier dar. Unterstrichene Passagen kennzeichnen die Veränderungen. Die Intentionen und Begründung des Abwägungsergebnisses zeigt eine gesonderte Abwägungstabelle. Sie enthält auch Antworten auf Fragen und Anmerkungen der Teilnehmer, die sich nicht direkt auf die künftigen Nutzung und Gestaltung des Spreeufers beziehen, sondern auf Verfahrensfragen. Vorbemerkungen Aufbauend auf den Ergebnissen der frühzeitigen Sammlung von Ideen und Vorschlägen der Bürger (Internetforum) fand bis Oktober 2015 ein mehrstufiges Beteiligungsverfahren zur Spreeuferentwicklung statt. An diesem Prozess nahmen Bewohner der Luisenstadt, Initiativen und Akteure vor Ort, Vertreter der Verwaltung -

In the Heart of Berlin
ImmobILIE des Monats ImmobILIE des Monats Köpenicker124 In the Heart of Berlin sichtigt, um anschließend ein maß- Wertzuwachs freuen können. Coole Ein schönes Zuhause ist geschneidertes individuelles Angebot Clubs und Bars entlang der Spree, ein die beste Investition unterbreiten zu können. Kinderbauernhof und andere selbst- geschaffene Oasen machen diesen Die Charlotte-Home und die IFF Mit den Projekt Partnern Charlotte- Kiez interessant und liebenswert. Die Besser Wohnen stehen seit vielen Home und der IFF Besser Wohnen Zukunftsaussichten für die Köpeni- Jahren für professionelle Entwick- wurden in den letzten Jahren Projekte cker Straße sind ohnehin hervorra- lung, Verkauf und Vermietung von wie das Hausburg Quartier realisiert gend, denn die Aufwertung dieser attraktiven Wohnimmobilien, Gewer- und das Projekt „In The Heart of Ber- zentralen Achse im Sanierungsgebiet beeinheiten und Wohnbaugrundstü- lin“ entwickelt: „Nördliche Luisenstadt“ wird noch bis cken. Auch die Projektentwicklung 2025 von der Stadt unterstützt. für private Investoren, sowie kleinere und mittelständische Bauträgergesell- Die Idee schaften,- gehört zum Firmenport- Die Lage folio. Hier berät die Charlotte-Home Wer heute als Trendsetter in die von A bis Z - bei Ankauf und Konzep- Köpenicker Straße 124 in Berlin Mit- Unweit der historischen Mitte tion der Baumaßnahmen, bis hin zum te zieht, wird mit äußerst günstigen vollzog sich im frühen 19. Jahrhun- erfolgreichen Verkauf dieser Projekte. Quadratmeterpreisen belohnt. Da es dert die zweite geplante Stadterwei- Der Aufbau eines persönlichen Ver- sich um ein Sanierungsgebiet handelt, terung Berlins rund um die heutige hältnisses zum Kunden ist das Herz- werden hier zu attraktiven Quadrat- St. Michael Kirche. Nach Plänen des stück jeder Zusammenarbeit mit der meterpreisen ca. -
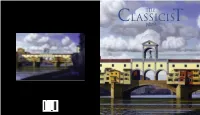
Classicist No-9
THE CLASSICIST NO-9 THE CLASSICIST o Institute of Classical Architecture & Art n 9: 2010-2011 20 West 44th Street, Suite 310, New York, NY 10036-6603 - telephone (212) 730-9646 facsimile (212) 730-9649 [email protected] WWW.CLASSICIST.ORG the classicist at large 4 Canon and Invention: The Fortuna of Vitruvius’ Asiatic Ionic Base Editor e s s a y 7 Richard John Schinkel’s Entwürfe zu städtischen Wohngebäuden: Designer Living all’antica in the New Bourgeois City Tom Maciag Dyad Communications design office Jean-François Lejeune Philadelphia, Pennsylvania Managing Editor f r o m t h e o f f i c e s 28 Henrika Dyck Taylor Printer e s s a y 49 Crystal World Printing Manufactured in China Paul Cret and Louis Kahn: Beaux-Arts Planning at the Yale Center for British Art ©2011 Institute of Classical Architecture & Art Sam Roche All rights reserved ISBN 978-0-9642601-3-9 ISSN 1076-2922 from the academies 60 Education and the Practice of Architecture Front and Back Covers David Ligare, Ponte Vecchio/ Torre Nova, 1996, Oil on Canvas, 40 x 58 inches. Private Collection, San Francisco, CA. ©D. Ligare. Michael Lykoudis This painting was created for a solo exhibition at The Prince of Wales’s Institute of Architecture in London in 1996. David Ligare described his intentions in the following terms: “The old bridge has been painted countless times by artists who have Notre Dame/Georgia Tech/Miami/Judson/Yale/College of Charleston/The ICAA utilized every style and manner of painting imaginable. I was not interested in making yet another ‘new’ view of it. -

Final Unformatted Bilbio Revised
Université de Montréal Urban planning and identity: the evolution of Berlin’s Nikolaiviertel par Mathieu Robinson Département de littératures et langues du monde, Faculté des arts et des sciences Mémoire présenté en vue de l’obtention du grade de Maîtrise ès arts en études allemandes Mars 2020 © Mathieu Robinson, 2020 RÉSUMÉ Le quartier du Nikolaiviertel, situé au centre de Berlin, est considéré comme le lieu de naissance de la ville remontant au 13e siècle. Malgré son charme médiéval, le quartier fut construit dans les années 1980. Ce dernier a été conçu comme moyen d’enraciner l’identité est-allemande dans le passé afin de se démarquer culturellement de ces voisins à l’ouest, et ce, à une époque de détente et de rapprochement entre la République démocratique allemande (RDA) et la République fédérale d’Allemagne (RFA). Depuis la construction du quartier, Berlin a connu une transformation exceptionnelle; elle est passée de ville scindée à la capitale d’un des pays les plus puissants au monde. La question se pose : quelle est l’importance de Nikolaiviertel, ce projet identitaire est-allemand, dans le Berlin réunifié d’aujourd’hui ? Ce projet part de l’hypothèse que le quartier est beaucoup plus important que laisse croire sa réputation de simple site touristique kitsch. En étudiant les rôles que joue le Nikolaiviertel dans la ville d’aujourd’hui, cette recherche démontre que le quartier est un important lieu identitaire au centre de la ville puisqu’il représente simultanément une multiplicité d’identités indissociables à Berlin, c’est-à-dire une identité locale berlinoise, une identité nationale est-allemande et une identité supranationale européenne.