Das Exemte Bistum Bamberg 3. Die Bischofsreihe Von 1522 Bis 1693
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

Hallenkreismeisterschaft 2019/20 - U19
Hallenkreismeisterschaft 2019/20 - U19 Presenter: FC Eintracht Bamberg 2010 Date: 07.12.2019 Event Location: Sporthalle Berufsschule, Ohmstraße 12-16, 96050 Bamberg Start: 09:00 Match Duration in Group Phase: 10 minutes Match Duration in Final Phase: 10 minutes Placement Mode: Points - Head-to-Head Record - Goal Difference - Amount of Goals Participants Group A Group B Live Results 1 DJK Don Bosco Bamberg 7 FC Eintracht Bamberg 2 JFG Bamberg-Süd 8 JFG Deichselb.-Regn. 3 JFG Maintal-Oberhaid 9 JFG Leitenbachtal 4 (SG) SC Kemmern 10 (SG) SV Memmelsd. 5 JFG Rauhe Ebrach Frensd. 11 1.FC Bischberg 6 JFG Steigerwald 2 Preliminary Round No. Start Gr Match Result Group A 1 09:00 A DJK Don Bosco Bamberg JFG Bamberg-Süd 1 : 0 Pl Participant G GD Pts 2 09:12 A JFG Maintal-Oberhaid (SG) SC Kemmern 3 : 0 1. DJK Don Bosco Bamberg 4 : 2 2 10 3 09:24 A JFG Rauhe Ebrach Frensd. JFG Steigerwald 2 1 : 1 2. JFG Maintal-Oberhaid 7 : 1 6 9 4 09:36 B FC Eintracht Bamberg JFG Deichselb.-Regn. 1 : 0 3. JFG Rauhe Ebrach Frensd. 5 : 3 2 8 5 09:48 A JFG Maintal-Oberhaid DJK Don Bosco Bamberg 0 : 0 4. JFG Steigerwald 2 4 : 3 1 8 6 10:00 B JFG Leitenbachtal (SG) SV Memmelsd. 0 : 1 5. JFG Bamberg-Süd 3 : 6 -3 6 7 10:12 A JFG Steigerwald 2 JFG Bamberg-Süd 0 : 1 6. (SG) SC Kemmern 1 : 9 -8 0 8 10:24 A (SG) SC Kemmern JFG Rauhe Ebrach Frensd. -
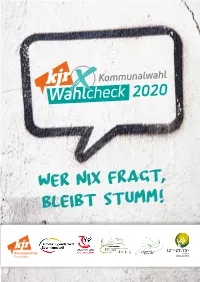
Wer NIX Fragt, Bleibt Stumm!
Kommunalwahl Wahlcheck 2020 WER NIX FRAGT, BLEIBT STUMM! Kreisjugendring Forchheim 2 Kommunalwahl Wahlcheck 2020 Die Landrats- und Bürgermeisterkandidat/-innen standen wieder im Mittelpunkt des „Wahlchecks zur Kommunalwahl 2020“, einer Aktion, die der Kreisjugend- ring Forchheim – vertreten durch den amtierenden Vorsitzenden Thomas Wil- fling – zusammen mit den Kommunalen Jugendpflegerinnen Ursula Albuschkat und Stefanie Schmitt initiiert hat. Die Kandidatinnen und Kandidaten wurden mit einem persönlichen Brief ein- geladen, an der Befragung teilzunehmen. Hierfür wurden unter Beteiligung von Kindern und Jugendlichen Fragen gesammelt, die diese den Lokalpolitiker/-in- nen stellen wollten. Ebenfalls beteiligt waren die Delegierten der KJR-Vollver- sammlung als Vertreter/-innen der Vereine und Verbände. Zusammengekommen sind eine Vielzahl von Fragen, die Kinder und Jugendliche sowie Vereins- und Verbandsvertreter unseres Landkreises aktuell beschäftigen. Gemeinsam mit den Gemeindejugendpfleger/-innen der Städte und Gemeinden Ebermannstadt, Eggolsheim, Gräfenberg, Weißenohe, Hausen, Heroldsbach und Hallerndorf wurden acht Fragen ausgewählt, die stellvertretend für die vielen jungen Menschen im Landkreis Forchheim gestellt werden sollen. Bis Donnerstag, den 27. Februar 2020 bestand die Möglichkeit, die ausgefüll- ten Fragebögen an den KJR zurückzusenden. Die Ergebnisse aller Fragebögen wurden ungefiltert – also auch ohne Korrekturen – abgedruckt und sind seit dem 02. März 2020 unter www.kjr-forchheim.de der interessierten Öffentlich- keit zugänglich. Im Nachgang der Kommunalwahl 2020 möchten der Kreisjugendring und die Kommunalen Jugendpflegerinnen mit den gewählten Bürgermeister/-innen ins Gespräch kommen. Hierzu sind Besuche vor Ort geplant, um gemeinsam das The- ma Kinder und Jugendliche sowie die Jugendarbeit vor Ort zu beleuchten. Der Kreisjugendring und die Kommunalen Jugendpflegerinnen bedanken sich für die Unterstützung und freuen sich auf interessante Gespräche mit den zukünfti- gen Bürgermeisterkandidat/-innen und Landrat. -

Festsitzung Zur Bürgermedaillenverleihung
Jahrgang 35 Mittwoch, den 10. September 2014 Nummer 9 Festsitzung zur Bürgermedaillenverleihung Zusammen mit den Ehrengästen stellten sich die sechs neuen Marktleugaster Bürgermedaillen- träger der Kamera. Unser Bild zeigt (von links) Franz Gareis, Reinhold und Renate Scheunert, Irene Daig, Marianne und Walter Stanka, Rita Uome, 2. Bürgermeister Reiner Meisel, Bürgermeister Franz Uome, Landrat Klaus Peter Söllner, Kornelia und Norbert Volk, Landtagsabgeordneten Martin Schöffel, Susanne und Owald Purucker sowie Landtagsvizepräsidentin Inge Aures. Mitteilungsblatt Marktleugast und Grafengehaig - 2 - Nr. 9/14 25-jährige Gemeindepartnerschaft Festsitzung zur Bürgermedaillenverleihung Oswald Purucker, Franz Uome und Norbert Volk wurden mit der Goldenen Bürgermedaille ausgezeichnet Marianne Stanka, Franz Gareis und Reinold Scheunert bekamen die Silberne Bürgermedaille Gleich sechs Personen zeichnete der Marktgemeinderat zog 1962 nach Mannsflur in den neu gebauten Bungalow. Er Marktleugast in seiner Festsitzung am Sonntagmorgen, 31.8. besuchte die Grund- und Hauptschule. 1968 wechselte er in im Bürgersaal mit Bürgermedaillen aus. Oswald Purucker, die Realschule nach Kulmbach, die 1972 mit der mittleren Franz Uome und Norbert Volk wurden mit der Goldenen aus- Reife abschloss. Es folgte die Ausbildung zum Industriekauf- gezeichnet, Marianne Stanka, Franz Gareis und Reinhold mann bei der Firma WABAC in Kulmbach. Von 1985 bis 2002 Scheunert empfingen die Silberne Bürgermedaille. „Ihr Tun war er als Büroleiter bei der Fahnenfabrik Meinel in Marktleu- und Handeln ist wahrer Bürgersinn. Alle setzten sich ihr Leben gast und war dann bis 2013 bei der Sparkasse Kulmbach- lang selbstlos für ihre Mitmenschen und Heimatgemeinde Kronach tätig, zuletzt als Leiter der Geschäftsstelle in Press- ein. Hier und heute wollen wir Ihnen dafür danken, dass sie eck. 1976 heirate er seine Rita, die Ehe war mit zwei Kindern stets eigene Interessen hintan stellten“, betonte Bürgermeister gesegnet. -

Mitteilungsblatt
MITTEILUNGSBLATT GEMEINDE STEGAURACH | LANDKREIS BAMBERG Schloßplatz 1 | 96135 Stegaurach | www.stegaurach.de | [email protected] | Tel.: 0951-99 222-0 Öffnungszeiten: Mo. – Fr.: 8.00 – 12.00 Uhr, Do.: 14.00 – 18.00 Uhr 1. Oktober 2015 Nr. 10/2015 Herbstblick Du bist fast alle Tage Mir in den Augen nah - Gehst lächelnd dann vorüber: Jedoch, so warst du da. Das Glück, es ist ein stilles Und steht ganz kurz vor mir:. Das Strahlen dieses Schauens Kommt, kommt alleinvon von „Gerhard dir Schmidt“ Kirchliche Nachrichten Seite 15 Vereine Seite 22 Bei uns in der Gemeinde Seite 14 Senioren und Jugend Seite 19 2 Infotafel Infotafel Notrufnummern Kliniken Feuer-Notruf .......................................................................... 112 Einrichtungen im Landkreis Bamberg Polizei-Notruf ........................................................................ 110 Juraklinik Scheßlitz ........................................... 09542 779-0 Unfall-Rettungsdienst-Notruf .......................................... 112 Steigerwaldklinik Burgebrach ..........................09546 88-0 Polizei Bamberg-Land .................................0951 9129 310 Seniotel Pflegedienst Scheßlitz gGmbH ... 09542 779-0 Ärztlicher Notfallruf .....................................................116 117 Klinik am Eichelberg Burgebrach ..............09546 88-510 Giftnotruf ....................................................................030 19240 Giftzentrale Nürnberg .................................... 0911 3982451 Kliniken in der Stadt Bamberg Klinikum -

Blätter Zur Flora Nordbayerns
Blätter zur Flora Nordbayerns Nr. 2 (Juli 2005) Inhalt in Stichworten Vorbemerkungen ·················································································· 1 Zur Diskussion gestellt: Darstellungsweisen, Naturräume, Abkürzungen ·································· 2 Über Hohlzähne (Galeopsis) am Westrand der Böhmischen Masse ··· 17 Galeopsis in der „Ergänzungsflora von Nordostbayern“ ······················ 42 Geplante Untersuchungen für 2005 und Folgejahre ··························· 45 Myriophyllum alterniflorum ···································································· 45 Avena-Sippen ················································································· 46 Für Nordostbayern einschlägige floristische Arbeiten ························· 47 Calystegia sepium agg. ··································································· 47 Euphorbia virgata und E. x pseudovirgata ······································ 47 Senecio velenovskyi ·············································································· 48 Pilularia globulifera ················································································· 49 Plantago coronopus ··············································································· 50 Sedum oppositifolium ············································································ 50 Kapitel “Botanique” (Camille de Tournon) ······································· 51 Potamogeton berchtoldii und Potamogeton pusillus ······················· 52 1 Vorbemerkungen Die Nr. 1 dieser -

Medtech Companies
VOLUME 5 2020 Medtech Companies Exclusive Distribution Partner Medtech needs you: focused partners. Medical Technology Expo 5 – 7 May 2020 · Messe Stuttgart Enjoy a promising package of benefits with T4M: a trade fair, forums, workshops and networking opportunities. Discover new technologies, innovative processes and a wide range of materials for the production and manufacturing of medical technology. Get your free ticket! Promotion code: MedtechZwo4U T4M_AZ_AL_190x250mm_EN_C1_RZ.indd 1 29.11.19 14:07 Medtech Companies © BIOCOM AG, Berlin 2020 Guide to German Medtech Companies Published by: BIOCOM AG Luetzowstrasse 33–36 10785 Berlin Germany Tel. +49-30-264921-0 Fax +49-30-264921-11 [email protected] www.biocom.de Find the digital issues and Executive Producer: Marco Fegers much more on our free app Editorial team: Sandra Wirsching, Jessica Schulze in the following stores or at Production Editor: Benjamin Röbig Graphic Design: Michaela Reblin biocom.de/app Printed at: Heenemann, Berlin Pictures: Siemens (p. 7), Biotronik (p. 8), metamorworks/ istockphoto.com (p. 9), Fraunhofer IGB (p. 10) This book is protected by copyright. All rights including those regarding translation, reprinting and reproduction reserved. tinyurl.com/y8rj2oal No part of this book covered by the copyright hereon may be processed, reproduced, and proliferated in any form or by any means (graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or via information storage and retrieval systems, and the Internet). ISBN: 978-3-928383-74-5 tinyurl.com/y7xulrce 2 Editorial Medtech made in Germany The medical technology sector is a well-established pillar within the healthcare in- dustry in Germany and one of the major drivers of the country’s export-driven eco- nomic growth. -

111 Fränkische Biergärten
111 fränkische Biergärten 1 Herrmann-Keller und Max-Keller | Ampferbach (Burgebrach) So wild wie damals wird's nie mehr | 10 2 Biergärten in der Wunderburg | Bamberg Zwei starke Charaktere am Hahn | 12 3 Brauerei Greifenklau | Bamberg Jedes Seidlafrisch gezwickelt | 14 4 Spezial-Keller (= Spezi-Keller) | Bamberg Womöglich der schönste der Welt | 16 5 Wilde Rose Keller | Bamberg Augenweide mit Davidsternen | 18 6 Herzogkeller | Bayreuth Erbe preußischer Tugenden | 20 7 Lamperie | Bayreuth Für die Generation Smartphone upgedatet | 22 8 Waldschänke Bayrische Schanz | Bayrische Schanz (Lohr-Ruppertshütten) Der Nervenkitzel\ unter die Räuber zufallen | 24 9 Schuhmannskeller | Bischberg Wo meine Sonne scheint | 26 10 Schwanenkeller (= Schwanakeller) | Burgebrach Wo das Wetter noch entscheidend ist | 28 11 Löwenbräu Keller | Buttenheim Bis zum Jahr 1900fremdbekocht | 30 12 St. GeorgenBräu Keller | Buttenheim Sein mythischer Ruf kam mit der Eisenbahn | 32 13 Hiller Keller | Dörfleins (Hallstadt) Das erste Bockbier der Saison | 34 14 Brauerei Göller | Drosendorf (Memmelsdorf) Wo Regen die Stimmung nicht verwässert | 36 15 Fritz Popps wetterfeste Bierbank | Dürrnbuch (Emskirchen) So weit aus der Norm fällt kein Zweiter | 38 16 Schwanenkeller | Ebermannstadt Wo sich so manches Treibgut sammelt | 40 17 Wiesent-Garten | Ebermannstadt Am Anfang kamen die Franzosen | 42 18 Maintalhof Bauernhofcafe | Erlach (Neustadt am Main) Nur mal kurz die Welt retten | 44 19 Entla’s Keller | Erlangen Platz, für 60.000 Einheiten | 46 20 Gasthaus zum Fiedler in der -

BA KL 1 / Kreis Bamberg/Bayreuth Meisterschaft | Herren | Kreisliga | Kreis Bamberg/Bayreuth Liganummer: 310078 Saison: 17/18
Aktuelle Terminliste: BA KL 1 / Kreis Bamberg/Bayreuth Meisterschaft | Herren | Kreisliga | Kreis Bamberg/Bayreuth Liganummer: 310078 Saison: 17/18 Seite 1 von 8 Stand: Freitag, 14.Juli 2017 Sp-Nr. Datum Anstoß Spielpaarung Ergeb. 1. Spieltag 1 28.07.17 19:00 TSV Hirschaid - ASV Sassanfahrt Sportanlage Hirschaid, Platz 1,Alleestr. 2,96114 Hirschaid 2 29.07.17 15:00 SpVgg Stegaurach - SpVgg Rattelsdorf Sportanlage Stegaurach, Platz 1,Mühlendorfer Str. 11,96135 Stegaurach 3 29.07.17 14:00 TSV Schlüsselfeld - ASV Naisa Sportanlage Schlüsselfeld, Platz 1,Grabengrundstr.,96132 Schlüsselfeld 4 30.07.17 15:00 FSV Unterleiterbach - FSV Phönix 1921 Buttenheim Sportanlage Unterleiterbach, Platz 1,Unterbrunner Weg 2,96199 Unterleiterbach 5 30.07.17 15:00 SV 1928 DJK Tütschengereuth - TSV Windeck 1861 Burgebrach Sportanlage Tütschengereuth, Platz 1,Tütschengereuther Hauptstr. 100,96120 Bischberg 6 29.07.17 18:00 DJK Stappenbach - DJK Teutonia Gaustadt Sportanlage Stappenbach, Platz 1,Weißenweg,96138 Stappenbach 7 30.07.17 17:00 SV Eintracht Ober-Unterharnsbach - SC Reichmannsdorf Sportanlage Oberharnsbach,Oberharnsbach; Walsdorfer Str.,96138 Burgebrach 8 30.07.17 15:00 SV Zapfendorf - SC Kemmern Sportanlage Zapfendorf, Platz 1,Hauptstraße 45,96199 Zapfendorf 2. Spieltag 9 06.08.17 15:00 SC Reichmannsdorf - DJK Stappenbach Sportanlage Reichmannsdorf, Platz 1,Brennender Stock 1,96132 Reichmannsdorf 10 06.08.17 15:00 DJK Teutonia Gaustadt - SV 1928 DJK Tütschengereuth Sportanlage Gaustadt, Platz 1,Badstr. 19,96049 Bamberg 11 06.08.17 17:00 TSV Windeck 1861 Burgebrach - FSV Unterleiterbach Sportanlage Windeck, Platz 1,Bamberger Str. 40,96138 Burgebrach 12 06.08.17 15:00 FSV Phönix 1921 Buttenheim - TSV Schlüsselfeld Sportanlage Buttenheim, Platz 1,Straße zum Sportplatz,96155 Buttenheim 13 06.08.17 15:00 ASV Naisa - SpVgg Stegaurach Sportanlage Naisa, Platz 2,Am Wetterkreuz 50,96123 Litzendorf 14 06.08.17 15:00 SpVgg Rattelsdorf - SV Zapfendorf Sportanlage Rattelsdorf, Platz 1,Ferdinand-Tietz-Str. -

Februarausgabe 2019
46. Jahrgang • Nummer 1 • 1. Februar 2019 Mitteilungsblatt der Gemeinde Breitengüßbach Breitengüßbach s Hohengüßbach s Leimershof s Unteroberndorf s Zückshut Kirchplatz 4, 96149 Breitengüßbach Publikumsverkehr: Telefon 0 95 44 92 23-0 • Fax 0 95 44 92 23-55 Montag - Freitag: 8:00 - 12:00 Uhr www.breitenguessbach.de Donnerstag zusätzlich: 13:30 - 18:00 Uhr Gemeinde Breitengüßbach 2 Amtliche Bekanntmachungen Sachgebiete im Rathaus: Das nächste Mitteilungsblatt Bürgermeisterin: Anzeigenschluss für die Märzausgabe: Frau Sigrid Reinfelder ...................................... Tel. 92 23-10 Mittwoch, 13. Februar 2019 [email protected] Erscheinungstermin der Märzausgabe: Sekretariat: Freitag, 1. März 2019 Frau Oxana Mayer ............................................. Tel. 92 23-0 Anzeigenannahme für Nachrichten von Behörden, Ver- einsnachrichten und Veranstaltungen: Frau Dirauf [email protected] Anzeigenannahme für Kleinanzeigen, Danksagungen und Geschäftsstellenleiter, Bauleitplanung: Werbung: Frau Hatzold� Werbungsanzeigen können fol- Herr Stefan Neubauer ..................................... Tel. 92 23-11 gende Größen aufweisen: [email protected] In Spaltenbreite (90 mm) können die Höhen 30, 60, 130 oder 260 mm betragen. In Seitenbreite (185 mm) sind Kämmerei, Standesamt: Höhen von 30, 60 und 130 mm oder ganze Seite möglich. Herr Christoph J. G. Hetzel ............................. Tel. 92 23-12 [email protected] Bauamt: Herr Markus Schmitt ....................................... -

Stadt - Land - Fluss Eine Genusstour Im Bamberger Land Seite 1 Genussregion Oberfrankenseite 3
Stadt - Land - Fluss eine Genusstour im Bamberger Land Seite 1 Genussregion OberfrankenSeite 3 Inhaltsverzeichnis Landkreis Bamberg Seite 3 Spezialitätenvielfalt im Bamberger Land Seite 7 Ausflugsziele quer durchs Land Seite 9 Radregion Bamberger Land - rund herum radelbar Seite 13 Erlebnistour Stadt - Land - Fluss Seite 15 Infos zur Tour Seite 16 Kultur- und Naturgenuss an Regnitz, Aurach und Rauher Ebrach Seite 18 Unsere Tourenkarte Seite 19 Radeln und Genießen auf der Stadt-Land-Fluss-Tour Seite 20 Infos: Karpfenzucht im Bamberger Land Seite 21 Auf den Spuren der Aurachochsen Seite 24 Nachhaltiger Landkreis - „Region Bamberg, weil‘s mich überzeugt!“ Seite 25 Weitere Informationen zur Tour Seite 27 Das könnte Sie interessieren! Seite 28 Impressum und Fotonachweis Seite 30 Blick zur Altenburg Mohnfeld bei Feigendorf Seite 3 Genussregion Oberfranken Landkreis Bamberg Im Westen des Regierungsbezirks Oberfranken liegt der Landkreis Bamberg. Auf einer Gesamtfläche von 1.168 qkm, in 36 Gemeinden gegliedert, leben hier 144.296 Menschen (Stand 30. Juni 2012). Eindrucksvoll ist die Vielfalt kultureller Sehenswürdigkeiten und typischer Landschaftsformen, die die Region prägen. Zentrum ist die kreisfreie Stadt Bamberg, die als Idealtyp der auf frühmittelalterlicher Grundstruktur entwickelten mitteleuropäischen Stadt 1993 von der UNESCO zum Weltkulturerbe erklärt wurde. Gleich drei Naturparks zeichnen den Landkreis aus und bieten mit dem Schutz von Lebensräumen auch ideale Erholungsräume für Einheimische und Gäste. Im Westen des Landkreises fasziniert das wechselhafte Landschaftsbild des Steigerwaldes mit alten Buchenwäldern, kleinstrukturierten Wiesen- und Ackerflächen, idyllischen Bachtälern, zahlreichen Karp- fenweihern sowie den zum Maintal hin abfallenden Steilhängen. Als kultureller Mittelpunkt beeindrucken Kloster Ebrach und das fürstbischöflichen Sommerschloss Weißenstein bei Pommersfelden. Im Norden streifen die Ausläufer der lieblichen Hassberge den Landkreis, die das Maintal mit wärmelieben- den Eichen-Hainbuchenwäldern und alten Weinberglagen säumen. -

Die Historische Kultur- Landschaft Von Kemmern
DIE HISTORISCHE KULTUR- LANDSCHAFT VON KEMMERN Thomas Gunzelmann Einleitung Die Vorgaben des Naturraums Die Kulturlandschaft ist das sichtbare Ergebnis der Ausei - Die Gemarkung Kemmern ist großräumig dem Fränkisch- nandersetzung des Menschen mit dem von der Natur vor - Schwäbischen Schichtstufenland und genauer dessen Un - gegebenen Raum im Verlauf der Geschichte. Je weiter man tereinheit des Fränkischen Keuperberglandes zuzuordnen. zeitlich zurückgeht, desto stärker war eine Dorfgemeinde Auf lokaler Ebene erstreckt sich das Gemeindegebiet über wie Kemmern auf die lokalen Ressourcen angewiesen und zwei Naturräume: Im kleineren westlichen Teil sind dies die desto intensiver war auch die kleinräumige Gestaltung der südlichen Haßberge, im größeren östlichen der Talraum des Landschaft durch die Landnutzung fast aller Einwohner. Obermains. (Abb. 1) Der tiefste Punkt des Gemeindegebietes Heute ist diese enge Bindung der materiellen Lebensgrund - liegt beim Austritt des Maines aus diesem bei etwa 235 m, lagen an die überschaubare Gemarkung eines Ortes weit - der höchste Punkt liegt bei 380 m auf dem Semberg im Be - gehend aufgehoben und durch supranationale Wirtschafts - reich des „Wiesenthauer Schlages“. Morphologisch ist das kreisläufe mit den Tendenzen zur Konzentration bis hin Areal deutlich in zwei gegensätzliche Teile geteilt und dies zur Monopolisierung ersetzt. Dennoch lassen sich die Zeug - entlang einer geologischen Störungslinie, dem Talrandbruch nisse der historischen Nutzung dieses Raumes durch Land - am westlichen Rand des Maintales, der sehr geradlinig von wirtschaft, Gewerbe, Verkehr und auch durch Erholungs - Nordnord-West nach Südsüd-Ost verläuft. Westlich dieser funktionen immer an bestimmten landschaftlichen Merk - Linie steigt das Bergland der Südlichen Haßberge, hier im malen – sowohl einzelnen Elementen wie auch größeren Bereich des Höhenzuges des Sembergs, steil um bis zu 140 Strukturen – ablesen, in Kemmern sogar weit stärker als in Höhenmeter auf einer Entfernung von 800 m an, während vielen Nachbarorten. -

Mitteilungsblatt Nr. 39 Vom 26.09.2019
Mitteilungsblatt Nummer 39 vom 26.09.2019 MITTEILUNGSBLATT der Verwaltungsgemeinschaft Burgebrach und der Mitgliedsgemeinden Markt Burgebrach und Schönbrunn i. Steigerwald JAHRGANG 42, Donnerstag, 26.09.2019 MARKT BURGEBRACH ZU IHRER INFORMATION Ansprechende Planung für Baulücke im Burgebra- cher Ortskern vorgestellt In der vergangenen Marktgemeinderatssitzung wurde von Architekt Thomas Drescher, Bamberg, die Planung für das Grundstück Hauptstraße 24 (Metznerhaus) vor- gestellt und vom Gremium einstimmig gebilligt. Unter der Bauträgerschaft der Gemeinnützigen Wohnungsbaugenossenschaft des Landkreises Bam- berg (GEWO-Bau) und in enger Abstimmung mit der Abteilung Städtebauförderung der Regierung von Oberfranken entstehen im Herzen von Burgebrach 6 neue Wohneinheiten. Baubeginn ist für Frühjahr 2020 geplant. Die Maßnahme unterstreicht, dass uns Wiederbele- bung von Baulücken im Altbestand ebenso wichtig ist wie Neuerschließungen. Dies gilt übrigens für alle Teile unserer Gemeinde. So freue ich mich, dass in einem weiteren Projekt im Rahmen der Dorferneuerung in Dippach ein dortiger Leerstand beseitigt und an gleicher Stelle das Dippacher Dorfgemeinschaftshaus entstehen wird. Ich bin überzeugt, dass beide Projekte zusätzliche Lebensqualität in unsere Orte bringen. Johannes Maciejonczyk 1. Bürgermeister Markt Burgebrach NACHDENKENSWERT Vergiss all die Gründe, warum du scheitern könntest und konzentriere dich auf den einen Grund, warum du es schaffen kannst. 1 Mitteilungsblatt Nummer 39 vom 26.09.2019 GEMEINDE SCHÖNBRUNN I. STEIGERWALD FUNDSACHEN Folgende Gegenstände wurden im Fundbüro der VG BEKANNTMACHUNG Burgebrach abgegeben: über die frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit (§ 3 Abs. blaue Brille 1 BauGB) zur Autoschlüssel 6. Änderung des Flächennutzungs- und Landschaftspla- Digitalcamera nes in Schönbrunn i. Steigerwald, Erweiterung Kinder- Nähere Auskünfte erhalten Sie im Rathaus Burgebrach, garten in Schönbrunn i. Steigerwald Zi. Nr. 06, Telefon 09546 / 9416 40.