I. Allgemeine Ortsgeschichte
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

Aufteilung Gemeinden Niederösterreich
Gemeinde Förderbetrag Krems an der Donau 499.005 St. Pölten 1.192.215 Waidhofen an der Ybbs 232.626 Wiener Neustadt 898.459 Allhartsberg 38.965 Amstetten 480.555 Ardagger 64.011 Aschbach-Markt 69.268 Behamberg 60.494 Biberbach 41.613 Ennsdorf 54.996 Ernsthofen 39.780 Ertl 23.342 Euratsfeld 48.110 Ferschnitz 31.765 Haag 101.903 Haidershofen 66.584 Hollenstein an der Ybbs 31.061 Kematen an der Ybbs 47.906 Neuhofen an der Ybbs 53.959 Neustadtl an der Donau 39.761 Oed-Oehling 35.097 Opponitz 18.048 St. Georgen am Reith 10.958 St. Georgen am Ybbsfelde 51.812 St. Pantaleon-Erla 47.703 St. Peter in der Au 94.276 St. Valentin 171.373 Seitenstetten 61.882 Sonntagberg 71.063 Strengberg 37.540 Viehdorf 25.230 Wallsee-Sindelburg 40.446 Weistrach 40.557 Winklarn 29.488 Wolfsbach 36.226 Ybbsitz 64.862 Zeillern 33.838 Alland 47.740 Altenmarkt an der Triesting 41.057 Bad Vöslau 219.013 Baden 525.579 Berndorf 167.262 Ebreichsdorf 199.686 Enzesfeld-Lindabrunn 78.579 Furth an der Triesting 15.660 Günselsdorf 32.320 Heiligenkreuz 28.766 Hernstein 28.192 Hirtenberg 47.036 Klausen-Leopoldsdorf 30.525 Kottingbrunn 137.092 Leobersdorf 91.055 Mitterndorf an der Fischa 45.259 Oberwaltersdorf 79.449 Pfaffstätten 64.825 Pottendorf 125.152 Pottenstein 54.330 Reisenberg 30.525 Schönau an der Triesting 38.799 Seibersdorf 26.619 Sooß 19.511 Tattendorf 26.674 Teesdorf 32.727 Traiskirchen 392.653 Trumau 67.509 Weissenbach an der Triesting 32.005 Blumau-Neurißhof 33.690 Au am Leithaberge 17.474 Bad Deutsch-Altenburg 29.599 Berg 15.938 Bruck an der Leitha 145.163 Enzersdorf an der Fischa 57.236 Göttlesbrunn-Arbesthal 25.915 Götzendorf an der Leitha 39.040 Hainburg a.d. -

Hadersdorf Ortsreportage Ab Seite10 Seite 3/Foto: Brandt Wegen Um- Wegen an Treue Tips-Leser
Krems Ortsreportage Hadersdorf ab Seite 10 Februar 2019 / www.tips.at Eschensterben Wegen um- fangreicher Baumfällarbeiten ist der beliebte Naturlehrpfad im Kremser Reisperbachtal noch bis Ende März Glücksengerl Die Glücksengerl fl iegen wieder und verschenken Fussl-Gutscheine im Gesamtwert von 31.200 Euro Seite 3 / Foto: Brandt Seite 25 / Foto: Jakob Hauer NÖ 187.653 Stk. | Gesamt 872.600 Stk. | Redaktion +43 (0)27 32 / 742 42 gesperrt. an treue Tips-Leser. Im Bild: Tips-Geschäftsführer Josef Gruber und Glücksengerl Anna Mayrhofer. Rastenfeld setzt auf mehr Gastro Große Veränderungen kündigen sich im Ortskern von Rastenfeld B 37 wird sicherer Plan auf Eis gelegt Gratisangebot an. Mit der Eröffnung des neuen Die Bauarbeiten bei Stratzing Der Kreisverkehr in Lerchenfeld Jungfamilien erhalten kostenloses Österreichische Post AG | RM 11A038822K | 4010 Linz age |Krems Aufl Nahversorgerzentrums 41.219 Stk. | Mitte Fe- gehen weiter. >> Seite 4 kommt vorerst nicht. >> Seite 15 Babykochbuch. >> Seite 22 bruar werden einige Immobilien Ortschef im Porträt Neuer Vorstand Jubiläumsschau in bester Lage frei. Alle gehören Schönberg hat seit Kurzem einen Die Gedesag vollzieht einen Das Karikaturmuseum zeigt eine der Marktgemeinde und die hat neuen Bürgermeister. >> Seite 5 Generationenwechsel. >> Seite 17 neue Deix-Ausstellung. >> Seite 35 für sie bereits etliche Pläne. Die Bevölkerung darf sich unter an- Große Pläne Riesiger Erfolg Viele Stars zu Gast derem auf ein größeres Gastrono- Das Mauterner Schloss soll ein Tips-Aktion brachte 45.700 Euro Die Wachau Bühne präsentiert ihr mieangebot freuen. Seite 2 Hotel werden. >> Seite 7 für schwerkranke Frau. >> Seite 21 Frühjahrsprogramm. >> Seite 36 2 Regionales Land & Leute Krems Februar 2019 ORtSKeRnBeLeBunG Nahversorgerzentrum eröffnet der Gemeinde viele weitere Chancen RaStenFeLd. -

PDF-Dokument
Bundesland Niederösterreich Kurztitel Europaschutzgebiete Kundmachungsorgan LGBl. 5500/6-6 §/Artikel/Anlage § 15 Inkrafttretensdatum 01.01.2015 Beachte Bei vor dem 1.1.2015 geänderten Rechtsvorschriften wird als Inkrafttretensdatum der Erfassungsstichtag 1.1.2015 angegeben. Text § 15 Europaschutzgebiet Vogelschutzgebiet Wachau - Jauerling (1) 1. Das Europaschutzgebiet umfasst die in den Anlagen 1 bis 21 zu § 15 ausgewiesenen Grundstücke und Grundstücksteile in Aggsbach, Bergern im Dunkelsteinerwald, Dürnstein, Dunkelsteinerwald, Emmersdorf an der Donau, Krems an der Donau, Leiben, Maria Laach am Jauerling, Mautern an der Donau, Melk, Mühldorf, Raxendorf, Rossatz-Arnsdorf, Schönbühel- Aggsbach, Senftenberg, Spitz, Weinzierl am Walde, Weißenkirchen in der Wachau und Weiten. In Anlage A zu § 15 ist das Europaschutzgebiet auf einem Übersichtsplan dargestellt. 2. Die Anlagen 1 bis 21 zu § 15 (LGBl. 5500/6–3) werden durch Auflage beim Amt der NÖ Landesregierung zur öffentlichen Einsichtnahme kundgemacht. Die öffentliche Einsichtnahme kann während der Amtsstunden beim Amt der NÖ Landesregierung, Abteilung Landesamtsdirektion, erfolgen. Diese Anlagen werden zur Information auch bereitgehalten bei: - der Bezirkshauptmannschaft Krems an der Donau - der Bezirkshauptmannschaft Melk - der Stadt Krems an der Donau - der Marktgemeinde Aggsbach - der Gemeinde Bergern im Dunkelsteinerwald - der Stadtgemeinde Dürnstein - der Marktgemeinde Dunkelsteinerwald - der Marktgemeinde Emmersdorf an der Donau - der Marktgemeinde Leiben - der Marktgemeinde Maria -
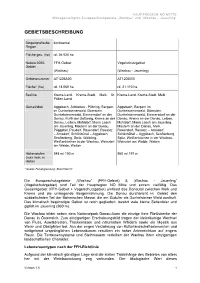
Gebietsbeschreibung
HAUPTREGION NÖ MITTE Managementplan Europaschutzgebiete „Wachau“ und „Wachau - Jauerling“ GEBIETSBESCHREIBUNG Biogeografische kontinental Region Fläche ges. (ha) rd. 26.520 ha Natura 2000- FFH-Gebiet Vogelschutzgebiet Gebiet (Wachau) (Wachau - Jauerling) Gebietsnummer AT1205A00 AT1205000 Fläche* (ha) rd. 18.060 ha rd. 21.110 ha Bezirke Krems-Land, Krems-Stadt, Melk, St. Krems-Land, Krems-Stadt, Melk Pölten-Land Gemeinden Aggsbach, Artstetten - Pöbring, Bergern Aggsbach, Bergern im im Dunkelsteinerwald, Dürnstein, Dunkelsteinerwald, Dürnstein, Dunkelsteinerwald, Emmersdorf an der Dunkelsteinerwald, Emmersdorf an der Donau, Furth bei Göttweig, Krems an der Donau, Krems an der Donau, Leiben, Donau, Leiben, Mühldorf, Maria Laach Mühldorf, Maria Laach am Jauerling, am Jauerling, Mautern an der Donau, Mautern an der Donau, Melk, Pöggstall, Paudorf, Raxendorf, Rossatz Raxendorf, Rossatz – Arnsdorf, – Arnsdorf, Schönbühel – Aggsbach, Schönbühel – Aggsbach, Senftenberg, Senftenberg, Spitz, Wölbling, Spitz, Weißenkirchen in der Wachau, Weißenkirchen in der Wachau, Weinzierl Weinzierl am Walde, Weiten am Walde, Weiten Höhenstufen 948 m/ 190 m 960 m/ 197 m (max./min. m Höhe) * Quelle: Feinabgrenzung, Stand Mai 07 Die Europaschutzgebiete „Wachau” (FFH-Gebiet) & „Wachau - Jauerling” (Vogelschutzgebiet) sind Teil der Hauptregion NÖ Mitte und extrem vielfältig. Das Gesamtgebiet (FFH-Gebiet + Vogelschutzgebiet) umfasst das Donautal zwischen Melk und Krems und die umliegende Bergeinrahmung. Die Donau durchbricht im Gebiet den südöstlichsten Teil der Böhmischen Masse, die am Südufer als Dunkelsteiner Wald ausläuft. Das klimatisch begünstigte Gebiet ist reich gegliedert, besitzt viele kleine Seitentäler und gipfelt im Jauerling (960 m). Die Wachau bildet neben dem Nationalpark Donau-Auen die einzige freie Fließstrecke der Donau in Österreich. Zum einzigartigen Erscheinungsbild tragen der kleinräumige Wechsel von Fluss, Auwaldresten, Trockenrasen und naturnahen Wäldern sowie ein Mosaik aus Wein- und Obstgärten bei. -
PDF-Dokument
Bundesland Niederösterreich Kurztitel Europaschutzgebiete Kundmachungsorgan LGBl. 5500/6-6 §/Artikel/Anlage § 24 Inkrafttretensdatum 01.01.2015 Beachte Bei vor dem 1.1.2015 geänderten Rechtsvorschriften wird als Inkrafttretensdatum der Erfassungsstichtag 1.1.2015 angegeben. Text § 24 Europaschutzgebiet FFH-Gebiet Wachau (1) 1. Das Europaschutzgebiet umfasst die in den Anlagen 1 bis 29 zu § 24 ausgewiesenen Grundstücke und Grundstücksteile in Aggsbach, Artstetten-Pöbring, Bergern im Dunkelsteinerwald, Dürnstein, Dunkelsteinerwald, Emmersdorf an der Donau, Furth bei Göttweig, Krems an der Donau, Leiben, Maria Laach am Jauerling, Mautern an der Donau, Mühldorf, Paudorf, Pöggstall, Raxendorf, Rossatz-Arnsdorf, Schönbühel-Aggsbach, Senftenberg, Spitz, Weinzierl am Walde, Weißenkirchen in der Wachau, Weiten und Wölbling. In Anlage A zu § 24 ist das Europaschutzgebiet auf einem Übersichtsplan dargestellt. 2. Die Anlagen 1 bis 29 zu § 24 (LGBl. 5500/6–5) werden durch Auflage beim Amt der NÖ Landesregierung zur öffentlichen Einsichtnahme kundgemacht. Die öffentliche Einsichtnahme kann während der Amtsstunden beim Amt der NÖ Landesregierung, Abteilung Landesamtsdirektion, erfolgen. Diese Anlagen werden zur Information auch bereitgehalten bei: - der Bezirkshauptmannschaft Krems an der Donau - der Bezirkshauptmannschaft Melk - der Bezirkshauptmannschaft St. Pölten - der Stadt Krems an der Donau - der Marktgemeinde Aggsbach - der Marktgemeinde Artstetten-Pöbring - der Gemeinde Bergern im Dunkelsteinerwald - der Stadtgemeinde Dürnstein - der Marktgemeinde -

Rohrendorf Jubelt Nach Derby-Sieg
Ortsporträt: Termindebatte: Senftenberg Die Kremser im Blickpunkt müssen im Herbst Seite 10 bis 15 wahrscheinlich zwei Mal wählen gehen Krems Seite 19 Rohrendorf jubelt 30 x in NÖ und OÖ DO, 1. Juni 2017 / KW 22 Redaktion: +43 (0)27 32 / 742 42 www.tips.at nach Derby-Sieg NÖ 347.064 Stk. | Gesamt 1.021.906 Stk. Profiler Kriminalpsychologe und Autor Thomas Müller erklär- te in der Kremser Stadtbücherei, dass jeder Mensch zum Mörder werden kann. Seite 2 Geheimnis gelüftet KREMS. Erwin Krammer ist neuer Spitzenkandidat der Volkspartei. >> Seite 3 Chudik Foto: Trotz Pausenführung des SC Steinertor Krems Neues Museum drehte Rohrendorf das Spiel JAUERLING. Der Gipfel soll und sicherte sich drei wichtige künftig noch attraktiver für Punkte. >> Seite 28 Wanderer werden. >> Seite 6 Österreichische Post AG | RM 11A038822K | 4010 Linz age |Krems Aufl 40.643 Stk. | '# & " ! #" Wertschätzung " " " ! #"! KREMS. Private Zahnuni will von Landespolitik nicht länger in Grafenegg Gutschein ignoriert werden. >> Seite 16 für # # " # Top-Athleten zu Gast Sportakrobaten richten # Erdbeer- KREMS. heuer die Österreichischen %#" #!#" # # !##!#" Meisterschaften aus. >> Seite 31 tägl. von 8.00–20.00 Uhr Pflücker !##!#" (" $! LandKrems & Leute VORTRAG Kriminalpsychologe ist überzeugt: „Jeder kann zum Mörder werden“ KREMS. Der renommierte Kri- Seit 2005 beschäftigt sich der Psy- minalpsychologe und Autor chologe, der seine Berufslaufbahn Thomas Müller war zu Gast in als Polizist in Innsbruck begon- Krems. Bei einem Vortrag in nen hat, zunehmend mit Krimi- der Stadtbücherei gab er einen nalität am Arbeitsplatz. „Ich bin Einblick in seine Arbeit mit davon überzeugt, dass jeder von Schwerverbrechern. uns in eine Situation hineinkom- men kann, wo er sagt, ich kann von CLAUDIA BRANDT nicht mehr“. -

Ausgabe September 2015
Zugestellt durch Post.at Gemeindezeitung Nr. 29 Sept. 2015 Weinzierl am Walde Einen schönen Start in den Herbst 2015 wünscht das Gemeindeteam! Allen kleinen GemeindebürgerInnen: einen fröhlichen Kindergarten- und Schulbeginn! Aus dem Inhalt Vorwort Bürgermeister 2 Pfarre Weinzierl und St. Johann 14 Standesamt 2 Volksschule St. Johann 14 Aus dem Gemeindeamt 4 Bibliothek St. Johann 15 NÖ Landeskindergarten Nöhagen 7 Gemeindeverband Krems 16 Zivilschutz-Probealarm 9 Leader Region Kamptal 16 NÖ Heizkostenzuschuss 2015-2016 10 Trachtenkapelle Nöhagen 18 Seniorenbund Albrechtsberg/Weinzierl 12 USV Albrechtsberg 18 Ausschreibung Kindergartenersatz- 13 NÖ Heckentag 2015 19 betreuerIn Jubilare 13 Wohnungen Arzthaus Weinzierl 20 Seite 2 Gemeindenachrichten VORWORT DES BÜRGERMEISTERS STANDESAMT Claudia Haimeder, den Kinderbetreuerinnen Ingrid Geburten Klammer, Birgit Weillech- 07.07.2015 Lehner Antonia Ava Rosina, ner, Tamara Kormesser 3611 Wolfenreith 21 und Susanne Hofbauer sowie dem gesamten 12.07.2015 Wimmer Lorenz, Schulteam unter der Lei- 3541 Ostra 15 tung von Volksschuldirekto- 23.09.2015 Helmreich Lukas, rin Ilse Pernerstorfer und unserer Schulwartin Aloisia 3611 Habruck 28/2 Höllerschmid - vielen Dank für Euer Engagement. Jubilare Liebe Gemeindebürgerinnen, Außerdem wird das Thema liebe Gemeindebürger! der „Wildbachbegehung“ in 85. Geburtstag Der Sommer neigt sich der heutigen Zeit immer 02.08.2015 Schwarz Maria, langsam dem Ende zu, wir wichtiger. In unsere Gemei- 3521 Nöhagen 13/2 können auf einige schöne ne betrifft es etwa den Him- Veranstaltungen zurückbli- berger Mühlbach, Teile des 13.09.2015 Dürnecker Ingeborg, cken. Die zahlreichen Feu- Bengelbaches, des Blo- 3611 Habruck 26 erwehrfeste in den jeweili- cherleitengrabens, des gen Orten fanden großen Grubbaches und des Sim- 80. Geburtstag Anklang und ich möchte bachgrabens, den Loben- mich bei den Veranstaltern dorferbach, den Tiefental- 24.08.2015 Mayer Heinrich, für Ihre Mühe und Einsatz graben, den Reichaubach 3610 Stixendorf 14/1 bedanken. -

Niederoesterreich Kopf 2004
M i l i t ä r k o m m a n d o N i e d e r ö s t e r r e i c h Ergänzungsabteilung: 3101 St. PÖLTEN, Kommandogebäude Feldmarschall Heß, Schießstattring 8 Parteienverkehr: Montag bis Freitag von 0800 bis 1400 Uhr Telefon: 02742 / 892 - 0, Fax: 02742/892-1720 STELLUNGSKUNDMACHUNG 2005 Auf Grund des § 18 Abs. 1 des Wehrgesetzes 2001, BGBl. I Nr. 146/2001, haben sich alle österreichischen Staatsbürger männlichen Geschlechtes des G E B U R T S J A H R G A N G E S 1 9 8 7 sowie alle älteren wehrpflichtigen Jahrgänge, die bisher der Stellungspflicht noch nicht nachgekommen sind, gemäß dem unten angeführten Plan der Stellung zu unterziehen. Österreichische Staatsbürger des Geburtsjahrganges 1987 oder eines älteren Geburtsjahrganges, bei denen die Stellungspflicht erst nach dem in dieser Stellungs- kundmachung festgelegten Stellungstag entsteht, haben am 15.12.2005 zur Stellung zu erscheinen, sofern sie nicht vorher vom Militärkommando persönlich geladen wurden. Für Stellungspflichtige, welche ihren Hauptwohnsitz nicht in Österreich haben, gilt diese Stellungskundmachung nicht. Sie werden gegebenenfalls gesondert zur Stellung aufgefordert. Für die Stellung ist insbesondere Folgendes zu beachten: 1. Für den Bereich des Militärkommandos NIEDERÖSTERREICH werden die Stellungspflichtigen durch die Stellungs- 4. Wehrpflichtige, die das 17. Lebensjahr vollendet haben, können sich bei der Ergänzungsabteilung des Militär- kommission des Militärkommandos NIEDERÖSTERREICH der Stellung zugeführt. Das Stellungsverfahren, bei kommandos NIEDERÖSTERREICH freiwillig zur vorzeitigen Stellung melden. Sofern militärische Interessen nicht welchem durch den Einsatz moderner medizinischer Geräte und durch psychologische Tests die körperliche und entgegenstehen, wird solchen Anträgen entsprochen. -

Global Map of Irrigation Areas AUSTRIA
Global Map of Irrigation Areas AUSTRIA Area equipped for irrigation Area actually irrigated NUTS1-region NUTS2-region (ha) (ha) Burgenland Ostösterreich 24 790 10 940 Niederösterreich Ostösterreich 79 050 27 520 Wien Ostösterreich 1 770 550 Kärnten Südösterreich 1 040 210 Steiermark Südösterreich 3 570 1 340 Oberösterreich Westösterreich 2 270 720 Salzburg Westösterreich 240 40 Tirol Westösterreich 3 170 2 090 Vorarlberg Westösterreich 150 40 Austria total 116 050 43 450 NUTS1-region Area equipped for irrigation (ha) total with groundwater with surface water Ostösterreich 105 610 89 192 16 418 Südösterreich 4 610 2 143 2 467 Westösterreich 5 830 3 267 2 563 Austria total 116 050 94 602 21 448 http://www.fao.org/nr/water/aquastat/irrigationmap/aut/index.stm Created: March 2013 Global Map of Irrigation Areas AUSTRIA Area equipped for Municipality NUTS3-region Province irrigation (ha) Deutschkreutz Mittelburgenland Burgenland 0 Draßmarkt Mittelburgenland Burgenland 0 Frankenau-Unterpullendorf Mittelburgenland Burgenland 0 Großwarasdorf Mittelburgenland Burgenland 0 Horitschon Mittelburgenland Burgenland 0 Kaisersdorf Mittelburgenland Burgenland 0 Kobersdorf Mittelburgenland Burgenland 0 Lackenbach Mittelburgenland Burgenland 0 Lackendorf Mittelburgenland Burgenland 3 Lockenhaus Mittelburgenland Burgenland 0 Lutzmannsburg Mittelburgenland Burgenland 8 Mannersdorf an der Rabnitz Mittelburgenland Burgenland 129 Markt Sankt Martin Mittelburgenland Burgenland 0 Neckenmarkt Mittelburgenland Burgenland 0 Neutal Mittelburgenland Burgenland 0 Nikitsch -

Verordnung Des Bundesdenkmalamtes Betreffend Den Verwaltungsbezirk Krems, Bundesland Niederösterreich
Verordnung des Bundesdenkmalamtes betreffend den Verwaltungsbezirk Krems, Bundesland Niederösterreich Auf Grund des § 2a des Denkmalschutzgesetzes, BGBl. I Nr. 170/1999, wird verordnet: § 1. Folgende unbewegliche Denkmale des Verwaltungsbezirkes Krems, Bundesland Niederösterreich, die gemäß § 2 oder § 6 Abs. 1 leg. cit. kraft gesetzlicher Vermutung unter Denkmalschutz stehen, werden unter die Bestimmungen des § 2a Denkmalschutzgesetz gestellt: Bezeichnung Adresse EZ Gst. Nr. KG 3641 Aggsbach Pfarrhof und Gartenportal Aggsbach Markt 13 13 .2 12301 Aggsbach Waschhaus Aggsbach Markt bei 13 13 .1 12301 Aggsbach Kath. Pfarrkirche Aggsbach Markt 124 .3 12301 Aggsbach Mariae Himmelfahrt und Friedhof Ortskapelle Groisbach 37 .19 12317 Groisbach Bildstock 108 505 12331 Köfering Ortskapelle 31 .43 12366 Willendorf 3613 Albrechtsberg an der Großen Krems Kath. Pfarrkirche Albrechtsberg an der 1 .1/2 12141 Albrechtsberg Mariae Himmelfahrt Großen Krems Figurenbildstock hl. Florian 364 1658/9 12141 Albrechtsberg Kath. Pfarrkirche hl. Pankratius Els 38 .31 12177 Els Ortskapelle Purkersdorf 24 .14 12181 Purkersdorf 3512 Bergern im Dunkelsteinerwald Kreuzweg 24; 25; 47 5/1, 7/2, 164/1; 12161 Maria Langegg 8; 7/3 Ortskapelle Oberbergern 87 169 .5 12149 Oberbergern Ortskapelle Schenkenbrunn 45 2 .29 12170 Schenkenbrunn Kath. Pfarrkirche Unterbergern 134 73 .37 12150 Unterbergern hl.Johannes Nepomuk Ortskapelle Wolfenreith 19 8 .4 12173 Wolfenreith 3552 Droß Aufbahrungshalle, Schloßstraße 96 .106 12103 Droß ehem. Pfarrkirche hl. Georg und ehem. Schlosskapelle Kath. Pfarr- und Kirchenplatz 114 477 .128 12103 Droß Wallfahrtskirche Maria Fatima Figurenbildstock, 716 1243 12103 Droß Bründlmadonna 3601 Dürnstein Franzosendenkmal 576 .124 12105 Dürnstein Persönlichkeitsdenkmal 680 1570/1 12105 Dürnstein Ingenieur August Kargl Reiterstandbild (beim Wartstein) 722 1562 12105 Dürnstein Ratscherkreuz, Oberloiben neben 41 117 277 12116 Oberloiben ehem. -

Gebietsbeschreibung
HAUPTREGION WALDVIERTEL Managementplan Europaschutzgebiete „Kamp- und Kremstal“ GEBIETSBESCHREIBUNG Biogeografische kontinental Region Fläche ges. (ha) rd. 29.033 ha Natura 2000- FFH-Gebiet Vogelschutzgebiet Gebiet (Kamp- und Kremstal) (Kamp- und Kremstal) Gebietsnummer AT1207A00 AT1207000 Fläche* (ha) rd. 14.495 ha rd. 24.266 ha Bezirke Horn, Krems-Land, Krems-Stadt, Horn, Krems-Land, Tulln, Zwettl Zwettl Gemeinden Albrechtsberg an der großen Krems, Altenburg, Burgschleinitz - Kühnring, Altenburg, Droß, Gars am Kamp, Droß, Dürnstein, Eggenburg, Gars am Gedersdorf, Gföhl, Grafenegg, Kamp, Gedersdorf, Gföhl, Grafenegg, Hadersdorf - Kammern, Horn, Jaidhof, Grafenegg, Grafenwörth, Hadersdorf - Krems an der Donau, Krumau am Kammern, Horn, Jaidhof, Krems an der Kamp, Langenlois, Lichtenau im Donau, Krumau am Kamp, Langenlois, Waldviertel, Pölla, Rastenfeld, Lengenfeld, Meiseldorf, Pölla, Röhrenbach, Rohrendorf bei Krems, Rastenfeld, Röhrenbach, Rohrendorf bei Rosenburg - Mold, Schönberg am Krems, Rosenburg - Mold, Schönberg am Kamp, Senftenberg, St. Bernhard - Kamp, Senftenberg, St. Bernhard - Frauenhofen, St. Leonhard am Frauenhofen, St. Leonhard am Hornerwald, Straß im Straßertale, Hornerwald, Straß im Straßertale, Stratzing, Weinzierl am Walde, Zwettl- Stratzing, Zwettl-Niederösterreich Niederösterreich Höhenstufen 717 m/188 m 645 m/192 m (max./min. m Höhe) * Quelle: Feinabgrenzung, Stand Mai 07 Die Europaschutzgebiete „Kamp- und Kremstal” (FFH-Gebiet + Vogelschutzgebiet) sind Teil der Hauptregion Waldviertel und umfassen die Flusslebensräume -

Ausgabe Dezember 2019
Zugestellt durch Post.at Amtliche Mitteilung Gemeindezeitung Nr. 46 Weinzierl am Walde Dezember 2019 Offizielle Eröffnung des neuen Schulfreiraumes … siehe Seite 7! Aus dem Inhalt Vorwort 2 Volksschule 10 - 11 Standesamt 2 - 3 NMS Albrechtsberg 12 Aus dem Gemeindeamt 4 USV Albrechtsberg 13 NÖ Heizkostenzuschuss 2019/20 5 Jubilare, Veranstaltungen 14 Jagdpacht 6 Infos zu den Wahlen 16 Eröffnung öffentl. Schulfreiraum 7 Trachtenkapelle Nöhagen 20 Bibliothek St. Johann 8 Pensionistenvereine 22 - 23 Kindergarten 9 Werte der Wasserversorgung 24 Seite 2 Gemeindenachrichten VORWORT STANDESAMT Liebe Gemeindebürgerinnen, Geburten liebe Gemeindebürger! Mit dem Jahr 2019 können wir gemeinsam zwei erfolgreiche Projekte abschließen. Zuerst eine Herzenssache: der neue Schulfreiraum bei der Volksschule in St. Johann, der insgesamt etwas über 60.000 € an Investitionskosten verschlungen hat. Hierbei wurde der Großteil (d.h. 2/3) vom 13.09.2019 Anton Gerhard & Josephine Hermine Liewald Land NÖ gefördert - anders wäre der Spielplatz Nöhagen Eltern Kathrin Koppensteiner u. Fabian Liewald für uns als kleine Gemeinde nicht zu realisieren gewesen! Das 2. Projekt ist die Erneuerung des Dorfplat- zes in Lobendorf, das mittlerweile kurz vor dem Abschluss steht. Das baufällige Milchwartehäu- schen wurde aufgelassen, neue Parkplätze ge- schaffen und zahlreiche Steinmauern im Orts- zentrum, mit Hilfe der Straßenmeisterei Spitz, als Abgrenzung zur Straße hergestellt. Für das nächste Jahr sind noch weitere Arbeiten ge- 18.09.2019 Paul Zottl, Ostra plant. Eltern Anna Kuselbauer u. Michael Zottl Beide Vorhaben sind eine wesentliche Berei- cherung für unsere Gemeinde und lassen uns positiv in die Zukunft blicken, da hier auch für die nachkommenden Generationen wichtige Le- benselemente geschaffen wurden! Abschließend wünsche ich Ihnen und Ihren Fami- lien ein frohes Weihnachtsfest, erholsame Feierta- ge ohne Streß und Hektik sowie einen guten Rutsch ins neue Jahr! Ihr Bürgermeister 19.09.2019 Victor Kedzior, Weinzierl Eltern Angelika u.