Ein Alt-Badischer Grenzstein Um 1440
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

Wiernsheim Kw48 1.TP.PS, Page 1-14
Woche 48 Freitag, 27. November Jahrgang 2009 Evang. und Kath. Kirchengemeinden laden gemeinsam sehr herzlich ein zum festlichen und geselligen Senioren - Nachmittag im Bürgersaal am 1. Adventssonntag, 29. November 2009, 14.00 bis 17.00 Uhr. Fahrdienst: Bei Bedarf holen wir Sie gerne ab und fahren Sie auch wieder nach Hause. Bitte melden im Evang. Pfarramt, Tel. 7294. Seite 2 / Nummer 48 Amtsblatt Wiernsheim Freitag, 27. November 2009 2. Wiernsheimer ADVENTSSINGEN DER Weihnachtsmarkt IPTINGER CHÖRE am Freitag, 27. November AUF DEM KELTERPLATZ im ehemaligen Klosterhof hinter Gaststätte Adler ● offizieller Beginn ab 16.00 Uhr ● um 16.55 Uhr: Ansprache durch Hr. Bürgermeister Oehler, im Anschluss durchgehendes musikalisches Pro- gramm mit gemeinsamem Liedvor- trag einiger Kinder des Kindergar- tens und der Gustav-Heinemann- Schule, dem Kirchenchor, dem Kin- der- und Jugendchor sowie dem SONNTAG, 29.11.09 Chor "Ohrwurm" des Liederkranzes Wiernsheim. Ebenso spielt eine (1. Advent) Band der Musikschule Burgert (Mu- sikkeller). 18.00 Uhr ● von 16.00 bis 19.00 Uhr Bücherfloh- Mitwirkende: markt in der Bücherei. Viel Spaß Männergesangverein Iptingen beim Stöbern! ● ab 17.00 bis ca. 17.30 Uhr: Lesung Gospelchor Iptingen für Kinder in der Bibliothek. Kirchenchor Iptingen ● Verkaufsstände mit weihnachtlichem Flair, Weih- Kinder-/Jugendchor Iptingen nachtsbrötchen, Popcorn und Süßigkeiten. Posaunenchor Iptingen ● Zu Trinken: Glühwein "Basis", BmS (Basis mit Schuss), Spezialglühwein "Werschemer Grabbafeu- Im Anschluss sind Sie herzlich eingeladen zu Glühwein, er", Kinderpunsch, alkoholfreie Getränke. Kinderpunsch, Brezeln, heißen Würsten und Weihnachts- ● Zum Essen: Waffeln, Flammkuchen, gebäck. Der Erlös kommt der Partnerschaft des Kirchen- rote und weiße Würste vom Grill bezirks Mühlacker mit Tansania zugute. ● Ende gegen 21.00 Uhr. -

Friolzheim KW 29 ID 116829
Diese Ausgabe erscheint auch online www.eblättle.de Liederkranz Friolzheim lädt ein 23. + 24. Juli Pergolafest zur Hocketse rund um's Milchhäusle Sa. 23. Juli ab 16:00 Uhr So. 24. Juli ab 11:30 Uhr Gesang Gemütlichkeit Genuss musikalische Ausgabe 29 Unterhaltung: 62. Jahrgang 21. Juli 2016 mit Gastchören und unseren Chören 2 Nr. 29 . Donnerstag, 21. Juli 2016 IG-Musikalische Früherziehung Friolzheim-Wimsheim e. V. Es freut uns sehr, dass ein großes Interesse für die Kurse Musikwichtel, Mein MUSIMO und Musikalische Früherziehung besteht, sodass bereits alle Kurse für September 2016 ihre Teilnehmerzahlen erreicht haben. Es gibt noch eine Änderung: Die Musikalische Früherziehung I bei Frau Weiß wird nicht donnerstags, sondern Mittwoch nachmittags stattfinden!!! Unterrichtsangebot für Musikinstrumente: Das folgende Unterrichtsangebot richtet sich an Kinder, Jugendliche und Erwachsene. Der Einstieg ist jederzeit möglich. Blockflöte – Mit einer neuen Flötenlehrkraft!!! Irmtraud Geywitz aus Illingen ist Blockflötistin und Blockflötenlehrerin. Qualifikation: Studium mit pädagogischem und künstlerischem Abschluss Ein Unterricht ist in Sopran, Alt, Tenor und Bassflöte möglich. Frau Hees und Frau Schmidt unterrichten die bisherigen Flötenschüler weiterhin. Klavier und Keyboard – NEU bei der IG MFE!!! Stefan Deisenhofer aus Friolzheim unterrichtet ab sofort auch bei der IG MFE. Qualifikation: 5-jähriges Musikstudium für Klavier und Gesang Ausbildung zum Musiklehrer im FMZ Stuttgart-Feuerbach bei Andreas Winter Tätigkeiten: 2002 Gründung der eigene -

Bus Linie 653A Fahrpläne & Karten
Bus Linie 653A Fahrpläne & Netzkarten 653A Heimsheim Egelsee Im Website-Modus Anzeigen Die Bus Linie 653A (Heimsheim Egelsee) hat 5 Routen (1) Heimsheim Egelsee: 12:25 - 13:10 (2) Leonberg Römerstr.: 06:37 (3) Rutesheim Schulzentrum: 06:48 - 06:55 (4) Wiernsheim Bürgersaal: 12:15 - 17:15 Verwende Moovit, um die nächste Station der Bus Linie 653A zu ƒnden und, um zu erfahren wann die nächste Bus Linie 653A kommt. Richtung: Heimsheim Egelsee Bus Linie 653A Fahrpläne 9 Haltestellen Abfahrzeiten in Richtung Heimsheim Egelsee LINIENPLAN ANZEIGEN Montag 12:25 - 13:10 Dienstag 12:25 - 13:10 Rutesheim Schulzentrum Mittwoch Kein Betrieb Rutesh. Sporthalle Bühl Robert-Bosch-Straße 58, Rutesheim Donnerstag Kein Betrieb Perouse Hauptstr. Freitag Kein Betrieb Leonberger Straße, Germany Samstag Kein Betrieb Perouse Waldenserstr. Sonntag Kein Betrieb Vogt-Greber-Straße 1, Germany Heimsheim Leonberger Str. Leonberger Straße 48, Germany Bus Linie 653A Info Heimsheim Marktplatz Richtung: Heimsheim Egelsee Hauptstraße 5, Heimsheim Stationen: 9 Fahrtdauer: 18 Min Heimsheim See Linien Informationen: Rutesheim Schulzentrum, Mönsheimer Straße, Heimsheim Rutesh. Sporthalle Bühl, Perouse Hauptstr., Perouse Waldenserstr., Heimsheim Leonberger Str., Heimsheim Schafwäsche Heimsheim Marktplatz, Heimsheim See, Heimsheim Mönsheimer Straße 108, Heimsheim Schafwäsche, Heimsheim Egelsee Heimsheim Egelsee Richtung: Leonberg Römerstr. Bus Linie 653A Fahrpläne 36 Haltestellen Abfahrzeiten in Richtung Leonberg Römerstr. LINIENPLAN ANZEIGEN Montag 06:37 Dienstag 06:37 Mönsheim Marktplatz Pforzheimer Straße 18, Mönsheim Mittwoch Kein Betrieb Mönsheim Wimsheimer Str. Donnerstag Kein Betrieb Wimsheimer Straße 8, Mönsheim Freitag Kein Betrieb Mönsheim Freibad Samstag Kein Betrieb Mönsheim Lerchenhof Sonntag Kein Betrieb Wimsheim Goethestr. Schillerstraße 8, Wimsheim Wimsheim Rathaus Bus Linie 653A Info Kanalstraße 1, Wimsheim Richtung: Leonberg Römerstr. -

Mitteilungsblatt KW 32/2019
Nummer 32, Donnerstag, 8. August 2019 Diese Ausgabe erscheint auch online Spielplatzeinweihung der Krippe Kuckucksnest in Lehningen Kindertagesstätte Lehningen Hurra, Hurra jetzt war es so weit und der Gar- ten der Krippe Kuckucksnest konnte mit einem kleinen Fest eingeweiht werden. Wir konnten alle Familien zur wohl heißesten Einweihungs- feier in Lehningen am Freitag, den 26. Juli 2019 begrüßen. Nach einem Begrüßungslied gab es einen Som- mer Hip-Hop bei dem alle toll mitgemacht ha- ben. Dann wurde von den Erzieherinnen das Band durchgeschnitten, das den Garten somit für alle eröffnet hat. Damit konnte der gemüt- liche Nachmittag mit Speisen und Getränken beginnen. Danke an alle Eltern. Unser Spielplätzchen gefällt Groß und Klein und ist wirklich schön geworden. Danke dafür an alle Beteiligten. Das Kuckucksnest Woche 32 2 Tiefenbronner Mitteilungsblatt Donnerstag, 8. August 2019 Bildnachlese vom 33. Brunnenfest des OGV Lehningen e.V. Fotos: Anton Hoffmann, Matthias Oliger, Dieter Weiß Woche 32 Donnerstag, 8. August 2019 Tiefenbronner Mitteilungsblatt 3 Bildnachlese zum Tiefenbronner Jugendferienprogramm 2019 Pony-Spaß auf dem Römerhof mit der Bauernhofpädagogin Pina Stähle am 29.07.2019 Fotos: Pina Stähle, Nina Maier Woche 32 4 Tiefenbronner Mitteilungsblatt Donnerstag, 8. August 2019 Streifzug über Wiesen und Felder mit den Heckengäu-Naturführerinnen am 30.07.2019 Fotos: Bettina Günther, Nina Maier Ein Tag bei der Campingkirche mit der Ev. Kirchengemeinde Mühlhausen/Neuhausen am 31.07.2019 Fotos: Nina Maier Woche 32 Donnerstag, 8. August 2019 Tiefenbronner Mitteilungsblatt 5 DIE GEMEINDEVERWALTUNG INFORMIERT Die Gemeinde Tiefenbronn (5.400 EW) sucht für ihre Kin- Die Gemeinde Tiefenbronn bietet für das derbetreuungseinrichtungen baldmöglichst mehrere Schuljahr 2019/2020 drei Praktika im Berufskolleg Pädagogische Fachkräfte (m/w/d) für den Beruf der Erzieherin • für den Kindergarten Naseweis im Ortsteil Tiefenbronn bzw. -

Karte Der Erdbebenzonen Und Geologischen Untergrundklassen
Karte der Erdbebenzonen und geologischen Untergrundklassen 350 000 KARTE DER ERDBEBENZONEN UND GEOLOGISCHEN UNTERGRUNDKLASSEN FÜR BADEN-WÜRTTEMBERG 1: für Baden-Württemberg 10° 1 : 350 000 9° BAYERN 8° HESSEN RHEINLAND- PFALZ WÜRZBUR G Die Karte der Erdbebenzonen und geologischen Untergrundklassen für Baden- Mainz- Groß- Main-Spessart g Wertheim n Württemberg bezieht sich auf DIN 4149:2005-04 "Bauten in deutschen Darmstadt- li Gerau m Bingen m Main Kitzingen – Lastannahmen, Bemessung und Ausführung üblicher Freudenberg Erdbebengebieten Mü Dieburg Ta Hochbauten", herausgegeben vom DIN Deutsches Institut für Normung e.V.; ub Kitzingen EIN er Burggrafenstr. 6, 10787 Berlin. RH Alzey-Worms Miltenberg itz Die Erdbebenzonen beruhen auf der Berechnung der Erdbebengefährdung auf Weschn Odenwaldkreis Main dem Niveau einer Nicht-Überschreitenswahrscheinlichkeit von 90 % innerhalb Külsheim Werbach Großrinderfeld Erbach Würzburg von 50 Jahren für nachfolgend angegebene Intensitätswerte (EMS-Skala): Heppenheim Mud Pfrimm Bergst(Bergstraraßeß) e Miltenberg Gebiet außerhalb von Erdbebenzonen Donners- WORMS Tauberbischofsheim Königheim Grünsfeld Wittighausen Gebiet sehr geringer seismischer Gefährdung, in dem gemäß Laudenbach Hardheim des zugrunde gelegten Gefährdungsniveaus rechnerisch die bergkreis Höpfingen Hemsbach Main- Intensität 6 nicht erreicht wird Walldürn zu Golla Bad ch Aisch Lauda- Mergentheim Erdbebenzone 0 Weinheim Königshofen Neustadt Gebiet, in dem gemäß des zugrunde gelegten Gefährdungsniveaus Tauber-Kreis Mudau rechnerisch die Intensitäten 6 bis < 6,5 zu erwarten sind FRANKENTHAL Buchen (Odenwald) (Pfalz) Heddes-S a. d. Aisch- Erdbebenzone 1 heim Ahorn RHirschberg zu Igersheim Gebiet, in dem gemäß des zugrunde gelegten Gefährdungsniveaus an der Bergstraße Eberbach Bad MANNHEIM Heiligkreuz- S c Ilves- steinach heff Boxberg Mergentheim rechnerisch die Intensitäten 6,5 bis < 7 zu erwarten sind Ladenburg lenz heim Schriesheim Heddesbach Weikersheim Bad Windsheim LUDWIGSHAFEN Eberbach Creglingen Wilhelmsfeld Laxb Rosenberg Erdbebenzone 2 a. -

Detailkarte 5
Gemeinde Gemarkung Gemarkung Keltern Gemarkung Gemeinde Weiler Gemeinde Niebelsbach Keltern Spielberg Gemarkung Keltern Gemeinde Weiler Gemarkung Wiernsheim Gemarkung Dietlingen Gemarkung Pforzheim Wiernsheim Gemeinde Gemarkung Karlsbad Gemarkung Gemeinde Ittersbach Wurmberg Wurmberg Gemarkung Gemarkung Gemarkung Gemeinde Ottenhausen Gemarkung Birkenfeld Mönsheim Mönsheim Gräfenhausen Gemeinde Birkenfeld Diese Karte ist Bestandteil der Verordnung des Regierungspräsidiums Karlsruhe. Gemarkung Pfaffenrot Gemeinde Gemeinde Marxzell Pforzheim Gemarkung Feldrennach Gemarkung Gemarkung Büchenbronn Gemarkung Gemeinde Huchenfeld Wimsheim Wimsheim Gemarkung Gemeinde Gemarkung Gemarkung Mönsheim Mönsheim Arnbach Würm Gemeinde Straubenhardt Gemarkung Schwann Gemarkung Neuenbürg Gemarkung Langenalb Gemarkung Gemeinde Gemarkung Friolzheim Gemarkung Friolzheim Gemarkung Engelsbrand Conweiler Hohenwart Gemarkung Gemeinde Waldrennach Gemarkung Gemarkung Gemarkung Neuenbürg Gemeinde Grunbach Mühlhausen Tiefenbronn Engelsbrand Gemarkung Gemeinde Gemarkung Hamberg Marxzell Schielberg Gemarkung Gemarkung Gemarkung Salmbach Unterreichenbach Gemeinde Gemarkung Feldrennach Heimsheim Neusatz Gemeinde Gemarkung Tiefenbronn Gemeinde Gemeinde Schellbronn Bad Herrenalb Unterreichenbach Gemarkung Gemarkung Gemarkung Kapfenhardt Gemarkung Dennach Steinegg Langenbrand 1 Gemeinde Gemarkung Neuhausen 2 Mühlhausen Gemarkung Gemarkung Gemeinde Höfen an der Enz Bieselsberg Höfen 3 4 5 Gemarkung Gemarkung Neuhausen Schwarzenberg Gemarkung Gemeinde Lehningen Gemeinde Gemarkung -

Informationen Aus Dem Gemeindevollzugsdienst
Nummer 6 Diese Ausgabe erscheint auch online Donnerstag, 11. Februar 2021 Informationen aus dem Gemeindevollzugsdienst Die Hotline des Gesundheits- amts für Fragen zu Virus, Liebe Verkehrsteilnehmerinnen und Verkehrsteilnehmer, Schutz und Erkrankung ist seit dem 04.01.2021 ist unser neuer Mitarbeiter Herr Pfeil als Gemeindevollzugs- montags bis samstags von 8 bis 17 Uhr, dienstags von 8 bis 18 Uhr er- dienst in den Gemeinden Wimsheim und Tiefenbronn unterwegs. Er wird nun reichbar unter der Nummer 07231 künftig auch vermehrt den ruhenden Verkehr überprüfen. Wir bitten daher um 308 6850 oder Anliegen auch per E-Mail an [email protected] Einhaltung der Straßenverkehrsordnung. Mit dem unten abgedruckten Formular weisen wir Sie ab sofort darauf hin, dass Foto: fstop123/E+/GettyImages Sie mit Ihrem Fahrzeug einen Verkehrsverstoß begangen haben. Termine für Impfungen in den Kreisimpfzentren über die Hotline „116 117“ oder online über www.impfterminservice.de Foto: 13threephotography/iStock/Getty Images Plus Bitte beachten Sie, dass der Zutritt ins Rathaus nur mit Aktuell weisen wir Sie noch ohne Verwarnungsgeld darauf hin. Ab dem einer medizinischen Maske 15.02.2021 werden wir die Verwarnung dann kostenpfl ichtig aussprechen. zulässig ist Uns liegt daran, dass die Straßenverkehrsordnung in unserer Gemeinde einge- halten wird, damit sich alle Verkehrsteilnehmer gut und sicher in unserer Ge- meinde bewegen können. Ganz gleich, ob Sie als Bürger/in gut zu Fuß sind oder z.B. einen Rollator benötigen, mit kleinen Kindern unterwegs sind oder Verkehrs- mittel wie z.B. Fahrrad, PKW oder den ÖPNV nutzen. Wir bitten um Ihr Verständnis für diese Maßnahmen und wünschen Ihnen, dass Landessanierungsprogramm Sie sicher in unserer Gemeinde Ihr Ziel erreichen. -

Im Ortsteil Stein
Ausgabe 30 · 29. Juli 2021 Neu gestaltetes imStaudenbeet Ortsteil Stein Diese Ausgabe erscheint auch online Durch diese Blütenpracht werden viele Bienen und weitere wertvolle Insekten angelockt. Nummer 30 2 Donnerstag, 29. Juli 2021 Initiative Stadtradeln 1. Serenadenabend in Königsbach-Stein Unter den Kastanien vor der Evang. Stephanuskirche in Stein Der Zwischenstand bei Halbzeit: Weiter so Königsbach-Stein! Bild: Irene Hammer Unser Anliegen an die Teams in Königsbach-Stein: Nutzt doch vielleicht den Schwung vom Stadtradeln und macht teamin- Stephanuskantorei tern eine Spendenaktion daraus. Jeder legt einen persönlichen Beitrag pro geradeltem Kilometer fest und am Ende wird für Pfarrerin Gertrud Diekmeyer, Liturgie Lilli Hahn, Klavier einen guten Zweck gespendet, z.B. an die Betroffenen der Un- Roman Rothen, Kontrabass und Technik wetterkatastrophe, eine Naturschutz-Initiative oder was eben Ulrike Rothen, Flöte und Leitung sonst euer gemeinsames Herzensanliegen sein könnte. Spen- denziele gibt es genug… am Samstag, 31.7.2021 um 19 h Bei schlechtem Wetter findet die Veranstaltung in der Stephanuskirche statt. Heynlinschüler feiern ihren Abschluss Selbstbewusst durchschreiten sie die Aula, betreten die Büh- ne und hängen bunte Sterne an der Wand auf: Mit vielen Gästen und noch mehr lobenden Worten haben die Steiner Heynlin- schüler am vergangenen Freitag ihren Abschluss gefeiert. Rektorin Carolin Krauth hofft, dass sie die Schulzeit neugierig, selbstbewusst und stolz auf das Erreichte gemacht hat. Und sie hofft, dass sie gute Erinnerungen mitnehmen: an Menschen, an Momente und an Inhalte. Denn die Rektorin ist überzeugt: Das Ziel von Schule besteht nicht daran, die Jugendlichen mit mög- lichst Einzelwissen vollzustopfen. Stattdessen gehe es darum, sie bei ihrer Entwicklung zu begleiten, ihnen hin und wieder auch mal einen Schubs zu geben. -

Wegweiser Für Senioren Im Enzkreis 2021/22
2021 / 2022 WEGWEISER FÜR SENIOREN Liebevolle Pflege und Betreuung zuhause „Verlässliche Pflege in Ihrer vertrauten Umgebung!“ Im eigenen Zuhause im gewohn- Wir bieten umfassende Leistun- ten Umfeld alt werden – dies zu gen, um Sie in Ihrem Alltag zu ermöglichen, haben wir uns mit unterstützen und zu entlasten: unserem Pflegedienst zur Auf- gabe gemacht. 1 Grundpflege 2 Hauswirtschaftliche Hilfen Großen Wert legen wir auf eine 3 Behandlungspflege vertrauensvolle Zusammen- 4 Haushaltshilfe / Familienpflege arbeit mit Ihnen und Ihren An- 5 Betreuungsleistungen gehörigen. 6 Verhinderungspflege Fordern Sie zu den einzelnen 7 Hausnotruf Angeboten unsere Folder mit 8 Tagespflege ausführlichen Informationen an. Wir haben 7 Tage die Woche und 365 Tage im Jahr für Sie geöffnet. Maulbronn Rufen Sie uns an: Königsbach-Stein Eisingen Ölbronn-Dürrn Remchingen Mühlacker Telefon Kämpfelbach Keltern Ispringen (0 72 31) 41 80 61 Niefern-Öschelbronn Birkenfeld Pforzheim Barbara Weise Straubenhardt Mönsheim Gerne beraten wir Sie unverbindlich Engelsbrand Inhaberin und kostenlos zu unseren Leistungen. Neuenbürg Heimsheim Neuhausen Wir freuen uns auf Sie! Ambulanter Pflegedienst zuHause Eisenbahnstraße 23 · 75179 Pforzheim Telefon 0 72 31/41 80 61 Telefax 0 72 31/41 80 62 www.ambulante-pflege-pforzheim.de GRUSSWORT 3 Bastian Rosenau LANDRAT GRUSSWORT Die Angebote im Bereich Pflege und Die digitale Ausgabe dieses Weg- Unterstützung für ältere Menschen weisers finden Sie auf unserer mit und ohne Pflegebedarf werden Homepage unter www.enzkreis.de. immer zahlreicher. Damit Sie, liebe Außerdem steht Ihnen die Plattform Bürgerinnen und Bürger stets den www.pflegeboersen.de rund um Überblick über die aktuellen Ange- die Uhr als Informationsportal zur bote behalten, aktualisieren wir den Verfügung. -
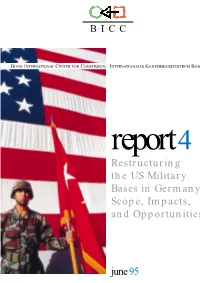
Restructuring the US Military Bases in Germany Scope, Impacts, and Opportunities
B.I.C.C BONN INTERNATIONAL CENTER FOR CONVERSION . INTERNATIONALES KONVERSIONSZENTRUM BONN report4 Restructuring the US Military Bases in Germany Scope, Impacts, and Opportunities june 95 Introduction 4 In 1996 the United States will complete its dramatic post-Cold US Forces in Germany 8 War military restructuring in ● Military Infrastructure in Germany: From Occupation to Cooperation 10 Germany. The results are stag- ● Sharing the Burden of Defense: gering. In a six-year period the A Survey of the US Bases in United States will have closed or Germany During the Cold War 12 reduced almost 90 percent of its ● After the Cold War: bases, withdrawn more than contents Restructuring the US Presence 150,000 US military personnel, in Germany 17 and returned enough combined ● Map: US Base-Closures land to create a new federal state. 1990-1996 19 ● Endstate: The Emerging US The withdrawal will have a serious Base Structure in Germany 23 affect on many of the communi- ties that hosted US bases. The US Impact on the German Economy 26 military’syearly demand for goods and services in Germany has fal- ● The Economic Impact 28 len by more than US $3 billion, ● Impact on the Real Estate and more than 70,000 Germans Market 36 have lost their jobs through direct and indirect effects. Closing, Returning, and Converting US Bases 42 Local officials’ ability to replace those jobs by converting closed ● The Decision Process 44 bases will depend on several key ● Post-Closure US-German factors. The condition, location, Negotiations 45 and type of facility will frequently ● The German Base Disposal dictate the possible conversion Process 47 options. -

Liniennetzplan Verkehrsverbund Pforzheim
Regional - Liniennetzplan S4 Richtung Eppingen Kürnbach Verkehrsverbund 702 Flehingen Oberderdingen Pforzheim - Enzkreis (VPE) Ochsenburg 143 702 Sternenfels gültig ab 09.06.2019 R9 702 Buslinien 1 Großvillars 101 Mühlacker - Lomersheim 1 Richtung Bruchsal 9 R Knittlingen Freudenstein 102 Mühlacker - Großglattbach Diefenbach Mühlacker - Dürrmenz 103 Bretten 143 706 734 143 Knittlingen - Oberderdingen - Flehingen 700 733 652 Weissach - Tiefenbronn - Leonberg arlsruhe 653 Wiernsheim/Weissach - Heimsheim - Leonberg Ruit 704 706 735 Pforzheim - Tiefenbronn - Weil der Stadt Schützingen 666 Maulbronn Zaisersweiher 700 Mühlacker - Maulbronn - Bretten 704 707 K S4 Richtung Sprantal 701 Mühlacker - Enzberg arlsruhe 702 Mühlacker - Flehingen / Ochsenburg Kleinvillars 703 Mühlacker - Wiernsheim - Iptingen Nußbaum nur zeitweise Schmie 704 Maulbronn - Zaisersweiher 933 Lienzingen K R5/S5 Richtung Ölbronn Mühlacker - Ötisheim/Dürrn 101 102 103 705 Göbrichen Maulbronn 706 Knittlingen - Diefenbach - Maulbronn R5 700 701 702 West 703 705 707 707 Mühlacker - Illingen - Roßwag Illingen Vaihingen Bauschlott Ötisheim R91 712 Pforzheim - Birkenfeld Dürrn 933 R5 7125 Pforzheim - Feldrennach - Ittersbach Königsbach 705 Corres 716 Pforzheim - Dobel - Bad Herrenalb 731 933 Stein Mühlacker Pforzheim - Langenalb - Ittersbach 717 R5 Richtung Bietigheim/Stuttgart Wilferdingen 701 718 Pforzheim - Conweiler Kieselbronn 722 Eisingen Enzberg Pforzheim - Dietlingen - Ittersbach Singen Bilfingen 738a 720 Darmsbach Pforzheim Mühlhausen Roßwag 721 Pforzheim - Dammfeld - Ellmendingen -

Kleindenkmale Im Enzkreis
Catharina Raible / Barbara Hauser Kleindenkmale im Enzkreis Verborgene Schätze entdecken Herausgegeben von Konstantin Huber Der Enzkreis. Schriftenreihe des Kreisarchivs, Band 12 2 IMPRESSUM Titelbild: Steinkreuz und Landesgrenzstein in Birkenfeld Rückseitige Umschlagabbildungen (v.l.u.n.r.u.): Freiungsstein in Neuenbürg; Holzfäller-Gedenkstein in Straubenhardt-Ottenhausen; Wirts- hausschild Hirsch in Kieselbronn; Bauinschrift am Kulturhaus Rose in Tiefenbronn; Friedhofs- kreuz in Kämpfelbach-Bilfingen; Richtstein in Birkenfeld-Gräfenhausen; Sonnenuhr in Maul- bronn-Schmie. Vorderer Vorsatz: Steinkreuz für Ludwig Jester in Kämpfelbach-Bilfingen Hinterer Vorsatz: Grabstein von Rüppurr in Wimsheim (links als Aquarell von Artur Steinle, 1969) Titel: Kleindenkmale im Enzkreis. Verborgene Schätze entdecken Reihe: Der Enzkreis. Schriftenreihe des Kreisarchivs, Band 12 Herausgabe und Gesamtredaktion: Konstantin Huber Koordination der Kleindenkmalerfassung: Barbara Hauser Objektauswahl: Catharina Raible, Barbara Hauser, Konstantin Huber Text: Catharina Raible Fotografien: Barbara Hauser u.a. Herstellung: verlag regionalkultur (vr) Satz: Harald Funke (vr) Umschlaggestaltung: Harald Funke (vr), Barbara Hauser, Marc Kinast, Maddalena Caprio Lektorat: Wilfried Sprenger u.a. Endkorrektur: Henrik Mortensen (vr) ISBN 978-3-89735-732-7 Bibliographische Information der Deutschen Bibliothek Die Deutsche Bibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliographie; detaillierte bibliographische Daten sind im Internet über http://dnb.ddb.de