Landschaftsplan Der Landeshauptstadt Schwerin
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-
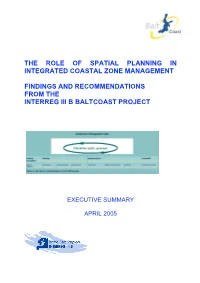
The Role of Spatial Planning in Integrated Coastal Zone Management
THE ROLE OF SPATIAL PLANNING IN INTEGRATED COASTAL ZONE MANAGEMENT FINDINGS AND RECOMMENDATIONS FROM THE INTERREG III B BALTCOAST PROJECT EXECUTIVE SUMMARY APRIL 2005 The Role of Spatial Planning in ICZM Recommendations from the Interreg III B BaltCoast Project 1. Background: The BaltCoast Sub-Projects The work within the Interreg III B BaltCoast project was divided into five different work packages each with a different theme. Whereas the tasks of work package one and five were developed and carried out in transnational working groups, work packages 2, 3 and 4 were characterised by individual sub-projects, where new approaches to conflict management and regional development were applied and tested. Through the combined work of these sub-projects: • BaltCoast has demonstrated practical ways of how to promote economic development, urban expansion and nature protection simultaneously. • BaltCoast has extended the former ICZM approach, which covered only less developed regions, to areas with dynamic economic development (e.g. important urban areas, tourism areas). • BaltCoast has combined concrete, practical projects and measures with the development of processes and regulations of spatial planning. • BaltCoast has been open to all relevant and interested public and private actors who could contribute to the ICZM process. The study documented in a separate report comprises: I. A summary of the major findings derived out of the practical work of the BaltCoast sub-projects. These findings are underlined in an exemplary way by a number of cases showing special aspects of the work within some of the BaltCoast sub-projects. II. Recommendations on the role of spatial planning within ICZM processes, which have been derived out of the findings of the BaltCoast sub-projects and their comparison with other ICZM projects and initiatives around the Baltic Sea Region as well as other cooperation areas. -

Agrar- Und Ernährungswirtschaft in Westmecklenburg Agricultural and Food Industry in West Mecklenburg
Agrar- und Ernährungswirtschaft in Westmecklenburg Agricultural and food industry in West Mecklenburg Informationen · Impulse · Innovationen Information · Impulses · Innovations FÜR IHRE ZIELE. UND DEN RICHTIGEN WEG. Weiter voranzukommen bedeutet, klare Ziele zu haben und die Richtung zu kennen. Mit großer und langjähriger Erfahrung unterstützen wir Sie als Unternehmerinnen und Unternehmer unseres Landes erfolgreich auf Ihrem Weg in die Zukunft – durch zuverlässige Bürgschaften und nachhaltige Beteiligungen für Ihre Investitionen. Wir beraten Sie gern: 0385 39 555–0 Mehr Informationen unter www.bbm-v.de / www.mbm-v.de Bürgschaftsbank BMV Mecklenburg-Vorpommern Mittelständische Besser mit uns. MBMV Beteiligungsgesellschaft Mecklenburg-Vorpommern Agrar- und Ernährungswirtschaft in Westmecklenburg Agricultural and food industry in West Mecklenburg Informationen · Impulse · Innovationen Information · Impulses · Innovations Kommunikation & Wirtschaft GmbH, Oldenburg, Kommunikation & Wirtschaft GmbH, Oldenburg, in in Zusammenarbeit mit der Industrie- und cooperation with Schwerin Chamber of Industry and Handelskammer zu Schwerin, Klaus Uwe Scheifler, Commerce, Klaus Uwe Scheifler, Head of Depart- Geschäftsbereichsleiter Existenzgründung und ment, Business start-ups, Enterprise promotion, Unternehmensförderung, Innovation und Umwelt Innovation, Environment Autoren: Barbara Arndt, Manuela Heberer, Authors: Barbara Arndt, Manuela Heberer, Manuela Kuhlmann, Berit Sörensen Manuela Kuhlmann, Berit Sörensen 2 VORWORT I FOREWORD Fotos/photo: © Petra -

Sehr Geehrte Angelfreundinnen Und
Sehr geehrte Angelfreundinnen und Angelfreunde, liebe Mitglieder des Landesanglerverbandes, das vorliegende Gewässerverzeichnis des Landesanglerverbandes Mecklenburg- Vorpommern e.V. enthält eine Zusammenstellung aller Gewässer, die mit der Lan- desangelkarte des LAV beangelt werden können. Das Verzeichnis ist ab dem 01. Januar 2011 gültig. Es ist dem LAV M-V e.V. – wie in den Jahren zuvor – wieder gelungen, einige neue Seen und Fließgewässer für unsere Angelberechtigungen zu gewinnen. Dies sind zum einen eigens angepachtete Gewässer als auch Gewässer der Berufsfischerei. Leider mussten jedoch auch einige Gewässer abgegeben werden. Das Gewässerverzeichnis ist übersichtlich nach Regionen gegliedert und enthält wichtige Informationen über unsere Verbandsgewässer und die Gewässer der Be- rufsfischerei. Außerdem enthält diese Ausgabe die aktuelle Gewässerordnung des LAV. Die Ge- wässer, die durch Vereinbarungen mit dem LAV M-V e.V. und der Berufsfische- rei für die Landesangelkarte freigegeben sind, werden in diesem Verzeichnis fett dargestellt und mit dem Buchstaben „BF“ zusätzlich gekennzeichnet. Auf diesen Gewässern gilt nicht die LAV-Gastangelberechtigung oder die LAV-Austauschan- gelberechtigung mit anderen Verbänden. Da es ständig zu einzelnen Änderungen, Neuanpachtungen oder Streichungen von Gewässern kommen kann, bitten wir alle Anglerinnen und Angler sich vor Beginn des Angelns ausreichend zu informieren. Dies betrifft insbesondere auch die Benutzung von Wasserfahrzeugen, das Betreten von bestimmten Uferregionen sowie die zeitweilige Sperrung von Gewässern oder Gewässerabschnitten aus fi- schereibiologischen oder naturschutzfachlichen Gründen. Alle wichtigen Informa- tionen dazu erhalten Sie in der Geschäftsstelle des LAV in Görslow (Tel.: 03860- 56030), unserer Verbandszeitung „angeln in Mecklenburg-Vorpommern“ oder im Internet unter www.lav-mv.de. Wir möchten an dieser Stelle auf das neue digitale Gewässerverzeichnis auf unsere Internetseite hinweisen. -

Geologische Sammlungsbestände in Museen Mecklenburg- Vorpommerns, S
Mitteilungen der NGM - 8. Jahrgang 2008, Heft 1: Krempien & Schulz, Geologische Sammlungsbestände in Museen Mecklenburg- Vorpommerns, S. 3-24 v^ Geologische Sammlungsbestände in Museen Mecklenburg- Vorpommerns WILFRIED KREMPIEN & WERNER SCHULZ Zusammenfassung Obgleich die Anfänge des Sammeins von Fossilien in Mecklenburg-Vorpommern bis in das 18. Jahrhundert zurückgehen, entstanden systematisch angelegte geologische Kollektionen erst mit der Gründung des Vereins der Freunde der Naturgeschichte in Mecklenburg ab 1847. Neben den Universitäten in Greifswald und Rostock baute das Maltzaneum in Waren eine geologische Sammlung auf. Die Erweiterung der Sammlungen erfolgt in Mecklenburg-Vorpommern gegenwärtig vor allem durch Übernahme von Nachlässen verstorbener privater Sammler. Die Sammlung an der Universität Rostock wurde mit der Schließung des geologischen Instituts 1968 aufgelöst. Ein Teil dieses Bestandes ist zusammen mit 67.000 Metern Bohrkernen in der Geologischen Landessammlung in Sternberg magaziniert. Heute verfügen 43 Museen in Mecklenburg-Vorpommern über geologische Bestände. Diese stammen häufig aus dem nahen Umland und weisen deshalb eine besondere Bedeutung für den Tourismus in der Region auf. 28 Findlingslehrpfade ergänzen die Museen. Abstract: First geological collections were erected in Mecklenburg-Vorpommern in the 18. century. In 1847 the Union of friends of natural science in Mecklenburg had stimulated the installation of private collections. Greater museums were builded in Rostock (liquidated 1968), in Greifswald, Waren and Sternberg. Today we have in Mecklenburg 43 museums with geological collections and 28 Abb. 1: David Franck (1682 - 1756), Direktor der glacial-boulder parks. Schule in Sternberg, später dort Pastor und Präpositus (= Probst). Er schrieb 1753 in „Altes und Schlüsselwörter: Geologie, Mecklenburg- neues Mecklenburg" von den „...Sandsteinen...auf Vorpommern, Geschichte der Sammlungen, dem Sternbergischen Stadtfelde.. -

Urban-Rural Partnerships Growth and Innovation Through Cooperation
Urban-Rural Partnerships Growth and innovation through cooperation Transport Mobility Housing Urban and Rural Areas Transport Mobility Housing Urban and Rural Areas www.bmvbs.de Transport Mobility Housing Urban and Rural Areas Transport Mobility Housing Urban and Rural Areas Transport 2 3 Urban-Rural Partnerships Growth and innovation through cooperation 4 5 Table of content Urban-Rural Partnerships Growth and innovation through cooperation Foreword 7 A pilot project for urban-rural partnerships – why and to what end? 8 Projects rather than programmes – What does MORO stand for? 10 On the term ‘urban-rural partnerships’ 10 A European project 11 An interview with Dr Dirk Ahner 12 Lessons learnt from the pilot projects 14 The power of cooperating 14 What does ‘variable geometry’ mean? 17 An interview with Lord Mayor Dr Maly 19 Specific, binding, and on equal terms 21 The pilot regions, geographical frameworks, organisation, projects 31 Regional partnership in northern Germany / Hamburg Metropolitan Region (MORO Nord) 32 Cooperation and networking in the north-east 40 Central German Metropolitan Region (formerly called Saxon Triangle) 46 WKI supra-regional partnership 53 Nuremberg Metropolitan Region 57 European Metropolitan Region Stuttgart 63 European Integrated Area Lake Constance 69 Contact points, links and bibliography 74 Publication data 76 6 7 Foreword One vital hallmark of a successful policy is that it is beneficial not only for one group of people but takes the entire population and their interests into consideration. This is also true for issues relating to urban and rural areas. Time and again there have been approaches according to which the two were to be treated separately, linked with a requirement to focus on one side or the other. -

Preface by Katharina Dujesiefken
BUND MECKLENBURG-VORPOMMERN Preservation and planting of trees on dams and dykes Conflicts - Solutions - Implementation PHOTO Common oak avenue at the Störkanal 2016 (Ralf Ottmann). Content | 5 Content 6 Preface 8 Different assessment of the effect of woody plants on dams and dykes 8 Legal significance of standards 10 What is a dam, what is a dyke? DEAR READERS, 11 Rehabilitation of dams with preservation of the tree population using the example of a Stör waterway When I first saw the oaks along the (Articles by Katharina Dujesiefken and Frank Chris- Stör-Canal, I was deeply impressed toph Hagen) by the beauty and grandeur of these sturdy trees. They have been stan- 12 History of the Stör waterway ding on the dam along the Canal for about 140 years. They always had 14 Dam reconstruction on the Stör waterway good growing conditions, enough (StW) - the planning approval decision 2013 space for the roots and enough wa- ter. No de-icing salt in winter, few 28 Reconstruction of dykes with preservation of the cuts, no root digging. The trees could tree population using the example of the Rhine simply develop wonderfully and so dyke in Neuss (Article by Dr. Ing. Lothar Wessolly) they stood there, one as beautiful as the other. But now they should 34 Animals at the dyke be felled with the renovation of the dams. It was immediately clear to 37 Instructions for planting on dams and dykes me that BUND, together with many allies, would have to find a solution 38 Literature that would make it possible to pre- serve this old Canal avenue. -
NGM 911 Forsmark-Brekzie
Mitteilungen der NGM – 9. Jahrgang, Heft 1: Zessin, W., Brekzien vom „Forsmark-Typ“ aus Mecklenburg,S. 87-89 Brekzien vom „Forsmark-Typ“ aus Mecklenburg WOLFGANG ZESSIN , Jasnitz Einleitung Ein interessanter Gesteinstyp im Verbreitungsgebiet eiszeitlicher Geschiebe ist die Brekzie. Brekzien sind Sedimentgesteine, die aus groben, eckigen Gesteinstrümmern bestehen, die durch ein feinkörniges Bindemittel (Matrix) verkittet sind, in unserem Falle durch Quarz. Sie treten in Norddeutschland in der Häufigkeit stark hinter andere Gesteine zurück. Die hier vorgestellten Brekzien vom Forsmark-Typ gehören in Mecklenburg zu den eher selteneren Geschieben. Den Namen hat dieser Gesteinstyp nach dem Ort Forsmark, in der Provinz Uppland in Schweden Abb. 1: Ansicht einer Forsmark-Brekzie vom erhalten, wo sich im Anstehenden solche Gesteine Strand bei Boltenhagen (Reddevitz), Mai 2009 vom finden. Jedoch deuten die unterschiedlichen Verfasser gefunden. Slg.: Dr. W. Zessin, Jasnitz, Gesteinsarten dieses Brekzientyps auf später Natureum am Schloss Ludwigslust unterschiedliche Herkunftsgebiete hin. Forsmark-Brekzie von Reddevitz bei Boltenhagen, West-Mecklenburg (Abb. 1-4) Diese Brekzie hat ihr Herkunftsgebiet im Uppland, Schweden bzw. (?) auf dem angrenzenden Ostseegrund. Auch andere Gebiete in Skandinavien sind nicht völlig auszuschließen. Anstehend ist ein Vorkommen bei Forsmark bekannt, dem das hier gezeigte Geschiebe ähnelt. Das Alter ist bisher unbekannt. Gekennzeichnet ist das Gestein durch seine roten bis braunen, stellenweise auch grauen eckigen, feinkörnigen, kaum differenzierten Abb. 2: Rückansicht einer Forsmark-Brekzie vom Trümmer, die durch teils als Kristalle ausgebildeten Strand bei Boltenhagen weißen Quarz verkittet sind. Als Ursache für diese Trümmergesteine kommen wenig verfrachteter Verwitterungsschutt, ein Bergsturz oder ein Meteoriteneinschlag infrage. Später kamen die Gesteinstrümmer unter Einfluss von hydrothermalem Wasser, in dem der Quarz teils in Kristallform die Spalten zwischen den Trümmern ausfüllte. -
Das Poeler Inselblatt Amtliches Bekanntmachungsblatt Der Gemeinde Ostseebad Insel Poel
INSEL POEL P Das Poeler Inselblatt Amtliches Bekanntmachungsblatt der Gemeinde Ostseebad Insel Poel OSTSEEBAD INSEL POEL Nr. 275 · 24. Jahrgang · Preis 1,00 E 1. September 2013 Bürgerschaftliches Engagement ist heute AUS DEM INHALT Wahlbekanntmachung ................ Seite 2 wichtiger denn je Satzung über die 1. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 12 „Wohngebiet Gutshof Vorwerk“.. Seite 3 Geburtstage .................................... Seite 4 Verwaltungsbericht ...................... Seite 4 Verein Poeler Leben e. V. ............... Seite 5 Neues rund um die 850-Jahr-Feier ................................. Seite 6 Glückwünsche zur Einschulung ............................. Seite 7 Inselpokal 2013 ............................... Seite 8 4. Poeler Abendlauf ....................... Seite 8 Ablauf der 90-Jahr-Feier des Poeler Sportvereins e. V. am 31.08.2013 Seite 10 Cap-Arcona-Lauf 2013 ................... Seite 10 Sportberichte .................................. Seite 11 V. l.: Der stellvertretende Landrat Gerhard Rappen und die Landrätin Birgit Hesse übergaben den Kirchennachrichten ...................... Seite 12 Poelern Marlies Grewsmühl, Gabriele Richter, Sabine Brauer, Sybille Thomas und Markus Frick eine Unser Gartentipp .......................... Seite 13 10 m lange Wimpelkette. Die Festveranstaltung zur Verleihung der „Eh- wicklung in Mecklenburg-Vorpommern. „Wir rennadel“ ist beim Landkreis Nordwestmeck- werden immer weniger und immer älter. Und lenburg seit vielen Jahren eine schöne Tradition. das hat auch Auswirkungen auf das Ehrenamt. -
Schloss Ludwigslust
© Schloss Ludwigslust Regina Schroeder Landesweit einmalige Kooperation entlang der A14 in Westmecklenburg A unique, state-wide cooperation along the A14 in West Mecklenburg Abkehr vom Kirchturmdenken: Drei Städte schließen sich zusammen, um gemeinsam ihre Rolle als Wirtschaftsregion im künftigen Kreuz A14/A24 auszubauen. A departure from parish-pump thinking: three towns are joining forces to strengthen their position as an economic region at the future A14/A24 junction. Der Landkreis Ludwigslust-Parchim spielt eine wirtschaft- The Ludwigslust-Parchim district plays a key economic lich gewichtige Rolle innerhalb des Landes Mecklen burg- role within the state of Mecklenburg-Western Pomerania. Vorpommern. Dies trifft insbesondere auch auf die Region This applies particularly to the region surrounding the rund um die Städte Grabow, Ludwigslust und Neustadt-Glewe towns of Grabow, Ludwigslust and Neustadt-Glewe. The zu. Die drei Kommunen haben sich zusam mengeschlossen, three municipalities have teamed up to exploit the oppor- um die Chancen des Südausbaus der A14 gezielt zu nutzen. tunities presented by the extension of the A14 to the Unterstützt werden sie dabei vom Landkreis Ludwigslust- south. They receive support from the district of Lud- Parchim und der Wirtschaftsförderungsgesellschaft Südwest- wigslust-Parchim and the South-West Mecklenburg busi- mecklenburg sowie durch Förderung des Landes M-V. Im er ness development agency, along with federal state sten Schritt wurde im Auftrag der Städtekooperation durch funding. The first step for the municipal cooperation in die cima Beratung + Management GmbH aus Lübeck im 2015 was to commission cima Beratung + Management Jahr 2015 ein regionales Entwicklungskonzept (REK) A14 GmbH in Lübeck to prepare an A14 regional development erarbeitet, um die Auswirkungen durch die Südverlängerung plan, which evaluated the impact of the extension of der A14 bis Magdeburg zu untersuchen und konkrete Maß- the A14 as far as Magdeburg in the south and drew up nahmen für die gezielte regionale Entwicklung abzuleiten. -

Rote Liste Der Gefährdeten Egel Und Krebsegel Mecklenburg
Rote Liste der gefährdeten Egel und Krebsegel M ecklenburg E 2 4 Vorpommern I Ministerium für Landwirtschaft, Umwelt und Verbraucherschutz Rote Liste Egel Inhalt_Rote Liste Wasserkaefer Inhalt 09.12.13 17:01 Seite 1 Rote Liste der Egel und Krebsegel Mecklenburg-Vorpommerns 1. Fassung Stand: Februar 2013 Bearbeiter und Verfasser: Uwe Jueg (Ludwigslust) Rote Liste Egel Inhalt_Rote Liste Wasserkaefer Inhalt 09.12.13 17:01 Seite 2 Herausgeber: Ministerium für Landwirtschaft, Umwelt und Verbraucherschutz Mecklenburg-Vorpommern Bearbeiter: Uwe Jueg Georgenhof 30 19288 Ludwigslust Titelfoto: Medizinischer Blutegel (Hirudo medicinalis), am Ackersoll bei Werle Rücktitel: Medizinischer Blutegel (Hirudo medicinalis) beim Saugen Fotos: Uwe Jueg; Ausnahmen: Dr. Michael Zettler (Piscicola kusznierzi) und John Hesselschwerdt (Glossiphonia paludosa) Karten: Uwe Göllnitz Herstellung: Turo Medien Druck GmbH Papier: Umschlag chlorfrei gebleicht Inhalt 100 % Recycling ISSN: 1436-3402 Rote Listen der in Mecklenburg-Vorpommern gefährdeten Pflanzen und Tiere Rote Liste Egel Inhalt_Rote Liste Wasserkaefer Inhalt 09.12.13 17:01 Seite 3 INHALTSVERZEICHNIS Vorwort zur 1. Fassung 5 1 Einleitung 6 2 Die Methode der Gefährdungseinstufung nach LUDWIG et al. (2009) 8 2.1 Gefährdungskategorien 8 2.2 Kriteriensystem 10 2.3 Risikofaktoren 12 2.4 Kriterienklassen und ihre Symbole 13 2.5 Schwellenwerte 14 2.6 Einstufungsschema 14 2.7 Zusatzangaben 16 3 Rote Liste der Egel und Krebsegel Mecklenburg-Vorpommerns 16 4 Bilanzierung und Bewertung 17 5 Gefährdungsursachen 19 6 Raumbedeutsamkeit 20 7 Kurzmonografien zu den in Gefährdungskategorien eingestuften Arten 22 8 Checkliste der Egel und Krebsegel mit ihrer Gefährdung in Mecklenburg-Vorpommern 46 9 Danksagung 47 10 Literatur 48 Rote Liste Egel Inhalt_Rote Liste Wasserkaefer Inhalt 09.12.13 17:01 Seite 4 Rote Liste Egel Inhalt_Rote Liste Wasserkaefer Inhalt 09.12.13 17:01 Seite 5 5 Vorwort zur 1. -

Business in West Mecklenburg Setting Sail Together
BUSINESS IN WEST MECKLENBURG SETTING SAIL TOGETHER 1 2 WEST MECKLENBURG ECONOMIC REGION SETTING SAIL TOGETHER The west of the Federal State of Mecklenburg-Vorpommern, which is at the same time the eastern part of the Metropolitan Region of Hamburg, directly on the Baltic Sea and close to the Metropolitan Region of Berlin: West Mecklen- burg is located in the middle of North Germany. It simultaneously connects the economic regions of Western and Eastern Europe and as well as Central and Southern Europe with Scandinavia as the intersection of three European traffic corridors. This location, combined with a modern infrastructure, high-capacity traffic routes and well-developed and cost-effective commercial and industrial sites, make West Mecklenburg an ideal location for your investment. Our region has developed into an attractive place to live and work. Traditio- nally strong in sectors such as shipbuilding, the food industry or mechanical engineering, a modern industrial policy based on the expansion of renewable energy and the promotion of future-oriented fields such as the health eco- nomy or information and communication technology has contributed to West Mecklenburg’s resurgence in recent years. The human factor and the sustaina- bility of development with a view to maintaining our pleasant-to-live-in region, which is more than averagely well endowed with unspoiled nature and culture, have always played an important role. Editorial I 1 The slogan “a region to live and work in” expresses this claim to fame well. Convin- cing arguments also for the well-educated and motivated workers of the region. This publication is intended to make you curious, invites you to get to know the region and its economic structure and compactly summarises further argu- ments in favour of your investment in West Mecklenburg. -

GUTES AUS DER REGION Werksverkäufe in Westmecklenburg VORWORT
GUTES AUS DER REGION Werksverkäufe in Westmecklenburg VORWORT In Westmecklenburg, das heißt im Menschen und Besuchern der Region in ihren Werks- oder Fa- Landkreis Ludwigslust-Parchim, der brikverkaufsstellen anbieten. „Made in Westmecklenburg“ Landeshauptstadt Schwerin und dem heißt es bei vielen Produkten, die national und weltweit vertrie- Landkreis Nordwestmecklenburg bie- ben werden, ohne dass es vielen Menschen bewusst ist. ten sich den Einwohnern gute Arbeits- bedingungen bei sehr hoher Lebens- „Ich habe gar nicht gewusst, dass diese Produkte aus West- qualität. Die Nähe zum Wasser der mecklenburg kommen!“, das ist die Reaktion, die wir uns mit Seen und Flüsse und zur Ostsee und diesem Projekt als Verein wünschen. Denn auch das gehört die Weite des Landes, die für Freizeit- dazu, eine attraktive Region noch bekannter zu machen. sportler viele Möglichkeiten bietet, machen unsere Region zur Heimat zum Leben und Arbeiten. Entdecken Sie ein paar Geheimtipps, besuchen Sie die Anbie- ter vor Ort und testen Sie die regionalen Produkte direkt beim Der Mittelstand prägt die wirtschaftliche Landschaft, die Produzenten. gut entwickelt und stabil die Basis für die Weiterentwick- lung der Region bildet. Unser Verein Regionalmarketing Herzlich willkommen in Westmecklenburg! Mecklenburg-Schwerin e.V. repräsentiert viele der hier ansäs- sigen Branchen, vom produzierenden oder verarbeitenden Be- trieb über Dienstleister, das Handwerk bis hin zu Arbeitgebern aus dem sozialen Bereich. Mit dieser Publikation ist es uns gelungen, diejenigen Unter- Diedrich