Neujahrsblatt 20
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

Terza Schiessen 2019 SV Quarten-Oberterzen
Terza Schiessen 2019 SV Quarten-Oberterzen Amden, Schützen Gmür Ivo Obdorfstr. 9 8873 Amden Vereinsabrechnung Vereinswettkampf Vereinskategorie 1 Vereinsschützen / Pflichtteilnehmer 28 / 14 Pflichtteilnehmer Gmür Benedikt V 57-03 95 Gmür Rolf S 57-03 95 Büsser Elmar V 57-03 95 Gmür Peter E 57-03 94 Bachmann Peter E 57-03 94 Gmür Roman E 90 94 Gmür Reto E 57-03 93 Thoma Franz SV 57-03 93 Gmür Ivo E 90 93 Gmür Urs S 57-03 93 Büsser Ivan S 90 92 Büsser Mario V 57-03 92 Büsser Max V 57-03 92 Gmür Alois V 57-03 92 1307 Nicht-Pflichtteilnehmer Gmür Benjamin S 90 91 Büsser Hanspeter E 57-03 91 Gmür Stefan E 57-03 90 Thoma Karl SV 57-03 90 Thoma Werner V 90 90 Gmür Max SV 57-03 88 Rüdisüli Markus E 90 87 Rüdisüli Koni V 57-03 87 Thoma Edgar S 90 86 Thoma Gallus SV 90 86 Gmür Albin SV 57-03 86 Thoma Toni V 90 85 VereinsWK 3.8 copyright by Indoor Swiss Shooting AG, 9200 Gossau www.IndoorSwiss.ch Terza Schiessen 2019 SV Quarten-Oberterzen Gmür Ralph E 57-03 84 Spörri Hans V 57-03 67 1208 Pflichtresultat +Zuschlag Nichtpflichtresultate / Pflichtteilnehmer = Resultat 1307 24.160 14 95.083 VereinsWK 3.8 copyright by Indoor Swiss Shooting AG, 9200 Gossau www.IndoorSwiss.ch Terza Schiessen 2019 SV Quarten-Oberterzen Einzelresultate Sportgerät Resultat Auszeichnung Auszahlung 225502, Bachmann Peter, Amden, 1977, E Vereinsstich 57-03 94 Honig 138204, Büsser Elmar, Schänis, 1959, V Vereinsstich 57-03 95 Honig Mouchen-Joker 57-03 96 Ja 138193, Büsser Hanspeter, Amden, 1975, E Vereinsstich 57-03 91 Kranzkarte Mouchen-Joker 57-03 95 138202, Büsser Ivan, Amden, -

Qualifikation JS Cup 2019 RSV See-Gaster Schmerikon
Qualifikation JS Cup 2019 RSV See-Gaster Schmerikon R Namen Vornamen Verein Resultat 1 Büsser Sarina Weesen, SV 867 2 Schmucki Silja Weesen, SV 867 3 Schönenberger Barbara Ricken SG 859 4 Gmür Rahel Weesen, SV 854 5 Hämmerli Rico Weesen, SV 845 6 Meier Christian Rufi-Maseltrangen MSV 838 7 Nievergelt Janis Schmerikon SV 836 8 Müller Flurin Eschenbach-Neuhaus SG 828 9 Kostenzer Sandro Gommiswald SV 826 10 Kaufmann Claudio Rufi-Maseltrangen MSV 821 11 Schmucki Lara Weesen, SV 814 12 Rieser Jeremias Weesen, SV 812 13 Eichmann Linda Ricken SG 799 14 Meier Eliane Rufi-Maseltrangen MSV 798 15 Kaufmann Jonas Gommiswald SV 790 16 Bösch Philipp Gommiswald SV 789 17 Müller Levin Weesen, SV 789 18 Miyatani Stefanie Weesen, SV 775 19 Forrer Gabriela Ricken SG 774 20 Bürge Mattia Uznach SV 765 21 Schmucki Norea Weesen, SV 763 22 Bösch Iris Uznach SV 762 23 Miyatani Ondine Weesen, SV 759 24 Büsser Chrys Eschenbach-Neuhaus SG 757 25 Zedan Seneddin Rapperswil STDS 755 26 Kaufmann Andreas Rufi-Maseltrangen MSV 754 27 Ruoss Tobias Gommiswald SV 753 28 Weissen Flurin Eschenbach-Neuhaus SG 752 29 Britt Ramon Ricken SG 752 30 Läubli Robin Ricken SG 751 31 Britt Jasmin Ricken SG 733 32 Rüdisüli Markus Amden Schützen 730 33 Schönenberger Katharina Ricken SG 728 34 Hegner Ivo Rufi-Maseltrangen MSV 728 35 Menzli Janine Schmerikon SV 727 36 Schubiger Björn Gommiswald SV 725 37 Oehninger Nadjne Eschenbach-Neuhaus SG 724 38 Oberle Patricia Schmerikon SV 707 39 Kuhn Nijal Amden Schützen 704 40 Rupflin Leonie Rufi-Maseltrangen MSV 704 41 Blöchlinger Kilian Eschenbach-Neuhaus -

Linthsicht 57 April20
NR. 57 / APRIL 2020 100 % Wirkung durch 100 % * Abdeckung *Amtliche Sendung in ALLE Haushaltungen LinthSichtAmtliche Mitteilungen aus Benken, Kaltbrunn, Schänis und Uznach BENKEN KALTBRUNN SCHÄNIS UZNACH «Vision Benken 2030» – Grosse Solidarität! Entlastung Verkehrs Ertragsüberschuss von Ein neues Leitbild knoten SäumergutFeld 1,54 Mio. Franken Seite 2 Seite 6 Seite 10 Seite 17 miteinander füreinander miteinander füreinander miteinander füreinander miteinander füreinander miteinander füreinander miteinander füreinander miteinander füreinander miteinander füreinander mit einander füreinander miteinander füreinander miteinander füreinan der miteinander füreinander miteinander füreinander miteinander miteinander füreinanderCovid19: Hilfsmassnahmen miteinander in den füreinander Gemeinden miteinander füreinander miteinanderSolidarität füreinander und miteinanderUnterstützung füreinander miteinander füreinander miteinander Seitenfüreinander 24 – 25 miteinander füreinander mit einander füreinander miteinander füreinander miteinander füreinan der miteinander füreinander miteinander füreinander miteinander miteinander füreinander miteinander füreinander miteinander füreinander miteinander füreinander miteinander füreinander miteinander füreinander miteinander füreinander miteinander füreinander mit einander füreinander miteinander füreinander miteinander füreinan der miteinander füreinander miteinander füreinander miteinander miteinander füreinander miteinander füreinander miteinander füreinander miteinander füreinander miteinander füreinander -

Erstkommunion, Festtag Für Amden, in Weiss
- Hallenbad Eröffnungs fest 22. Juni Die Zeitung der Gemeinde Amden Herausgeber: Gemeinde Amden Nr. 6 / Juni 2019 www.gemeinde-amden.ch Nr. 250 Erstkommunion, Festtag für Amden, in Weiss Der Weisse Sonntag ist ein Fest für die zwei Buben und drei Mädchen aus Am- den. Die Sonnenstrahlen fehlen an diesem winterlichen Maitag, dafür blickt Pfarrer Victor Buner, wie er bei der Eröffnung sagt, in viele frühlingshafte Gesichter. Von Cornelia Rutz Die Musikgesellschaft Amden hält sich für einmal auf der Empore bereit. Das Wetter ist zu nass und zu kalt für die feierliche Prozes- sion zur Kirche. Schneeflocken dominieren an diesem Tag. Freunde, Verwandte und Be- kannte warten in der Kirche an der Wärme auf die fünf Erstkommunikanten. Mit der brennenden Taufkerze in der Hand – festlich gekleidet in eleganten weissen Röcken und passendem Haarschmuck die Mädchen, mit bestickten Ammler Küttis die zwei Knaben – schreiten die Erstkommunikanten erwar- tungsvoll Richtung Altar. Das Bild des Hir- ten, welches vor der Renovation der Kirche über dem Hochaltar war, ist extra für diesen Tag aufgestellt worden. «Der gute Hirte» ist Die Erstkommunikanten mit Doris Santavenere und Pfarrer Victor Buner. (vl) Franco Böni, das Motto an diesem Weissen Sonntag. «Ar- Fabian Fischli, Carla Rüdisüli, Carina Jöhl und Riana Jöhl beit ist nicht die erste Bestimmung Gottes. Bild: Cornelia Rutz Wir sehen Kerzen, Blumen, festliche Ge- wänder. Musik und Gesang begleiten uns an diesem Tag. Auch Jesus hat gefeiert mit sei- klässler auf den grossen Festtag vorbereitet. nen Jüngern. Deshalb dürfen wir hier in der In Quarten im Zentrum Neu-Schönstatt ha- Kirche die Eucharistie feiern und sind Jesus ben sich die Kinder mit ihren Eltern zudem In dieser Ausgabe: so jedes Mal ganz nahe und spüren seine an zwei Tagen auf den Weissen Sonntag spe- Kolumne 8 Gegenwart», erläutert Pfarrer Victor Buner. -

Gemeinde Schänis Nr
Schänis Herausgeber: Gemeinde Schänis Nr. 30 Dezember 2008 Als Knecht und Magd zusammengefunden Am 13. November durften Josef und Elsa Steiner-Aebli ihre Diamantene Hochzeit feiern. 60 Jahre Freud und Leid gemeinsam getragen – ein solch einmaliges Jubiläum darf gebührend gefeiert werden. Schänis ist nicht China Von Irene Riget-Rüttimann «Manchmal möchte ich ein Chinese sein. Vorzugsweise Bürgermeister Zu Besuch beim Jubilarenpaar in der Untermatt, ein Ja-Wort in der Klosterkirche von Schanghai oder Kanton.» So habe ich schon gedacht; und zwar trister Novembertag, die leise tickende Wanduhr ver- ganz klar nicht aus Eitelkeit oder Grössenwahnsinn. Sondern wenn strömt Gemütlichkeit in der warmen Stube. Gerahmte Am 13. November vor 60 Jahren war es also, als sich ich im Fernsehen mitansehen konnte oder musste, wie rasch dort Bilder auf dem Stubenbuffet zeigen pausbäckige Gross- die beiden das Ja-Wort in der Klosterkirche in Ein- Städte wachsen, wie in kürzester Zeit die grössten Hochhäuser zum kinder und glückliche junge Menschen. Bilder, die siedeln gaben. «Mir händ en eifachs Hochzig gha», Himmel gezogen werden. an Geburten, Hochzeiten und Familienfeste erinnern. erinnert sich Elsa, welche für jene Zeit üblich in Und ich in Schänis habe den Stein des Sisyphus zur Federi zu rollen, Gründe zum Feiern gab es in der Kürze einige bei schwarz heiratete. Zu fünft reiste das Brautpaar mit unentwegt und immer wieder. Statt grosse Würfe zu machen, habe Steiners, genannt ‹Untermättlers›. Im Laufe des Jahres einem Chauffeur ins Klosterdorf. Als Trauzeugen ich mich mit mühsamen Kleinigkeiten abzuplagen: Mit unerlaubten wurden die beiden Urgrosskinder Marina und Nicole standen ihnen Josef’s jüngerer Bruder Fredi sowie Auffüllungen, widerrechtlich erstellten Bauten und falsch bewirt- geboren, was den Jubilaren eine besondere Freude ist. -

Blick in Vergangenheit Und Zukunft Mit the Servelats
Die Zeitung der Gemeinde Amden Herausgeber: Gemeinde Amden Nr. 3 / März 2020 www.gemeinde-amden.ch Nr. 259 Blick in Vergangenheit und Zukunft mit The Servelats The Servelats, die Schnitzelbank-Grup- pe, kündigte mit «Schnitzelbängg10» die Jubiläums-Ausgabe an. Was die hoch- musikalische siebenköpfige Männergrup- pe im Jahr 2019 erfahren und zu Versen verarbeitet hat, haben die Ammler am Schmudo erfahren. Von Rita Rüdisüli Sie haben die Ammler Fasnacht wiederbe- lebt. Zusammen mit anderen Fasnachts- gruppen - z.B. den Ammler Wibern, den Vorderberg Piraten und den bunten Lolli- pops - sorgen sie Jahr für Jahr für Unter- haltung im Dorf, im Altersheim und privat. In gedruckter Form gibt es die vielfältigen Schnitzelbank-Verse seit dem Jahr 2013. Damals haben sich fünf junge, unterneh- mungslustige, musikalische Männer mit dem damaligen Maskottchen der Ammler Zitig, dem berühmten Amm-Li verbr(l) üder(l)t. Thematisiert wurden darin des The Servelats unterstützen künftig an Pilztagen die Feuerwehr von Amden. hinten (vl) Michi Försters Käfer-Christbäume, das neue Er- Frepp, Mario Figallo, Ignaz Gmür, Peter Rüdisüli, vorne (vl) Marc Thoma, Tobias Gmür, lebnisbad, Skiclub-Fotos und die flianische Hanspeter Büsser Bild: zvg Fedi-Verkehrsberuhigung. Offensichtlich kamen nicht alle Servelats-Verse gut an, dem Rotlicht-Skandal im Tempelbezirk, Nun zierten neben den witzigen Sprüchen denn im Folgejahr trat das Team in Sträf- rutschenden Autos im Oktoberschnee und auch nicht ganz ernstzunehmende Inserate lingskleidung als Schnitzelknacker auf. Mit einem in Schieflage geratenen Hochsitz die Fasnachts-Zitig. Ob wirklich jemand brachten sie die Leute trotzdem zum La- seine Sense gegen den ferngesteuerten Mo- chen. Neues aus Schlumpfhausen gab es tormäher eintauschte, ist unbekannt. -
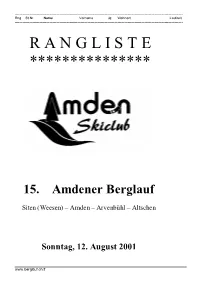
R a N G L I S T E ***************
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Rng St.Nr. Name Vorname Jg Wohnort Laufzeit ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ R A N G L I S T E *************** 15. Amdener Berglauf Siten (Weesen) – Amden – Arvenbühl – Altschen Sonntag, 12. August 2001 www.berglauf.ch.tf ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Rng St.Nr. Name Vorname Jg Wohnort Laufzeit ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Sponsoren & Gönner Architekturbüro Hans Jöhl, Hagstr. 3, 8873 Amden Arondo AG, Hauptstr. 54, 8868 Oberurnen Bäckerei/Konditorei Amman, Oberrütelistr. 7, 8753 Mollis Bartel-Druckerei, Bahnhofstr. 15, 8750 Glarus Blumengeschäft Strub, Spittelstr. 24, 8872 Weesen Cafe Post, Dorfstr., 8873 Amden CSS-Versicherung, Dorfstr.1, 8873 Amden Drogerie Kundert, Dorfstr., 8873 Amden Eberle Sport AG, Bahnhofstr. 22, 8753 Mollis Eberle Sporthus, Hinterbergstr. 2, 8873 Amden Electrotex AG, Landstr. 54, 8868 Oberurnen Elektro B, Dorfstr. 23, 8873 Amden Fridolin-Sport, Bankstr. 46, 8750 Glarus Gebr. Thoma, Hofstettenstr. 10, 8873 Amden Gmür Benjamin, Kundenmaurer, Arvenbüehlstr. 24, 8873 Amden Gmür Urs, Keram. Plattenbeläge, Natursteinarbeiten, -

Rangliste 300M
Regionalschützenverein See - Gaster www.rsv-see-gaster.ch Rangliste Feldschiessen 2016 300m rang namen vorname geboren kurz sektionsname waffe resultat 1 Thoma Karl 22.05.1948 V Amden Mattstockschützen Stgw 57 72 2 Gmür Peter 05.02.1974 A Amden Mattstockschützen Stgw 57 72 3 Widmer Marc 11.06.1983 A Schmerikon SV Stgw 90 71 4 Rüdisüli Anita 06.10.1997 J Benken SG Stgw 90 70 5 Stoob Hans 23.10.1959 A Gommiswald SV Stgw 57 70 6 Hämmerli Peter 04.10.1965 A Weesen SV Stgw 57 70 7 Blöchlinger Thomas 02.01.1970 A Gommiswald SV Stgw 90 70 8 Müller Ruedi 11.03.1981 A Eschenbach-Neuhaus SG Stgw 90 70 9 Schuppli Pascal 01.01.1999 J Rufi-Maseltrangen MSV Stgw 90 69 10 Bachmann Ramona 21.03.1998 J Weesen SV Stgw 90 69 11 Trümpi Jakob 18.05.1934 SV Rapperswil Stadtschützen Stgw 57 69 12 Gmür Beni 06.03.1958 A Amden SG Churfirsten Stgw 57 69 13 Duft Marcel 01.01.1960 A Rufi-Maseltrangen MSV Stgw 90 69 14 Rüegg Heiri 20.03.1961 A Walde-St.Gallenkappel SV Stgw 57 69 15 Raymann Hubert 11.10.1961 A Walde-St.Gallenkappel SV Stgw 57 69 16 Müller Marcel 01.09.1962 A Uznach SV Stgw 90 69 17 Sennhauser Beat 30.06.1970 A Ricken SG Stgw 57 69 18 Bachmann Peter 03.03.1977 A Amden Mattstockschützen Stgw 90 69 19 Gmür Ivo 01.08.1980 A Amden SG Churfirsten Stgw 90 69 20 Gmür Reto 05.04.1981 A Amden Mattstockschützen Stgw 57 69 21 Bischof Marco 20.09.1988 A Amden Mattstockschützen Stgw 90 69 22 Egli Adrian 01.01.1995 A Rufi-Maseltrangen MSV Stgw 90 69 23 Meile Thomas 01.01.1945 SV Uznach SV Stgw 90 68 24 Drexel Bruno 24.01.1948 V Kaltbrunn FSG Stgw 57 68 25 Thoma -
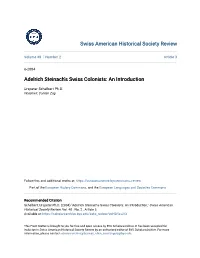
Adelrich Steinach's Swiss Colonists: an Introduction
Swiss American Historical Society Review Volume 40 Number 2 Article 3 6-2004 Adelrich Steinach's Swiss Colonists: An Introduction Urspeter Schelbert Ph.D. Walchwil, Canton Zug Follow this and additional works at: https://scholarsarchive.byu.edu/sahs_review Part of the European History Commons, and the European Languages and Societies Commons Recommended Citation Schelbert, Urspeter Ph.D. (2004) "Adelrich Steinach's Swiss Colonists: An Introduction," Swiss American Historical Society Review: Vol. 40 : No. 2 , Article 3. Available at: https://scholarsarchive.byu.edu/sahs_review/vol40/iss2/3 This Front Matter is brought to you for free and open access by BYU ScholarsArchive. It has been accepted for inclusion in Swiss American Historical Society Review by an authorized editor of BYU ScholarsArchive. For more information, please contact [email protected], [email protected]. Schelbert: Adelrich Steinach's Swiss Colonists: An Introduction ADELRICH STEINACH' S SWISS COLONISTS: AN INTRODUCTION Among the millions of immigrants to the United States the Swiss constitute only a small group. Their involvement in the emergence of the United States to date has been portrayed only selectively or in relatively brief encyclopedic entries. 1 But a vast number of essays and books on individual men and women, families, and settlements do exist.2 The book Geschichte und Leben der Schweizer Kolonien in den Vereinigten Staaten von Nordamerika, however, compiled in the 1880s in collaboration with the North American Griitli-Bundby the Swiss physician Adelrich Steinach residing in New York City, is an early attempt at presenting an overview of the involvement of Swiss in the history of the United States. -

Schau- Und Lehrbienenstand Kaltbrunn Seite 25
NR. 63 / OKTOBER 2020 100 % Wirkung durch % 100 * Abdeckung *Amtliche Sendung in ALLE Haushaltungen LinthSichtAmtliche Mitteilungen aus Benken, Kaltbrunn, Schänis und Uznach BENKEN KALTBRUNN SCHÄNIS UZNACH Gesamtverkehrskonzept Baufortschritt Rektorin für Vorschau aufs Budget 2021 Linthebene-Melioration Alters zentrum Sonnhalde die Schule Schänis und die Bürger- Seite 2 Seite 7 Seite 12 versammlung 2020 Seite 17 Bedeutende Naturoase in der Region: Schau- und Lehrbienenstand Kaltbrunn Seite 25 Entwicklung COVID-19- Schlechte Wiesenbestände Fallzahlen im Kanton in der Linthebene Seite 24 Seite 23 2 BENKEN LinthSicht – Nr. 63 / Oktober 2020 GEMEINDERAT Gesamtverkehrs konzept der Linth ebene- Melioration Cluster 1 Rietstrassen: Verkehrsanordnungen «Verbot für Motor wagen und Motorräder» mit Zusatz «Zubringerdienst und landwirtschaftlicher Verkehr gestattet» im Gebiet Kaltbrunn – Schänis – Benken. egen die im September 2019 übrigen Rekurse wurden ebenfalls Bilder gesucht. Bilder sprechen. Auch Ihres! Wer würde bei Nichtwissen hier verfügten Verkehrsanord abgewiesen, soweit darauf einzu schon eine bekannte Benkner Bank vermuten. nungen der drei politischen treten war. Das Verfahren ist in GGemeinden Schänis, Kaltbrunn und zwischen in Rechtskraft erwachsen. GEMEINDEVERWALTUNG Benken «Verbot für Motorwagen Grundlage für diese Verkehrs- und Motorräder» mit Zusatz «Zu an ordnungen bildet das Gesamt bringerdienst und landwirtschaft verkehrskonzept der Linthebene Fotos gesucht licher Verkehr gestattet» der Riet Melioration, Cluster 1. strassen im Gebiet Kaltbrunn – Die Beschilderungen der neuen für www.benken.ch Schä nis – Benken gingen fristge Verkehrsanordnungen werden die urzeit wird unser Internet an [email protected] und erteilen recht mehrere Rekurse beim Sicher drei politischen Gemeinden Kalt auftritt www.benken.ch Sie uns dazu die freie Bildverwen heits und Justizdepartement in brunn, Schänis und Benken ge komplett neu gestaltet. -

Gesamtrangliste
LinthCUP Ski Skiclub Snowboard Langlauf Schänis Polysport www.scschaenis.ch Gesamtrangliste Hauptsponsoren Einzel-Ranglisten JO Kids Mädchen Kategoriensponsor: Lina Burlet Rang Name Club Punkte Rennen 1 Mettler Lorena (2008) Schänis 540 6 2 Huber India (2009) Schänis 500 6 3 Jöhl Riana (2009) Amden 330 6 4 Luck Livia (2009) Goldingen 304 6 5 Glarner Elin (2008) Kaltbrunn 290 6 6 Mattes Céline (2009) Gommiswald 284 6 7 Steiner Jasmin (2009) Gommiswald 224 6 8 Amstad Moana (2008) Gommiswald 194 6 9 Seliner Nina (2009) Schänis 190 5 10 Murer Milly (2009) Amden 189 6 11 Mettler Celestina (2010) Schänis 184 5 12 Keller Celine (2010) Gommiswald 158 6 13 Gmür Jenny (2008) Amden 158 4 14 Steinauer Kaja (2009) Gommiswald 154 4 15 Amstad Jamie (2010) Gommiswald 145 6 16 Lendi Ronja (2011) Kaltbrunn 131 6 17 Grob Laraina (2010) Gommiswald 124 5 18 Mathies Alina (2011) Gommiswald 111 5 19 Kobler Vivien (2009) Gommiswald 98 3 20 Gmür Siara (2008) Kaltbrunn 98 2 21 Müller Leonie (2009) Gommiswald 78 2 22 Meier Ariane (2011) Schänis 75 4 23 Sutter Mara (2012) Kaltbrunn 68 4 24 Bachmann Laura (2008) Gommiswald 68 3 25 Bachmann Mia (2014) Amden 66 4 26 Rüdisüli Carla (2010) Amden 60 2 27 Zahner Angelina (2008) Schänis 46 2 28 Giger Nives (2008) Schänis 44 2 29 Kamer Simona (2010) Schänis 43 2 30 Gnädinger Yanika (2011) Gommiswald 42 2 31 Gnädinger Nerina (2009) Gommiswald 41 2 32 Rüdisüli Sina (2012) Amden 35 2 33 Rüdisüli Franca (2012) Amden 31 2 34 Heusser Lisa (2011) Kaltbrunn 29 3 35 Kempf Anna (2009) Schänis 26 2 36 Egger Livia (2012) Kaltbrunn 0 -

Amtsblatt Nr. 10 Vom 12. März 2021
Amtsblatt Nr. 10 12. März 2021 Staatskanzlei Schwyz Telefon 041 819 11 24 E-Mail: [email protected] Internet: www.sz.ch Kanton – Bezirke – Gemeinden 674 Volksrechte 674 Redaktionelle Hinweise 678 Einbürgerungsgesuche 679 Planungs- und Baurecht 679 Grundbuch 687 Gerichtliche Anzeigen 691 Konkurse 693 Schuldbetreibungen 695 Weitere amtliche Publikationen 696 Stellenangebote 702 Ausschreibung von Arbeiten und Lieferungen 703 Handelsregister 705 673 Kanton – Bezirke – Gemeinden Volksrechte Eidgenössische Volksabstimmung vom 7. März 2021 / Volksinitiative vom 15. Sep- tember 2017 «Ja zum Verhüllungsverbot» Ausser Betracht In Einge- Stimm- fallende Betracht gangene Gemeinden berech- Stimmzettel fallende Ja Nein Stimm- tigte Stimm- zettel leere ungültige zettel Schwyz 10625 6381 47 1 6333 3502 2831 Arth 7269 3808 24 1 3783 2197 1586 Ingenbohl 6109 3556 26 0 3530 1929 1601 Muotathal 2664 1418 6 1 1411 1044 367 Steinen 2703 1454 12 2 1440 890 550 Sattel 1357 767 2 0 765 534 231 Rothenthurm 1616 1000 4 0 996 782 214 Oberiberg 711 421 1 0 420 304 116 Unteriberg 1810 972 1 0 971 800 171 Lauerz 787 470 3 0 467 317 150 Steinerberg 720 395 0 0 395 294 101 Morschach 725 435 2 0 433 257 176 Alpthal 475 260 1 0 259 210 49 Illgau 613 315 3 0 312 215 97 Riemenstalden 56 28 0 0 28 16 12 Gersau 1546 827 0 2 825 453 372 Lachen 5399 2747 11 2 2734 1472 1262 Altendorf 4739 2505 16 0 2489 1514 975 Galgenen 3402 1668 7 1 1660 1036 624 Vorderthal 804 411 0 0 411 314 97 Innerthal 150 82 0 0 82 55 27 Schübelbach 5404 2362 12 0 2350 1526 824 Tuggen 2294 1028 8 0 1020 693 327 Wangen 3775 1851 8 1 1842 1182 660 Reichenburg 2412 1049 3 0 1046 695 351 Einsiedeln 11329 6534 28 0 6506 3878 2628 Küssnacht 8662 4982 28 0 4954 2603 2351 Wollerau 4750 2743 15 0 2728 1670 1058 Freienbach 10156 5527 39 3 5485 3122 2363 Feusisberg 3473 1894 6 0 1888 1128 760 Total 106535 57890 313 14 57563 34632 22931 Stimmbeteiligung 54.30 % 674 Nr.