Doku – Oder Was?
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

Transnational Media Events
TRANSNATIONAL MEDIATRANSNATIONAL EVENTS In September 2005, a newspaper in Denmark published 12 cartoons depicting Mohammed, the holy Prophet of Islam. Soon after publication, these pictures became part of various events, political projects and diplomatic action. All over the world, the cartoons – or interpretations of them – were connected to dis- cursive struggles that pre-existed their drawing and publication. The cartoon event thus extended well beyond its immediate dramatic phase of spring 2006, both into the past and the future, and became at least a small landmark case of post-9/11 global media history. TRANSNATIONAL MEDIA EVENTS In this book, a community of international media researchers collects some of the lessons learned and questions provoked and offered by media coverage of The MOHAMMED CARTOONS and the the Mohammed cartoons in 16 countries, ranging from Denmark, Egypt and Argentina to Pakistan and Canada. The book looks at the coverage of the car- IMAGINED CLASH of CIVILIZATIONS toons and related incidents through a number of conceptual lenses: political spin, free speech theory, communication rights, the role of visuals and images in global communication, Orientalism and its counter-discourses, media’s rela- tions to immigration policy, and issues of integration. Through this approach, the book aims at a nuanced understanding of the cartoon controversy itself as well as at more general insights into the role of the media in contemporary transnational and transcultural relations. Elisabeth Eide, Risto Kunelius & Angela Phillips -

Der Deutsche Free-TV-Markt: Chancen Für Neue Anbieter?
Marc Bauder Der deutsche Free-TV-Markt: Chancen für neue Anbieter? Arbeitspapiere des Instituts für Rundfunkökonomie an der Universität zu Köln Heft 153 Köln, im Januar 2002 Arbeitspapiere des Instituts für Rundfunkökonomie ISSN der Arbeitspapiere: 0945-8999 ISBN des vorliegenden Arbeitspapiers 153: 3-934156-43-6 Schutzgebühr 15,-- € Die Arbeitspapiere können im Internet eingesehen und abgerufen werden unter der Adresse http://www.rundfunkoekonomie.uni-koeln.de Mitteilungen und Bestellungen richten Sie bitte per Email an: [email protected] oder an die unten genannte Postanschrift Hohenstaufenring 57a D-50674 Köln Telefon: (0221) 23 35 36 Telefax: (0221) 24 11 34 Marc Bauder Der deutsche Free-TV-Markt: ∗ Chancen für neue Anbieter? Abbildungsverzeichnis ........................................................................................ V Tabellenverzeichnis ............................................................................................. V Abkürzungsverzeichnis ...................................................................................... VI 1. Einleitung .......................................................................................................1 1.1. Problemstellung ........................................................................................1 1.2. Zielsetzung der Arbeit ...............................................................................2 1.3. Vorgehensweise .......................................................................................3 1.4. Abgrenzungen -

Hans-Jochen HEMMLEB
Lebenslauf Vorname(n) Nachname(n) ANGABEN ZUR PERSON Hans-Jochen HEMMLEB St. Agatha-Weg 3A, I-39011 Lana (BZ) www.jochenhemmleb.com ANGESTREBTE STELLE BERUF Diplom-Geologe; freiberuflich tätig als Autor, Fachberater für Fernsehdokumentationen und ANGESTREBTE TÄTIGKEIT ANGESTREBTES STUDIUM Übersetzer (überwiegend im Bereich Bergsteigen und Alpingeschichte) SELBSTEINSCHÄTZUNG BERUFSERFAHRUNG Seit 1999 freiberuflich tätig bei diversen Verlagen in Deutschland, Österreich, Schweiz, England und den USA und für Fernsehgesellschaften (ZDF, ORF, Servus TV) s Hier Datum eingeben (von - bis) Momentan tätig als Autor bei AS-Verlag (Zürich, Schweiz; www.as-verlag.ch) und Tyrolia (Innsbruck, Österreich; www.tyrolia.at) und als Fachberater/Regisseur für Film- & Video- Produktionsfirma Planetwatch (Pörtschach, Österreich; www.planetwatch.at) bzw. Servus TV Zuvor Verlagstätigkeit als Autor, Herausgeber und/oder Übersetzer bei The Mountaineers (Seattle, USA) 1999-2000 und 2001-2002; Hoffmann & Campe (D) 1999-2001; AS-Verlag (CH) 2002 u. 2007 sowie seit 2015, Tyrolia (A) seit 2006, Herbig/Terra Magica (D) 2009, Carreg (GB) 2013, Egoth (A) 2014 SCHUL- UND BERUFSBILDUNG 2004-2005 Abschluss des Geologie-Studiums mit Diplom (sehr gut) 1992-1999 Studium der Geologie an der Johann-Wolfgang-Goethe-Universität Frankfurt am Main (D) Mai 1996 sechswöchige Praktikantentätigkeit an der University of Lusaka (Zambia, Ostafrika April-Juni 1997 dreimonatige Tätigkeit als Visiting Scientist am Institute of Geological & Nuclear Sciences in Dunedin (Neuseeland) 1982-1991 -

Download (954Kb)
COMMISSION OF THE EUROPEAN COMMUNITIES Brussels, 28.7.2004 SEC(2004) 1016 COMMISSION STAFF WORKING PAPER Annex to the Sixth Communication from the Commission to the Council and the European Parliament on the application of Articles 4 and 5 of Directive 89/552/EEC "Television without Frontiers", as amended by Directive 97/36/EC, for the period 2001-2002 {COM(2004)524 final} EN EN TABLE OF ANNEXES ANNEX 1 - Performance indicators ........................................................................................ 4 ANNEX 2 - Tables on the application of Articles 4 and 5 ...................................................... 6 ANNEX 3 - Application of Articles 4 and 5 in each Member State........................................ 8 ANNEX 4 - Summary of the reports from the Member States.............................................. 39 ANNEX 5 - Summary of the reports from the Member States of the European Free Trade Association participating in the European Economic Area ................... 114 ANNEX 6 - List of television channels in the European Union Member States which failed to achieve the majority proportion according to Article 4 ..................... 118 ANNEX 7 – Average transmission time of European works according to Article 4 taking audience shares of channels into account (“de-minimis-criterion”) .... 128 ANNEX 8 – List of television channels in the European Union Member States which failed to achieve the minimum proportion according to article 5 ................... 132 EN 2 EN This document complements the Sixth Communication from the Commission to the Council and the European Parliament on the application of Articles 4 and 5 of Directive 89/552/EEC 1 of 3 October 1989, as amended by Directive 97/36/EC 2 - hereinafter referred to as the “Television without frontiers” Directive - for the period 2001-2002. -

2009 Annual Report 25 Years of Satisfying Curiosity
2009 ANNUAL REPORT 25 YEARS OF SATISFYING CURIOSITY CANADA UNITED STATES LATIN AMERICA The world’s #1 nonfi ction media company MORE THAN 100 WORLDWIDE NETWORKS IN OVER 170 COUNTRIES AND 38 LANGUAGES UNITED KINGDOM EUROPE ASIA MIDDLE EASTST AFRICA AUSTRALIA DISCOVERY COMMUNICATIONS 2009 ANNUAL REPORT DEAR SHAREHOLDERS, 6% affi liate revenue growth. Internationally, Discovery’s networks leveraged the continued secular growth trends of As Discovery Communications celebrates our 25th pay-TV around the globe to expand its subscriber base and anniversary in 2010, we are proud to report that the state of deliver 9% affi liate revenue growth, excluding the impact of the company is strong and we are well positioned to deliver foreign currency fl uctuations. value for our shareholders by building upon our mission of Given the opportunities to further expand Discovery’s satisfying curiosity and making a difference as the world’s leadership overseas, near the end of 2009, we announced number one nonfi ction media company. that 18-year veteran Mark Hollinger would assume total This past year, in the face of the most challenging economic oversight of our international businesses. Elevating this environment in a generation, Discovery was able to function and placing it in the hands of one of our most increase top-line revenue and diligently cut costs, leading to experienced and capable leaders demonstrates our double-digit adjusted OIBDA and free cash fl ow growth. commitment and steadfast approach to expanding both our international revenues and margins. Overall, for the year, total revenue increased 2% to $3,516 million, primarily driven by 4% growth at U.S. -

„Spiegel.Tv“ Aktenzeichen
Zulassungsantrag der SPIEGEL TV GmbH für das Fernsehspartenprogramm „spiegel.tv“ Aktenzeichen: KEK 665 Beschluss In der Rundfunkangelegenheit der SPIEGEL TV GmbH, vertreten durch die Geschäftsführer Fried von Bismarck, Dirk Pommer und Cassian von Salomon, Brandstwiete 19, 20457 Hamburg, - Antragstellerin - w e g e n Zulassung zur Veranstaltung des bundesweiten Fernsehspartenprogramms „spiegel.tv“ hat die Kommission zur Ermittlung der Konzentration im Medienbereich (KEK) auf Vorlage der Medienanstalt Hamburg / Schleswig-Holstein (MA HSH) vom 13.04.2011 in der Sitzung am 10.05.2011 unter Mitwirkung ihrer Mitglieder Prof. Dr. Sjurts (Vorsitzende), Dr. Lübbert (stv. Vorsitzender), Dr. Brautmeier, Prof. Dr. Dörr, Fuchs, Dr. Grüning, Dr. Hege, Dr. Hor- nauer, Prof. Dr. Mailänder, Prof. Dr. Müller-Terpitz, Dr. Schwarz und Prof. Thaenert ent- schieden: Der von der SPIEGEL TV GmbH mit Schreiben vom 08.04.2011 bei der Medien- anstalt Hamburg / Schleswig-Holstein (MA HSH) beantragten Zulassung zur Ver- anstaltung des bundesweit verbreiteten Fernsehspartenprogramms spiegel.tv stehen Gründe der Sicherung der Meinungsvielfalt im Fernsehen nicht entge- gen. 2 Begründung I Sachverhalt 1 Zulassungsantrag Die Antragstellerin hat mit Schreiben vom 08.04.2011 bei der MA HSH die Zulas- sung für das Spartenprogramm spiegel.tv für die Dauer von zehn Jahren ab dem 01.06.2011 beantragt. Die MA HSH hat der KEK den Antrag mit Schreiben vom 13.04.2011 zur medienkonzentrationsrechtlichen Prüfung vorgelegt. 2 Programmstruktur und -verbreitung 2.1 Das Programm spiegel.tv ist als 24-stündiges Web-TV-Spartenprogramm in den Bereichen Reportage und Dokumentation geplant und soll die Themenbereiche Poli- tik, Zeitgeschehen, Gesellschaft, Wissenschaft und Technik behandeln. XXX ... 2.2 Das Programm spiegel.tv soll linear als Live-Stream in deutscher Sprache über das Internet unter der Adresse www.spiegel.tv verbreitet werden. -

Zulassungsantrag Der Discovery Communications Deutschland Gmbh Für Das Fernsehprogramm Discovery Channel Aktenzeichen: KEK 395
Zulassungsantrag der Discovery Communications Deutschland GmbH für das Fernsehprogramm Discovery Channel Aktenzeichen: KEK 395 Beschluss In der Rundfunkangelegenheit der Discovery Communications Deutschland GmbH, vertreten durch den Geschäfts- führer Dr. Patrick Hörl, Maximilianstraße 13, 80539 München, – Antragstellerin – Verfahrensbevollmächtigte: xxx ... w e g e n Verlängerung der Zulassung zur bundesweiten Veranstaltung des digitalen Fernseh- spartenprogramms „Discovery Channel“ hat die Kommission zur Ermittlung der Konzentration im Medienbereich (KEK) auf Vorlage der Bayerischen Landeszentrale für neue Medien (BLM) vom 23.01.2007 in der Sitzung am 06.03.2007 unter Mitwirkung ihrer Mitglieder Prof. Dr. Dörr (Vorsitzender), Prof. Dr. Huber, Dr. Lübbert, Prof. Dr. Mailänder, Dr. Rath-Glawatz und Prof. Dr. Sjurts entschieden: Der von der Discovery Communications Deutschland GmbH mit Schreiben vom 17.01.2007 an die Bayerische Landeszentrale für neue Medien (BLM) beantragten Verlängerung der Zulassung zur Veranstaltung des bundesweit verbreiteten Fernsehspartenprogramms Discovery Channel stehen Gründe der Sicherung der Meinungsvielfalt im Fernsehen nicht entgegen. 2 Begründung I Sachverhalt 1 Zulassungsantrag Mit Schreiben vom 17.01.2007 hat die Discovery Communications Deutschland GmbH („Discovery Communications Deutschland“) bei der BLM die Verlängerung der Zulassung für das bundesweite digitale Pay-TV-Spartenprogramm „Discovery Channel“ beantragt. Discovery Channel wird auf Grundlage einer bis zum 29.04.2007 befristeten Zulassung der BLM vom 29.04.1999 veranstaltet. Die BLM hat der KEK den Antrag mit Schreiben vom 23.01.2007 zur medienkonzentrations- rechtlichen Prüfung vorgelegt. 2 Programmstruktur, Verbreitung und Vermarktung Discovery Channel ist ein deutschsprachiges 24-stündiges Programm für Dokumen- tarfilme und Reportagen zu Themenbereichen wie Wissenschaft, Technik, Gesund- heit, Reisen und Abenteuer. Es wird verschlüsselt auf der Programmplattform der Premiere Fernsehen GmbH & Co. -

Download (1049Kb)
COMMISSION OF THE EUROPEAN COMMUNITIES Brussels, 22.7.2008 SEC(2008) 2310 COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT Accompanying document to the COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT, THE COUNCIL, THE EUROPEAN ECONOMIC AND SOCIAL COMMITTEE AND THE COMMITTEE OF THE REGIONS Eighth Communication on the application of Articles 4 and 5 of Directive 89/552/EEC ‘Television without Frontiers’, as amended by Directive 97/36/EC, for the period 2005- 2006 [COM(2008) 481 final] EN EN TABLE OF CONTENTS BACKGROUND DOCUMENT 1: Performance indicators...................................................... 3 BACKGROUND DOCUMENT 2: Charts and tables on the application of Articles 4 and 5... 6 BACKGROUND DOCUMENT 3: Application of Articles 4 and 5 in each Member State ... 12 BACKGROUND DOCUMENT 4: Summary of the reports from the Member States ........... 44 BACKGROUND DOCUMENT 5: Voluntary reports by Bulgaria and Romania................. 177 BACKGROUND DOCUMENT 6: Reports from the Member States of the European Free Trade Association participating in the European Economic Area ......................................... 182 BACKGROUND DOCUMENT 7: Average transmission time of European works by channels with an audience share above 3% .. ........................................................................ 187 BACKGROUND DOCUMENT 8: List of television channels in the Member States which failed to achieve the majority proportion required by Article 4............................................. 195 BACKGROUND DOCUMENT 9: List of television channels in the Member States which failed to achieve the minimum proportion required by Article 5........................................... 213 EN 2 EN BACKGROUND DOCUMENT 1: Performance indicators The following indicators facilitate the evaluation of compliance with the proportions referred to in Article 4 and 5 of the Directive. Indicators 2 – 5 are based on criteria set out in Articles 4 and 5. -

TV-Programme Zur Erfassung GT 1 Per 1.1.2015
TV-Programme zur Erfassung GT 1 per 1.1.2015 Sender- Kurz- Spra- Land Vollständige Bezeichnung ID bezeichnung che Schweiz 11 CH SRF1 SCHWEIZER FERNSEHEN - DRS 1 de 206 CH SRFzwei SRF zwei de 52 CH RTSun TELEVISION SUISSE ROMANDE 1 fr 51 CH RSILA1 RADIOTELEVISIONE SVIZZERA ITALIANA 1 it 207 CH RSILA2 RADIOTELEVISIONE SVIZZERA ITALIANA 2 it 242 CH SRFInfo SRF Info de 836 CH 3+ 3plus de 310 CH Star STAR TV de 208 CH RTSdeux TELEVISION SUISSE ROMANDE 2 fr 1352 CH 4+ 4plus de 1306 CH joiz joiz de 301 CH TZüri TELE ZüRI de 320 CH TTOP TELE TOP - WINTERTHUR de 302 CH TEM1 TELE M1 de 308 CH Tele1 TELE 1 de 307 CH TBärn TELE BAERN de 1134 CH SSF Schweizer Sport Fernsehen de 306 CH TBasl TELE BASEL de 177 CH TVM3 3ème chaîne romande fr 303 CH Cana9 CANAL 9 - SIERRE fr 309 CH,FR CAAL+ CANAL ALPHA + fr 229 CH VIVA VIVA Schweiz de 311 CH LéMan LEMAN BLEU fr 322 CH TOST TELE OSTSCHWEIZ - ST. GALLEN de 1276 CH latélé la télé fr 321 CH TETI TELE TICINO it 317 CH TBiel TELE BIELINGUE - BIEL/BIENNE de 492 CH zürip züriplus de 323 CH TSüdO TELE SÜDOSTSCHWEIZ - CHUR de 1213 CH RouTV Rouge TV de 1432 CH NRJTV Energy TV de 253 CH S5 Schweiz 5 de 319 CH SHf SCHAFFHAUSER LOKAL-TV de 318 CH TRhta TELE RHEINTAL de 1257 CH KAN9 Kanal 9 / Canal 9 de 194 CH maxtv max tv de 1370 CH CHTV CHTV (CH Television GmbH) de 193 CH TNapf Tele Napf de 1254 CH ALPEN Alpen Welle TV de 1433 CH TCFlashD TC Flash D de 1434 CH TCFlashF TC Flash F fr 1072 CH NZeit Die Neue Zeit TV de 196 CH TeleD Tele D de 314 CH Alf AROLFINGER LOKALFERNSEHEN AARAU-ZOFINGEN de 1395 CH TORTele TOR Télévision -

V JUDGMENT of the COURT (Fourth Chamber) 22
KABEL DEUTSCHLAND VERTRIEB UND SERVICE JUDGMENT OF THE COURT (Fourth Chamber) 22 December 2008 * In Case C-336/07, REFERENCE for a preliminary ruling under Article 234 EC from the Verwaltungsgericht Hannover (Germany), made by decision of 14 June 2007, received at the Court on 19 July 2007, in the proceedings Kabel Deutschland Vertrieb und Service GmbH & Co. KG v Niedersächsische Landesmedienanstalt für privaten Rundfunk, intervening parties: Norddeutscher Rundfunk, Zweites Deutsches Fernsehen, * Language of the case: German. I - 10891 JUDGMENT OF 22. 12. 2008 — CASE C-336/07 ARTE GEIE, Bloomberg LP, Mitteldeutscher Rundfunk, MTV Networks Germany GmbH, successor in law to VIVA Plus Fernsehen GmbH, VIVA Music Fernsehen GmbH & Co. KG, MTV Networks Germany GmbH, successor in law to MTV Networks GmbH & Co. oHG, Westdeutscher Rundfunk, RTL Television GmbH, RTL II Fernsehen GmbH & Co. KG, VOX Film und Fernseh-GmbH & Co. KG, RTL Disney Fernsehen GmbH & Co. KG, SAT. 1 Satelliten-Fernsehen GmbH and Others, Regio.TV GmbH, Eurosport SA, TM-TV GmbH & Co. KG, ONYX Television GmbH, Radio Bremen, I - 10892 KABEL DEUTSCHLAND VERTRIEB UND SERVICE Hessischer Rundfunk, Nederland 2, Hamburg 1 Fernsehen Beteiligungs GmbH & Co. KG, Turner Broadcasting System Deutschland GmbH, n-tv Nachrichtenfernsehen GmbH & Co. KG, Bayerischer Rundfunk, Deutsches Sportfernsehen GmbH, NBC Europe GmbH, BBC World, Mediendienst Borkum — Kurverwaltung NSHB Borkum GmbH, Friesischer Rundfunk GmbH, Home Shopping Europe GmbH & Co. KG, Euro News SA, Reise-TV GmbH & Co. KG, SKF Spielekanal Fernsehen GmbH, TV 5 Europe, DMAX TV GmbH & Co. KG, formerly XXP TV — Das Metropolenprogramm GmbH & Co. KG, RTL Shop GmbH, I - 10893 JUDGMENT OF 22. -

TV-Programmliste
TV-Programmliste N° Sender Kanal 1 ARD 5 2 ZDF 6 3 WDR 3 7 4 SAT 1 10 5 RTL 8 6 Pro 7 9 7 RTL 2 S 12 8 VOX 12 9 Kabel 1 S 11 10 Arte S 14 11 3 SAT S 09 12 MDR S 05 13 SWR 3 S 06 14 Bayern 3 S 07 15 Nord 3 S 08 16 HR 3 22 17 RBB 21 18 Eurosport S 15 19 Sport 1 S 16 20 Phoenix S 04 21 N-TV 11 22 N24 29 23 Center TV S 18 24 Super RTL S 13 25 Dmax S 21 26 Tele 5 S 23 27 CNN internat S 24 28 BBC World S 26 29 Netcologne Infokanal S 10 30 VIVA S 17 31 MTV S 19 32 Deluxe Music 32 33 Comedy Central / Nick S 20 34 Kinderkanal / 1-2-3 tv S 22 35 Bloomberg TV S 40 36 Sonnenklar TV S 27 37 Juwelo TV 23 38 HSE / Das Vierte 24 39 9live / TV 5 25 40 QVC 26 41 Astro TV 27 42 Channel21 28 43 RTPi (port.) 30 44 TVE-international (span.) 31 45 HSE24 37 46 ATV Avrupa (türk.) 47 47 TGRT EU (türk.) 48 49 Show Turk (türk.) 49 50 ERT SAT (griech.) 69 Radio Weyand Netcologne Multikabel Tel.: 8901780 Stand: 01.09.2010 TV-Programmliste TV-Programmliste N° Sender Kanal N° Sender Kanal 1 ARD 5 1 ARD 5 2 ZDF 6 2 ZDF 6 3 WDR 3 7 3 WDR 3 7 4 SAT 1 10 4 SAT 1 10 5 RTL 8 5 RTL 8 6 Pro 7 9 6 Pro 7 9 7 RTL 2 S 12 7 RTL 2 S 12 8 VOX 12 8 VOX 12 9 Kabel 1 S 11 9 Kabel 1 S 11 10 Arte S 14 10 Arte S 14 11 3 SAT S 09 11 3 SAT S 09 12 MDR S 05 12 MDR S 05 13 SWR 3 S 06 13 SWR 3 S 06 14 Bayern 3 S 07 14 Bayern 3 S 07 15 Nord 3 S 08 15 Nord 3 S 08 16 HR 3 22 16 HR 3 22 17 RBB 21 17 RBB 21 18 Eurosport S 15 18 Eurosport S 15 19 Sport 1 S 16 19 Sport 1 S 16 20 Phoenix S 04 20 Phoenix S 04 21 N-TV 11 21 N-TV 11 22 N24 29 22 N24 29 23 Center TV S 18 23 Center TV S 18 24 Super RTL S -
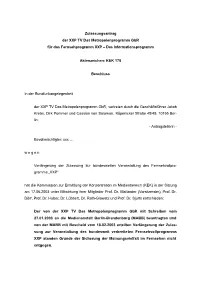
Zulassungsantrag Der XXP TV Das Metropolenprogramm Gbr Für Das Fernsehprogramm XXP – Das Informationsprogramm
Zulassungsantrag der XXP TV Das Metropolenprogramm GbR für das Fernsehprogramm XXP – Das Informationsprogramm Aktenzeichen: KEK 175 Beschluss In der Rundfunkangelegenheit der XXP TV Das Metropolenprogramm GbR, vertreten durch die Geschäftsführer Jakob Krebs, Dirk Pommer und Cassian von Salomon, Köpenicker Straße 48/49, 10155 Ber- lin, - Antragstellerin - Bevollmächtigter: xxx ... w e g e n Verlängerung der Zulassung zur bundesweiten Veranstaltung des Fernsehvollpro- gramms „XXP“ hat die Kommission zur Ermittlung der Konzentration im Medienbereich (KEK) in der Sitzung am 17.06.2003 unter Mitwirkung ihrer Mitglieder Prof. Dr. Mailänder (Vorsitzender), Prof. Dr. Dörr, Prof. Dr. Huber, Dr. Lübbert, Dr. Rath-Glawatz und Prof. Dr. Sjurts entschieden: Der von der XXP TV Das Metropolenprogramm GbR mit Schreiben vom 27.01.2003 an die Medienanstalt Berlin-Brandenburg (MABB) beantragten und von der MABB mit Bescheid vom 18.02.2003 erteilten Verlängerung der Zulas- sung zur Veranstaltung des bundesweit verbreiteten Fernsehvollprogramms XXP standen Gründe der Sicherung der Meinungsvielfalt im Fernsehen nicht entgegen. 2 Begründung I Sachverhalt 1 Zulassungsantrag Die XXP TV Das Metropolenprogramm GbR („XXP TV“) beantragte mit Schreiben an die MABB vom 27.01.2003, ihre probeweise auf zwei Jahre befristete Sendeerlaub- nis zur Veranstaltung von Kabelrundfunk im Berliner Kabelnetz vom 07.02.2001, er- weitert mit Bescheid vom 19.07.2001 um die Erlaubnis zur bundesweiten Verbrei- tung des Programms über Satellit, auf die Dauer von 7 Jahren zu verlängern. Der ursprüngliche Lizenzzeitraum endete zum 30.04.2003. Die MABB hat am 18.02.2003 die Sendeerlaubnis für XXP antragsgemäß auf die Li- zenzdauer von 7 Jahren, beginnend ab dem 01.05.2001, verlängert, ohne zuvor der KEK den Antrag gemäß § 37 RStV vorzulegen.