Titel Der Diplomarbeit
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

Migrantinnen Als Akteure Der Österreichischen Politik
View metadata, citation and similar papers at core.ac.uk brought to you by CORE provided by OTHES MigrantInnen als Akteure der österreichischen Politik Politische Partizipation der neuen Minderheiten: Teilhabemöglichkeiten und -barrieren, erste Erfahrungen ethnischer MandatsträgerInnen (elektronische Version in PDF-Format) Diplomarbeit zur Erlangung des akad. Grades Magistra der Philosophie an der Human- und Sozialwissenschaftlichen Fakultät der Universität Wien eingereicht von Alexandra Grasl Studienrichtung: Politikwissenschaft Betreuer: Univ.Prof.Dr. Karl Ucakar Wien, Mai 2002 1 Inhaltsverzeichnis 1. Einleitung 5 1.1. Zum Begriff „AkteurInnen“ 6 1.2. Zum Begriff „MigrantInnen“ 8 1.3. Zum Begriff „Integration“ 8 2. Methodische Vorgangsweise 10 2.1. Fragestellung 10 2.2. Arbeitsthesen 11 2.3. Methode 12 2.4. Gesprächsleitfaden 13 2.5. Auswahl der InterviewpartnerInnen 13 2.6. Interviewsituation 15 2.7. Zur Rolle der Interviewerin 15 2.8. Auswertung der Interviews 16 2.9. Kategorien 17 3. MigrantInnen in Österreich 18 3.1. Österreichs Migrantenpopulation in Zahlen 18 3.2. Migrationsgeschichte der 2. Republik 19 3.3. Lebensbedingungen von Einwanderern 20 3.3.1. Staatsbürgerschaftsrechtliche Folgen für MigrantInnen 20 3.3.2. Aufenthalts- und Niederlassungsgesetz 21 3.3.3. Ausländerbeschäftigungsgesetz und Arbeitsmarkt 22 3.3.4. Die sozioökonomische Lage von MigrantInnen 23 3.3.5. Bildungs- und Ausbildungssituation 24 3.4. Resümee 26 4. Politische Partizipation von MigrantInnen in Österreich 27 4.1.1. Zum Begriff „Politische Partizipation“ 27 4.1.2. Politische Partizipation von MigrantInnen 28 4.1.3. Konventionelle Formen politischer Partizipation 30 4.1.4. Politische Rechte als Staatsbürgerrecht 30 4.1.5. Die Entwicklung des Staatsbürgerbegriffs 30 4.1.6. -

Diplomarbeit
Diplomarbeit Titel der Diplomarbeit „Frauen im Parlament – Zur Relevanz der Repräsentation von Frauen in der Gesetzgebung“ Verfasserin Verena Holzer angestrebter akademischer Grad Magistra der Philosophie (Mag. phil.) Wien, 2012 Studienkennzahl lt. Studienblatt: A 300 Studienrichtung lt. Studienblatt: Politikwissenschaft Betreuerin/Betreuer: Univ.-Doz. Dr. Johann Wimmer Inhaltsverzeichnis Widmung .......................................................................................................................... 4 1 Einleitung.................................................................................................................. 5 2 Parlamentarismus und Partizipation .................................................................... 10 2.1 Begriffsdefinition..................................................................................................... 10 2.1.1 Parlamentarismus ........................................................................................... 10 2.1.2 Partizipation .................................................................................................... 11 2.2 Entwicklung des österreichischen Parlamentarismus seit 1867.............................. 13 2.3 Funktionen des österreichischen Parlamentarismus............................................... 15 2.3.1 Gesetzesinitiativen .......................................................................................... 16 2.3.2 Organisatorische Elemente ............................................................................ -

Die Grüne Haltung Zur Europäischen Integration“
DIPLOMARBEIT Titel der Diplomarbeit „Vom Widerstand zur Wende: Die Grüne Haltung zur Europäischen Integration“ Verfasser Gerald John angestrebter akademischer Grad Magister der Philosophie (Mag. phil.) Wien, 2012 Studienkennzahl lt. Studienblatt: A 312 Studienrichtung lt. Studienblatt: Geschichte Betreuerin / Betreuer: Univ.-Doz. Dr. Siegfried Mattl Inhaltsverzeichnis Seite 1. Einleitung 6 1.1. Vorwort 6 1.2. Inhalt und Aufbau der Arbeit 8 1.3. Quellenlage 9 1.4. Interviews mit Grün-Politiker(inne)n 11 1.5. Zur Methodik der Leitfadeninterviews 12 1.5.1. Vorteile des qualitativen Ansatzes 12 1.4.2. Zur Form des Leitfadeninterviews 13 2. Die Geschichte der europäischen Integration im Überblick 16 3. Österreich und die europäische Integration 22 4. Vorgeschichte und Wurzeln der Grünen in Österreich 27 4.1. Rahmenbedingungen 27 4.1.1. Der ökologische Boom 27 4.1.2. Wertewandel – eine „stille Revolution“ 28 4.1.3. Neue Soziale Bewegungen 29 4.1.4. Gesellschaft und Politik im Strukturwandel 31 4.1.5. Die These von der zweiten Moderne 32 4.2. Die Vorläufer der Grünen Parteien 34 4.3. Sternstunde I: Zwentendorf und die Anti-AKW-Bewegung 35 4.4. Zersplitterung: Alternative, Autonome und kommunalpolitische Pioniere 38 4.5. VGÖ und ALÖ: Zwei Parteien ringen um die Hegemonie 40 4.6. Sternstunde II: Hainburg 42 4.7. Einigungsprozess und Einzug in den Nationalrat 45 4.8. Die Grüne Alternative: Ein turbulenter Einstieg ins Establishment 47 4.9. Neubeginn und Professionalisierung 50 5. Grüne EU-Skepsis –Traditionen, Bilder, Ideologien 55 5.1. „Small is beautiful“: Die EU als zentralistischer Moloch 55 5.2. Kapitalismuskritik: Die EU als Wachstumsmonster 62 2 5.2.1. -

Legislative Eliten in Österreich Rekrutierungsmuster Und Karriereverläufe
Legislative Eliten in Österreich Rekrutierungsmuster und Karriereverläufe Diplomarbeit zur Erlangung des akademischen Grades Mag. rer. soc. oec. im Diplomstudium Soziologie Eingereicht von: Andreas Payer Angefertigt am: Institut für Soziologie Beurteilerin: Mag.a Dr.in Karin Fischer Juni 2015 Eidesstattliche Erklärung Ich erkläre an Eides statt, dass ich die vorliegende Diplomarbeit selbstständig und ohne fremde Hilfe verfasst, andere als die angegebenen Quellen und Hilfsmittel nicht benutzt beziehungsweise. die wörtlich oder sinngemäß entnommenen Stellen als sol- che kenntlich gemacht habe. Die vorliegende Diplomarbeit ist mit dem elektronisch übermittelten Textdokument identisch. ____________________ __________________________ Ort, Datum Unterschrift 2 Kurzfassung Funktionalistischen Überlegungen folgend wendet sich diese Arbeit einer Personen- gruppe zu, die durch ihre formale Position in der österreichischen Gesetzgebung eine wichtige Rolle spielen. Diese Personengruppe soll als „legislative Eli- te“ bezeichnet werde. Unter Zuhilfenahme vorhandenen biografischen Materials wer- den individuelle Karriereverläufe auf etwaige Rekrutierungsmuster untersucht und somit Strukturen aufgedeckt, die einen Aufstieg in diese Führungsrollen begünstigen. In diese Analyse gelangen dabei Personen des österreichischen Nationalrats, die im Untersuchungszeitraum 1996-2013 eine der folgenden Positionen inne hatten: Natio- nalratspräsident_in, Vorsitzende_r eines Fachausschusses beziehungsweise Parla- mentsklubobmann_frau. Neben einer theoretischen Klärung -

CURRICULUM VITAE Charles INGRAO Professor of History Purdue University
CURRICULUM VITAE Charles INGRAO Professor of History Purdue University (765) 463-9658 (home office) 889-2114 (Purdue office) 496-1755 (fax) [email protected] http://www.cla.purdue.edu/academic/history/facstaff/Ingrao/ September 2012 ACADEMIC APPOINTMENTS Purdue University, Professor 1987- ; Associate, 1982-1987; Assistant 1976-1982 Brown University, Instructor 1974-1976; Teaching Assistant 1972-1974 Visiting Appointments: Near East University and European University of Cyprus, Fulbright Fellow, 2011 Victoria University of Wellington (NZ), Novara Fellow, 2010 University of Chicago, Visiting Professor, 2006 University of Otago (NZ), William Evans Fellow, 2004 University of Washington, Visiting Professor, 1996 Indiana University, Visiting Professor, 1993 Cambridge University, Bye Fellow, 1989 EDUCATION Ph.D. Brown University, R.I., 1974 B.A. Wesleyan University, Conn., 1969 TEACHING EXPERIENCE Lectures: Western Civilization - The Modern World Europe 1650-1850 Europe in the Renaissance Europe in the Reformation Kings & Philosophers: Europe, 1618-1789 Monarchy: Its Rise & Fall Research and Writing in History The Habsburg Legacy: Central Europe, 1500-2000 Seminars: Age of Absolutism, Enlightenment and Reason (graduate) Renaissance and Reformation (graduate) German Militarism Nationalism: Ethnic Coexistence & Conflict (graduate) Enlightened Despotism The Habsburgs and Early Modern Europe (graduate) Modern Central Europe (graduate) The 20th Century: Nationalism, War & Genocide in the Balkans (graduate) Ethnic Coexistence & Conflict in Central and Southeastern Europe (graduate) The Expansion of Europe, 1450-1815 (graduate) The Teaching Company “Great Lectures” series: The Habsburg Legacy 1500-2000. Computers: departmental director of computer lab and instruction, 1983-2001, 2003-4. PUBLICATIONS Books: The Habsburg Monarchy 1618-1815 (Cambridge: Cambridge University Press, 1994; 2nd edition, 2000). The Hessian Mercenary State: Ideas, Institutions, and Reform under Frederick II, 1760- 1785 (Cambridge: Cambridge University Press, 1987). -
Mitglieder BV Seit 1987
Mitglieder des Bundesvorstandes der Grünen seit 1987 13.9.2010 – dato Eva GLAWISCHNIG, Bundesssprecherin Werner KOGLER, Stv. Bundessprecher Stefan WALLNER, Bundesgeschäftsführer Andreas PARRER, Bundesfinanzreferent Peter PILZ Sigrid PILZ Johannes RAUCH Maria VASSILAKOU, Stv. Bundesssprecherin Daniela GRAF für die GBW 18.1. 2009 – 12.9.2010 Eva GLAWISCHNIG, Bundesssprecherin Michaela SBURNY, Bundesgeschäftsführerin (bis Dez. 2009) Stefan WALLNER, Bundesgeschäftsführer (ab Jänner 2010) Andreas PARRER, Bundesfinanzreferent Werner KOGLER, Stv. Bundessprecher Peter PILZ Sigrid PILZ Johannes RAUCH Maria VASSILAKOU, Stv. Bundesssprecherin Daniela GRAF für die GBW 4.5. 2008 – 17.1.2009 Alexander VAN DER BELLEN, Bundessprecher Michaela SBURNY, Bundesgeschäftsführerin Andreas PARRER, Bundesfinanzreferent Eva GLAWISCHNIG, Stv. Bundesssprecherin Werner KOGLER Peter PILZ Maria VASSILAKOU, Stv. Bundesssprecherin Karl ÖLLINGER für den Grünen Parlamentsklub Daniela GRAF für die GBW 4.3. 2006 – 3.5.2008 Alexander VAN DER BELLEN, Bundessprecher Michaela SBURNY, Bundesgeschäftsführerin Friedrich KOFLER, Bundesfinanzreferent Eva GLAWISCHNIG Stv. Bundesssprecherin Georg WILLI Ingrid LECHNER-SONNEK Maria VASSILAKOU Madeleine PETROVIC, kooptiert, Stv. Bundessprecherin Karl ÖLLINGER für den Grünen Parlamentsklub Daniela GRAF für die GBW 24.01.2004 - 4.3. 2006 Alexander VAN DER BELLEN, Bundessprecher Franz FLOSS, Bundesgeschäftsführer bis 25.06.2004 Michaela SBURNY, Bundesgeschäftsführerin ab 25.06.2004 Friedrich KOFLER, Bundesfinanzreferent Eva GLAWISCHNIG Margarethe -

Political Parties of the World in 2004 AUSTRIA
Political Parties of the World in 2004 AUSTRIA Kurt Richard Luther Keele European Parties Research Unit (KEPRU) Working Paper 21 © Kurt Richard Luther, 2004 ISSN 1475-1569 ISBN 1-899488-13-8 KEPRU Working Papers are published by: School of Politics, International Relations and the Environment (SPIRE) Keele University Staffs ST5 5BG, UK Tel +44 (0)1782 58 4177/3088/3452 Fax +44 (0)1782 58 3592 www.keele.ac.uk/depts/spire/ Editor: Professor Thomas Poguntke ([email protected]) KEPRU Working Papers are available via SPIRE’s website. Launched in September 2000, the Keele European Parties Research Unit (KEPRU) was the first research grouping of its kind in the UK. It brings together the hitherto largely independent work of Keele researchers focusing on European political parties, and aims: • to facilitate its members' engagement in high-quality academic research, individually, collectively in the Unit and in collaboration with cognate research groups and individuals in the UK and abroad; • to hold regular conferences, workshops, seminars and guest lectures on topics related to European political parties; • to publish a series of parties-related research papers by scholars from Keele and elsewhere; • to expand postgraduate training in the study of political parties, principally through Keele's MA in Parties and Elections and the multinational PhD summer school, with which its members are closely involved; • to constitute a source of expertise on European parties and party politics for media and other interests. The Unit shares the broader aims of the Keele European Research Centre, of which it is a part. KERC comprises staff and postgraduates at Keele who are actively conducting research into the politics of remaking and integrating Europe. -
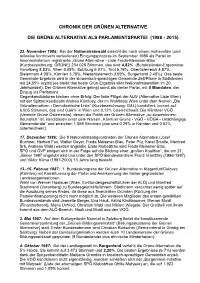
1986 Bis 2015, Stand: Juni
CHRONIK DER GRÜNEN ALTERNATIVE DIE GRÜNE ALTERNATIVE ALS PARLAMENTSPARTEI (1986 - 2015) 23. November 1986: Bei der Nationalratswahl erreicht die nach einem mühevollen (und teilweise kontrovers verlaufenen) Einigungsprozess im September 1986 als Partei im Innenministerium registrierte „Grüne Alternative - Liste Freda-Meissner-Blau“ (Kurzbezeichnung: GRÜNE) 234.028 Stimmen, das sind 4,82% (Bundesländer-Ergebnisse: Vorarlberg 8,83%, Wien 6,09%, Salzburg 5,91%, Tirol 5,76%, Oberösterreich 4,87%, Steiermark 4,08%, Kärnten 3,78%, Niederösterreich 3,59%, Burgenland 2,48%). Das beste Gemeinde-Ergebnis wird in der slowenisch-sprachigen Gemeinde Zell/Pfarre in Südkärnten mit 24,55% erzielt (es bleibt das beste Grün-Ergebnis aller Nationalratswahlen im 20. Jahrhundert). Der Grünen Alternative gelingt somit als vierter Partei, mit 8 Mandaten, der Einzug ins Parlament. Gegenkandidaturen bleiben ohne Erfolg: Der linke Flügel der ALW (Alternative Liste Wien) mit der Spitzenkandidatin Andrea Komlosy, der im Wahlkreis Wien unter dem Namen „Die Grünalternativen - Demokratische Liste“ (Kurzbezeichnung: GAL) kandidiert, kommt auf 6.005 Stimmen, das sind 0,66% in Wien und 0,12% österreichweit. Die Kärntner VGÖ (Vereinte Grüne Österreichs), denen die Politik der Grünen Alternative „zu slowenInnen- freundlich“ ist, kandidieren unter dem Namen „Kärntner Grüne - VGÖ - VÖGA - Unabhängige Gemeinderäte“ und erreichen 1.059 Stimmen (das sind 0,29% in Kärnten und 0,02% österreichweit). 17. Dezember 1986: Die 8 Nationalratsabgeordneten der Grünen Alternative (Josef Buchner, Herbert Fux, Walter Geyer, Freda Meissner-Blau, Peter Pilz, Karel Smolle, Manfred Srb, Andreas Wabl) werden angelobt. Erste Klubobfrau wird Freda Meissner-Blau. SPÖ und ÖVP einigen sich in der Folge auf die Bildung einer „großen Koalition“, die am 21. -

Name Partei Email Geschlecht Landesregierung Niederösterreich Dr. Petra Bohuslav ÖVP [email protected] W Mag. Johann Heur
Name Partei eMail Geschlecht Landesregierung Niederösterreich Dr. Petra Bohuslav ÖVP [email protected] w Mag. Johann Heuras ÖVP [email protected] m Dr. Josef Leitner SPÖ [email protected] m Mag. Johanna Mikl-Leitner ÖVP [email protected] w Dr. Stephan Pernkopf ÖVP [email protected] m Dr. Erwin Pröll ÖVP [email protected] m Barbara Rosenkranz FPÖ [email protected] w Mag. Karin Scheele SPÖ [email protected] w Mag. Wolfgang Sobotka ÖVP [email protected] m Landtag Niederösterreich Erika Adensamer ÖVP [email protected] w Konrad Antoni SPÖ [email protected] m Karl Bader ÖVP [email protected] m Helmut Doppler ÖVP [email protected] m Rupert Dworak SPÖ [email protected] m Josef Edlinger ÖVP [email protected] m Dipl.-Ing. Willibald Eigner ÖVP [email protected] m Amrita Enzinger GRÜNE [email protected] w Anton Erber ÖVP [email protected] m Hermann Findeis SPÖ [email protected] m Franz Gartner SPÖ [email protected] m Franz Grandl ÖVP [email protected] m Ing. Franz Gratzer SPÖ [email protected] m Mag. Kurt Hackl ÖVP [email protected] m Ing. Hermann Haller ÖVP [email protected] m Hermann Hauer ÖVP [email protected] m Michaela Hinterholzer ÖVP [email protected] w Hans Stefan Hintner ÖVP [email protected] m Ing. Johann Hofbauer ÖVP [email protected] m Ing. -

Forschungsbericht No. 11 ORF Sommergespräche
Institut für vergleichende Medien- und Kommunikationsforschung Institute for Comparative Media and Communication Studies (CMC) Österreichische Akademie der Wissenschaften | Alpen-Adria-Universität Klagenfurt Forschungsbericht No. 11 ORF Sommergespräche: Strategien, Images und Themen im politischen Fernsehinterview – Kategorienschema und Codieranweisung zur standardisierten, quantitativen Inhaltsanalyse finanziert von der Kulturabteilung der Stadt Wien Postgasse 7/4/1 1010 Wien, Österreich Tel. +43 1 51581-3110 Fax +43 1 51581-3120 [email protected] www.oeaw.ac.at/cmc Bankverbindung: © Institut für vergleichende Medien- und Kommunikationsforschung UniCredit Bank Austria AG BLZ 11000 IBAN: AT541100000262650519 BIC Code: BKAUATWW Wien 2018 Empfohlene Zitierung: Institut für vergleichende Medien- und Kommunikationsforschung (2018). ORF Sommergespräche: Strategien, Images und Themen im politischen Fernsehinterview – Kategorienschema und Codieranweisung zur standardisierten, quantitativen Inhaltsanalyse. CMC-Forschungsberichte, No. 11. Wien: Institut für vergleichende Medien- und Kommunikationsforschung. ORF Sommergespräche: Strategien, Images und Themen im politischen Fernsehinterview – Kategorienschema und Codieranweisung zur standardisierten, quantitativen Inhaltsanalyse 1. Formale Festlegungen 1.1. Untersuchungsgegenstand Es werden die im ORF in den Jahren 1982 bis 2012 ausgestrahlten politischen Interviewsendungen („Politik am Freitag“, „Inlandsreport“, „Anders gefragt“, „Zur Sache“ „Sommergespräche“) codiert.1 1.2. Analyseeinheit Analyseeinheit -

The Emergence and Electoral Success of Green Parties in Austria, Britain and the Netherlands
Rethinking Green Parties: The Emergence and Electoral Success of Green Parties in Austria, Britain and the Netherlands A Dissertation Submitted for the Degree of Doctor of Philosophy University of Sheffield Mark Williams Faculty of Social Sciences Department of Politics August 1999 Abstract The proliferation of green parties on the European political landscape in recent decades has prompted much debate concerning the explanation of their emergence and the factors considered to influence their varying levels of electoral success. This thesis critically examines a number of perspectives and concepts drawn from the sociological and political studies literatures which shed light on these two key issues. Through a comparison of green party politics in Austria, Britain and the Netherlands, the thesis challenges the assessment of those who maintain that the emergence and/or electoral success of green parties can be understood principally in terms of the theory of 'post-materialist' value change, or in terms of the shift to 'post-industrial' society. Drawing on contemporary studies of 'high-consequence' risks, it argues for an alternative approach to understanding the emergence of green parties which is rooted in processes of social and global environmental change that have taken place during the post-war period. The question of green party electoral success is examined by means of the organisation of a variety of political and institutional factors into four overarching themes: political state-institutional structures, electoral dealignment and political competition, modes of interest representation, and internal dynamics. It is contended that attention to each of these can yield important insights into the conditions which have impacted on the electoral significance of green parties in Austria, Britain and the Netherlands. -

Geschichte Gruenechronik
CHRONIK DER GRÜNEN ALTERNATIVE DIE GRÜNE ALTERNATIVE ALS PARLAMENTSPARTEI (1986 - 2015) 23. November 1986: Bei der Nationalratswahl erreicht die nach einem mühevollen (und teilweise kontrovers verlaufenen) Einigungsprozess im September 1986 als Partei im Innenministerium registrierte „Grüne Alternative - Liste Freda-Meissner-Blau“ (Kurzbezeichnung: GRÜNE) 234.028 Stimmen, das sind 4,82% (Bundesländer-Ergebnisse: Vorarlberg 8,83%, Wien 6,09%, Salzburg 5,91%, Tirol 5,76%, Oberösterreich 4,87%, Steiermark 4,08%, Kärnten 3,78%, Niederösterreich 3,59%, Burgenland 2,48%). Das beste Gemeinde-Ergebnis wird in der slowenisch-sprachigen Gemeinde Zell/Pfarre in Südkärnten mit 24,55% erzielt (es bleibt das beste Grün-Ergebnis aller Nationalratswahlen im 20. Jahrhundert). Der Grünen Alternative gelingt somit als vierter Partei, mit 8 Mandaten, der Einzug ins Parlament. Gegenkandidaturen bleiben ohne Erfolg: Der linke Flügel der ALW (Alternative Liste Wien) mit der Spitzenkandidatin Andrea Komlosy, der im Wahlkreis Wien unter dem Namen „Die Grünalternativen - Demokratische Liste“ (Kurzbezeichnung: GAL) kandidiert, kommt auf 6.005 Stimmen, das sind 0,66% in Wien und 0,12% österreichweit. Die Kärntner VGÖ (Vereinte Grüne Österreichs), denen die Politik der Grünen Alternative „zu slowenInnen- freundlich“ ist, kandidieren unter dem Namen „Kärntner Grüne - VGÖ - VÖGA - Unabhängige Gemeinderäte“ und erreichen 1.059 Stimmen (das sind 0,29% in Kärnten und 0,02% österreichweit). 17. Dezember 1986: Die 8 Nationalratsabgeordneten der Grünen Alternative (Josef Buchner, Herbert Fux, Walter Geyer, Freda Meissner-Blau, Peter Pilz, Karel Smolle, Manfred Srb, Andreas Wabl) werden angelobt. Erste Klubobfrau wird Freda Meissner-Blau. SPÖ und ÖVP einigen sich in der Folge auf die Bildung einer „großen Koalition“, die am 21.