Osteel , Gemeinde Brookmerland, Landkreis Aurich
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

4.4-2 Lower Saxony WS Region.Pdf
chapter4.4_Neu.qxd 08.10.2001 16:11 Uhr Seite 195 Chapter 4.4 The Lower Saxony Wadden Sea Region 195 near Sengwarden have remained fully intact. The With the exception of the northern section’s water tower on „Landeswarfen“ west of tourist visitors, the Voslapper Groden mainly Hohenkirchen is a landmark visible from a great serves as a sea rampart for Wilhelmshaven’s distance, constructed by Fritz Höger in 1936 to commercial buildings, a function also served by serve as Wangerooge’s water supply. the Rüstersieler Groden (1960-63) and the Hep- Of the above-mentioned scattered settlements penser Groden, first laid out as a dyke line from characteristic to this region, two set themselves 1936-38, although construction only started in physically apart and therefore represent limited 1955. It remains to be seen whether the histori- forms within this landscape. cally preserved parishes of Sengwarden and Fed- Some sections of the old dyke ring whose land derwarden, now already part of Wilhelmshaven, was considered dispensable from a farming or will come to terms with the consequences of this land ownership perspective served as building and the inexorable urban growth through appro- space for erecting small homes of farm labourers priate planning. and artisans who otherwise made their homes in The cultural landscape of the Wangerland and small numbers on larger mounds. Among these the Jeverland has been able to preserve its were the „small houses“ referred to in oral tradi- unmistakable character to a considerable degree. tion north of Middoge, the Oesterdeich (an early The genesis of landscape forms is mirrored in the groden dyke), the Medernser Altendeich, the patterns of settlement, the lay of arable land and Norderaltendeich and foremost the area west of in landmark monuments. -

Population by Area/Community Churches
Ostfriesen Genealogical Society of America OGSA PO Box 50919 Mendota, MN 55150 651-269-3580 www.ogsa.us 1875 Ostfriesland Census Detail The 1875 census provided insights into the communities and neighborhoods across Ostfriesland. The following table is sorted by Amt (Church district) and Kirchspiel (Church community) or location if the enumerated area does not have its own Church. Region Religion Town/Area Denomination Amt Kirchspiel / Location Lutheran Reformed Catholic Other Jewish Total Christian Aurich Lutheran, Aurich Aurich 3,569 498 282 106 364 4,819 Reformed, Catholic Plaggenburg Lutheran Aurich Aurich 529 40 4 573 Dietrichsfeld Aurich Aurich 201 6 207 Egels Aurich Aurich 235 1 7 243 Ertum Aurich Aurich 337 8 345 Georgßfeld Aurich Aurich 88 4 2 94 Hartum Aurich Aurich 248 18 9 275 Ihlow Aurich Weene 6 6 Kirchdorf Aurich Aurich 527 15 1 3 546 Meerhusen Aurich Aurich 9 9 Pfalsdorf Aurich Aurich 119 41 160 Popens Aurich Aurich 127 4 131 Rahe Aurich Aurich 268 25 3 296 Sandhorst Aurich Aurich 643 48 8 7 706 Tannenhausen Aurich Aurich 337 16 353 © 2018: Ostfriesen Genealogical Society of America 1 1875 Ostfriesland Census Detail Region Religion Town/Area Denomination Amt Kirchspiel / Location Lutheran Reformed Catholic Other Jewish Total Christian Walle Aurich Aurich 779 33 812 Wallinghausen Aurich Aurich 408 17 425 Ostgroßefehn Lutheran Aurich Aurich, Oldendorf 1,968 33 1 28 7 2,037 Aurich-Oldendorf Lutheran Aurich Aurich-Oldendorf 754 4 1 4 1 764 Spetzerfehn Lutheran Aurich Aurich-Oldendorf, 988 1 989 Bagband, Strackholt Bagband -

Familie Setzt Sich Für Kulturgut
seite 10 /freitag,1.februar2013 dornum -brookmerland -hage-großheide Ostfriesischer Kurier .. Familie setzt sichfür Kulturgutein heute hAGE – DasHallenbad im Kurzentrum Hage ist von projekt Namhaftestiftungen unterstützen erhalt desgulhofs heykenainNeßmersiel 6.30 bis 8Uhr und von16 bis 19 Uhrgeöffnet, Tele- Kosten für restaurierung schweren Lastwagen haben fon: 04936/918440. vongiebelund wir daraufhin die Funda- hAGE – DieMüllum- mente vorn am Giebel er- schlagstation an der Ha- schornsteinbelaufen neuert“, so Heykena. germarscher Landstraße sichauf 15000 euro. Nach 170 Jahren ist im hat von9bis 12 Uhrund 13 Jahr 2012 nun auch der alte bis 16 Uhrgeöffnet. NELMERSIEL/KUE –Immer Giebelstein erneuertworden MARIENhAFE – DerWelt- wiederbleibenTouristen,aber (wir berichteten). Im Stein laden in Marienhafe,AM auch Einheimische stehen, eingemeißelt ist „Reina Chr. Markt21, hat heute von10 um den imposanten Gulfhof Heykena geb: Euken 1842“ bis 12.30 Uhrund von15 in der Mitte des kleinen Ortes als Erinnerung an die Initia- bis 17.30 Uhrgeöffnet.Wei- Neßmersiel zu fotografieren. torin des Wiederaufbaus zu tereInformationen gibt es DerHof wurde im Jahr 1776 lesen. „Bemerkenswert, dass unter der Telefonnummer errichtet, fiel jedoch im Jahr in dieser Männergesellschaft 04934/5902. 1841 einem Brand zum Opfer. ein weiblicher Name an den hAGE – DasTierheim Hage Im Jahr 1842 wurde der Hof Giebel eines Hofes gestellt an der Hagermarscher vonReina-Christina Heykena wurde“, staunt Wolfgang Landstraße hat von14.30 wieder aufgebaut. Dabei Heykena. bis 17 Uhrgeöffnet. Auch wurde auch ein großer Gie- Beider Restaurierung die Bücherstube ist von belsteinangebracht. Diese dieses Giebelsteins ist die 15 bis 17 Uhrfür jeder- Sandsteinbekrönung gehört Familie durch die Stiftung mann zugänglich. Telefon: heute zu anderen dezenten Kulturschatz Bauernhof, 04938/425. -

TJADEN NUMBER 9-A. Family-Tree Osteel/ Cornelius. Sequence Pages
TJADEN NUMBER 9-a. Family-tree Osteel/ Cornelius. Sequence pages: - 1. - 6. - Appendix. * born , ~ christened , % married , + died , # buried , & divorced , [ .. ] OSB. Evert Tjaden. 1. Cornelius ( “Kneljes/ Caneljes ”) Tjaden / Thiaden. [ Hage 1187 , Marienhafe 6477 , Dornum 3883 , Dornum 134-witness.] ( Probable a son of Tjade Ludwigs and Folke Corneljes , see Tjaden. 9. page T. 1. ) “Arbeiter Osteel und Dornum”. * 19-10- 1777 Osteel. ~ Osteel 20-10. + Osteel 5-6-1834 ( 56 years ) # Osteel 10-6. % Osteel 12-4-1803 with Wendel Catharina Janssen ~Dornum 21-11-1780. + Osteel 4-3-1847 Children: 1. Jan Kneljes Thiaden. *1800. + Osteel 5-2-1829. # Osteel 10-2. 2. Tjade Cornelius Tjaden * 5-1-1805 ~ Dornum 6-1. + Osteel 23-12-1835 ( 30 years ) 3. Foolke Cornelius Tjaden * 19. ~ Dornum 21-12-1806. + Schwee 27-11-1863. # Osteel 6-12-1863. % Osteel 10-4-1847 with Gerd Wilts Bogena. *Osteel 25-3-1813. + Leezdorf 7-3-1870. 3. 4. Johannes Cornelius Tjaden * 23. ~ Dornum 26-8-1809. 5. Baucke Caneljes Tjaden. * Osteel 29-1-1812. ~ Osteel 2-2. + Osteel 27-5-1815. # Osteel 30-5. 6. Peter Cornelius ( “Kneljes”) Tjaden. [ Dornum 3891 , Hage 6727 ] * Osteel 30-1-1814. % Hage 16-8-1840 with Trientje / Trientie Janssen Gerdes. * Westermoordorf 1817. Children: a. Gesche Peters. * Hage 27-11-1840. b. Cornelius Peters Tiaden [ Dornum 3884 ] “ Schmied zu Westermarsch”. * Westermarsch 26-9-1842. % Norden 1867 ( procl. Dornum) with Catharina Margaretha Wilms * Dornumergrode 20-11-1843. ~ Dornum 10-12-1843. 2. c. Jan / Jann Peters Tjaden [ Hage 6718 ] “Arbeiter und Landstrassenverwalter zu Westermarsch ”. * Lintelermarsch 5-9-1845. % ( Procl.) Hage 6-5-1866 with Magdalena Magaretha Fischer. -
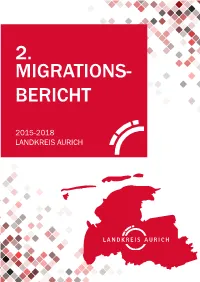
Migrations- Bericht 2
2. MIGRATIONS- BERICHT 2015-2018 LANDKREIS AURICH 2. MIGRATIONSBERICHT | 2015-2018 | LANDKREIS AURICH INHALTSVERZEICHNIS Vorwort Landrat ...................................................................................................................... 4 BEVÖLKERUNG ..................................................................................................... 5-26 Einwohnerzahl und anteilige Ausländer/innenzahl in den Gemeinden ......................................................................................... 5 Entwicklung der Gesamtzahl der im Landkreis Aurich aufhältigen Ausländer/innen 2015 bis 2017....................................... 9 Aufhältige Ausländer/innen nach Staatsangehörigkeit, Alter und Geschlecht im Landkreis Aurich .................................................... 10 Ausländer/innen nach Aufenthaltsstatus, Entwicklung von 2015 bis 2017 .................................................................... 12 Leistungsberechtige Ausländer/innen nach Asylbewerberleistungsgesetz von 2015 bis 2017 ......................................... 16 Ausländische und deutsche Staatsangehörige in den Ortsteilen der Stadt Aurich ............................................................... 18 Ausländische und deutsche Staatsangehörige in den Ortsteilen der Stadt Norden ............................................................. 22 Unbegleitete Minderjährige Ausländer/innen im Landkreis Aurich ..................................................................................... 26 BILDUNG UND QUALIFIZIERUNG................................................... -

Die Grünen Ortsverband Brookmerland, Hinte Und Südbrookmerland (Information Zum Ergebnis Der Aufstellungsversammlungen)
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN OV Brookmerland, Hinte und Südbrookmerland Bündnis 90/ Die Grünen 1. Vors. Jens Albowitz, Grüner Weg 20, 26529 Marienhafe Ortsverband Brookmerland, Hinte An die Presse und Südbrookmerland Ostfriesen Zeitung Ostfriesische Nachrichten 1. Vorsitzender Ostfriesischer Kurier Jens Albowitz Emder Zeitung Grüner Weg 20 Heimat-/ Sonntagsblatt 26529 Marienhafe und online Homepage [email protected] ggs. Social Media Tel. 01577-193 295 3 Marienhafe, 18.06.2021 Pressemitteilung der Partei Bündnis 90/ Die Grünen Ortsverband Brookmerland, Hinte und Südbrookmerland (Information zum Ergebnis der Aufstellungsversammlungen) GRÜNE bestimmen Wahlvorschläge für Hinte und das Brookmerland Politik: Gute Mischung aus bewährten und neuen Kräften will in die Räte Die Mitglieder des Ortsverbandes Brookmerland, Hinte und Südbrookmer- land von Bündnis 90/ Die Grünen haben auf Aufstellungsversammlungen im Hotel Zur Waage in Marienhafe ihre Wahlvorschläge für die Ratswahlen in Hinte und im Brookmerland festgelegt. Für die Wahlen in Südbrookmerland finden die Versammlungen am Wochenende statt. [19.6.]. Der GRÜNEN-Ortsverband freut sich, dass in drei von fünf Räten Frauen bereit sind, die Listen anzuführen. Damit kann der Ortsverband dem Frau- enstatut der Partei gerecht werden. In den Vorjahren war oft keine Frau be- reit, auf Platz 1 zu kandidieren. Für den Gemeinderat Hinte kandidieren bei der Kommunalwahl am 12. Sep- tember auf Platz 1 Agnes Arends und auf Platz 2 Jelto Arends aus Oster- husen. Das langjährige Ratsmitglied der GRÜNEN Gerhard Weidemann tritt nicht mehr an. Agnes Arends hat die Ratsarbeit der GRÜNEN in Hinte in den letzten Jahren als Geschäftsführerin der Ratsfraktion intensiv begleitet, Jelto Arends ist auch aktuell für die GRÜNEN Mitglied im Gemeinderat Hinte. -

Schulprogramm (PDF)
David-Fabricius-Grundschule Osteel – Schulprogramm: Eine Schule im Dorf David-Fabricius-Grundschule Osteel Schulprogramm: Eine Schule im Dorf Inhaltsverzeichnis Leitbild und Leitsätze ...........................................................................................................3 1. Chronik und Daten der David-Fabricius-Grundschule ...................................................4 2. Das Dorf…………………………………………………………………………………………...10 3. Unterrichtliche Schwerpunkte ..................................................................................... ..11 4. Inklusion…………………………………………………………………………………………..12 5. Die Schulbücherei .......................................................................................................... 13 6. Formen der Zusammenarbeit mit der Dorfgemeinschaft ............................................. 13 7. Die Zusammenarbeit mit der Warnfried-Kirchengemeinde Osteel .............................. 14 8. Elternarbeit ..................................................................................................................... 15 9. Schulveranstaltungen .................................................................................................... 16 10. Schulvorstand .............................................................................................................. 17 11. Schulordnung…………………………………………………………………………………..18 12. Kooperationsverträge .................................................................................................. 19 13. Ganztagsgrundschule ................................................................................................. -

Striek's Historische Schmiede in Groβefehn
OSTFRIESEN GENEALOGICAL SOCIETY OF AMERICA AMERICAN-OSTFRIESEN ZEITUNG Eala Freya Fresena! Lever Dod Als Slav! July, AUG., SEPT. 2015 Vol. 18 Issue 3 Striek’s Historische Schmiede in Groβefehn OSTFRIESEN-AMERICAN ZEITUNG OGSA MEMBERSHIP Ostfriesen Genealogical Society of America MEMBER PRIVILEGES include four issues of the American- Eala Freya Fresena! Lever Dod Als Slav! Ostfriesen Zeitung (January, April, July, October), four program Volume 18 Issue 3 / 2015 meetings each year and one special event, special member order discounts, and access to the OGSA library. The newsletter of the Ostfriesen Genealogical Society of America is OGSA 2015 MEMBERSHIP—Send your check for $18 published four times a year. Please write: Lin Strong, Editor, OGSA Newsletter, 168 North Lake Street, Forest Lake, MN 55025 or email - (download from our website or sent by pdf file) or $28 for paper [email protected] with comments or suggestions. copies payable to OGSA, 1670 South Robert Street, #333, West St. Paul, MN 55118 We are happy to consider any contributions of genealogical informa- tion. Whether we can use your material is based on such factors as Foreign membership is $18 if downloaded or sent by pdf file— general interest to our members, our need to cover certain subjects, $30 for paper copies. You can deposit your membership at Spar- balance through the year and available space. The editor reserves the kasse Emden if you prefer. right to edit all submitted materials for presentation and grammar. The editor will correct errors and may need to determine length of copy. The membership year is from November 1 through Octo- ber 31. -

Community Lineage Books
Ostfriesen Genealogical Society of America OGSA PO Box 50919 Mendota, MN 55150 651-269-3580 www.ogsa.us Ostfriesen Church Records and Translated Prefaces Church records are a key source of genealogical information for our Ostfriesen ancestors. Churches recorded the births, marriages and deaths in their communities for generations, even if the person was not a member of the Church’s denomination. Information that was recorded varied prior to the implementation of standards in the early 1800s. You see baptism dates rather than birth dates, burial dates instead of death dates, and the parents of couples being married may not have been recorded. Many volunteers have compiled family books from church records for the Upstalsboom-Gesellschaft, the Ostfriesland genealogical society in Aurich, Germany. These books follow the standards of the Upstalsboom- Gesellschaft and are called an Ortssippenbuch or an OSB. Some researchers will independently compile a family book from a community’s church records and publish them privately. These books are called an Ortsfamienbuch or an OFB. Both OSBs and OFBs require extensive efforts to complete and the books are often in process for years. OSBs and OFBs were traditionally printed once and were difficult to obtain after they sold out, however some are now reprinted after an adequate number of orders have been received. The OGSA attempts to maintain copies of each book in its research collection located in the Minnesota Genealogical Society library and the collection is available at our conferences that are held every two years. Information about future conferences is provided in the Events section of our website at OGSA.us. -

Reife Leistungen Im Brookmerland Besonders Bedacht
Reife Leistungen im Brookmerland besonders bedacht NAMEN Brookmerlander SPORTLEREHRUNG Samtgemeinde zeichnet Erfolge aus den Jahren 2016, 2017 und 2018 aus Sportlerehrung für die Jahre 2016, 17 und 18 UPGANT-SCHOTT/BUP – Aufge- Einzelsportler Jugend: KBV schoben ist nicht aufgehoben: Rechtsupweg: Neele Held: 2017: wJD: Vize-Kreismeisterin im Holzboßeln, Vi- Am Sonnabendvormittag um ze-Landesmeisterin mit der Hollandku- 11 Uhr ging in einem gemüt- gel; 2018: 1. Hollandkugel und 2. Kloot- schießen beim Kreisjugendtag, 2. beim lichen Rahmen im Vereins- Kreispokalfinale mit der Mannschaft heim des KBV Upgant-Schott weibliche Jugend C auf Norderney. die Sportlerehrung der Samt- Fortuna 70 Wirdum: Amke Dirks: 2018: gemeinde Brookmerland 2. Hallenlandesmeisterschaften im Ku- gelstoßen, 2. Landesmeisterschaften im für die Jahre 2016, 2017 und Hammerwurf, Berufung in den nieder- 2018 über die Bühne. Aktive sächsischen Landeskader; Immo Peters: 2018: in vier Disziplinen in der nieder- und Ehrenamtliche aus den sächsischen Landesbestenliste, 5. und 6. sechs Vereinen Fortuna 70 bei den Norddeutschen Meisterschaften Wirdum, KBV Rechtsupweg, in Hamburg in den Disziplinen Drei- und Hochsprung; Thilo Schüler: 2017: KBV Upgant-Schott, SuS sechsfacher Ostfriesischer Meister, 2018: Rechtsupweg, TV Marienhafe Berufung in den niedersächsischen Lan- Erfolgreiche Mannschaften. Ausgezeichnet wurden die Jungen des Niedersachsenligisten SuS Rechtsweg, die Frauen II des KBV deskader, 1. in der niedersächsischen Be- und TuRa Marienhafe kamen stenliste in den Disziplinen, Hochsprung, in den Genuss einer Auszeich- Upgant-Schott und die Männer III des KBV Rechtsupweg. FOTOS: BRUNS Weitsprung und Mehrkampf. nung. In ihrem Grußwort hob SuS Rechtsupweg: Sören Dreier: 2018: Marienhafes Bürgermeisterin der Brookmerlander Sport-Ar- sind seit 1977 bis hin seit 1983 herausragenden Leistungen Schottjer Carina Harms und unter anderem 1. -

Official Journal C 30 Volume 33 of the European Communities 8 Febraary 1990
yr-^^ /*/*• • "I "Y* 1 ISSN 0378-6986 Official Journal c 30 Volume 33 of the European Communities 8 Febraary 1990 English edition Information and Notices Notice No Contents Page I Information II Preparatory Acts Commission 90/C 30/01 Proposal for Council Directive amending Directive 86/465/EEC concerning the Community list of less-favoured farming areas within the meaning of Directive 75/ 268/EEC (Federal Republic of Germany) 1 90/C 30/02 Proposal for a Council Directive concerning the Community list of less-favoured farming areas within the meaning of Directive 75/268/EEC (France) 35 90/C 30/03 Proposal for Council Directive amending Directive 81/645/EEC concerning the Community list of less-favoured farming areas within the meaning of Directive 75/ 268/EEC (Greece) 50 90/C 30/04 Amended proposal for a Council Directive on the annual accounts and consolidated accounts of insurance undertakings 51 90/C 30/05 Re-examined proposal for a Council Directive amending Directive 76/769/EEC on the approximation of the laws, regulations and administrative provisions of the Member States relating to restrictions on the marketing and use of certain dangerous substances and preparations 89 90/C 30/06 Re-examined proposal for a Council Directive on company law concerning single- member private limited companies 91 90/C 30/07 Re-examined proposal for a Council Directive amending Directive 87/102/EEC of 22 December 1986 on the approximation of the laws, regulations and administrative provisions of the Member States concerning consumer credit 92 90/C 30/08 Re-examined proposal for a: — Council Directive amending Directive 86/298/EEC on rear-mounted roll-over protection structures narrow-track tractors — Council Directive amending Directive 87/402/EEC on roll-over protection structures mounted at the front of narrow-track tractors — Council Directive amending Directive 77/536/EEC on roll-over protection structures for tractors (standard) 95 Price: 12 ECU 8. -

Neuer Organist in Marienhafe
Seite 10 – Sonnabend, den 2. September 2017 BROOKMERLAND Ostfriesische Nachrichten VON THOMAS DIRKS TERMINE Osteel. Sein Auto fährt noch mit Nienburger Kenn- Das Störtebeker-Bad in zeichen. Ansonsten ist aber Marienhafe hat heute in der schon vieles erledigt: Am Aus der Zeit von 14 bis 18 Uhr geöff- Donnerstag hat Carsten net. Zwischen 14 und 16 Uhr Greite seine bisherige ist Spielbaden für Kinder. Dienstwohnung in der We- Morgen öffnet das Bad von 8 ser-Stadt übergeben. Tags Kaserne auf bis 12 Uhr. Am Montag ist zuvor traf Osteels neuer Pas- von 15 bis 16 Uhr Schwim- tor beim Pfarrkonvent auf men für Babys und Kleinkin- Baltrum seine neuen Kolle- der. Und von 16 bis 17.30 gen aus dem Kirchenkreis die Kanzel Uhr ist das Becken reserviert Norden. Im Pfarrhaus an der für Behinderte. Von 18 bis 19 Fabriciusstraße sind die Uhr nutzt die Schwimmab- meisten Umzugskartons aus- Bisheriger Militärpfarrer Carsten Greite teilung von TuRa Marienhafe gepackt, haben die Möbel ih- das Bad und von 19 bis 21 re neuen Plätze gefunden. wird ab Sonntag neuer Pastor in Osteel sein Uhr die DLRG-Gruppe. Noch nicht alles sei schön, Die Arbeiterwohlfahrt aber arbeitsfähig das Meiste, (Awo) Brookmerland lädt sagt Greite. Es kann also los- heute zu einer Fahrradtour gehen. Am morgigen Sonn- durch das Brookmerland ein. tag (18 Uhr) wird der 51-jäh- Abfahrt ist um 14 Uhr beim rige Theologe vom Superin- Awo-Treff am Hingstlands- tendenten des Kirchenkrei- weg in Marienhafe. Im An- ses Norden, Dr. Helmut schluss solle dort Tee getrun- Kirschstein, in der Osteeler ken und gegrillt werden, teil- Warnfriedkirche in sein neu- te Awo-Vorsitzender Otto es Amt als Seelsorger der Kir- Thiele mit.