Moringen Und Uckermark In
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

Guides to German Records Microfilmed at Alexandria, Va
GUIDES TO GERMAN RECORDS MICROFILMED AT ALEXANDRIA, VA. No. 32. Records of the Reich Leader of the SS and Chief of the German Police (Part I) The National Archives National Archives and Records Service General Services Administration Washington: 1961 This finding aid has been prepared by the National Archives as part of its program of facilitating the use of records in its custody. The microfilm described in this guide may be consulted at the National Archives, where it is identified as RG 242, Microfilm Publication T175. To order microfilm, write to the Publications Sales Branch (NEPS), National Archives and Records Service (GSA), Washington, DC 20408. Some of the papers reproduced on the microfilm referred to in this and other guides of the same series may have been of private origin. The fact of their seizure is not believed to divest their original owners of any literary property rights in them. Anyone, therefore, who publishes them in whole or in part without permission of their authors may be held liable for infringement of such literary property rights. Library of Congress Catalog Card No. 58-9982 AMERICA! HISTORICAL ASSOCIATION COMMITTEE fOR THE STUDY OP WAR DOCUMENTS GUIDES TO GERMAN RECOBDS MICROFILMED AT ALEXAM)RIA, VA. No* 32» Records of the Reich Leader of the SS aad Chief of the German Police (HeiehsMhrer SS und Chef der Deutschen Polizei) 1) THE AMERICAN HISTORICAL ASSOCIATION (AHA) COMMITTEE FOR THE STUDY OF WAE DOCUMENTS GUIDES TO GERMAN RECORDS MICROFILMED AT ALEXANDRIA, VA* This is part of a series of Guides prepared -

Frauen Im Parlament: Lebensläufe Sozialdemokratischer
www.ssoar.info Frauen im Parlament: Lebensläufe sozialdemokratischer Parlementarierinnen in der Weimarer Republik Wickert, Christl Veröffentlichungsversion / Published Version Sammelwerksbeitrag / collection article Empfohlene Zitierung / Suggested Citation: Wickert, C. (1985). Frauen im Parlament: Lebensläufe sozialdemokratischer Parlementarierinnen in der Weimarer Republik. In W. H. Schröder (Hrsg.), Lebenslauf und Gesellschaft : zum Einsatz von kollektiven Biographien in der historischen Sozialforschung (S. 210-239). Stuttgart: Klett-Cotta. https://nbn-resolving.org/urn:nbn:de:0168- ssoar-338277 Nutzungsbedingungen: Terms of use: Dieser Text wird unter einer Deposit-Lizenz (Keine This document is made available under Deposit Licence (No Weiterverbreitung - keine Bearbeitung) zur Verfügung gestellt. Redistribution - no modifications). We grant a non-exclusive, non- Gewährt wird ein nicht exklusives, nicht übertragbares, transferable, individual and limited right to using this document. persönliches und beschränktes Recht auf Nutzung dieses This document is solely intended for your personal, non- Dokuments. Dieses Dokument ist ausschließlich für commercial use. All of the copies of this documents must retain den persönlichen, nicht-kommerziellen Gebrauch bestimmt. all copyright information and other information regarding legal Auf sämtlichen Kopien dieses Dokuments müssen alle protection. You are not allowed to alter this document in any Urheberrechtshinweise und sonstigen Hinweise auf gesetzlichen way, to copy it for public or commercial purposes, to exhibit the Schutz beibehalten werden. Sie dürfen dieses Dokument document in public, to perform, distribute or otherwise use the nicht in irgendeiner Weise abändern, noch dürfen Sie document in public. dieses Dokument für öffentliche oder kommerzielle Zwecke By using this particular document, you accept the above-stated vervielfältigen, öffentlich ausstellen, aufführen, vertreiben oder conditions of use. -

Findbuch Als
STAATSARCHIV BREMEN Bestand 7,97 Kaisen, Helene und Wilhelm Findbuch bearbeitet von Eva Determann und Hartmut Müller Bremen 2001/2015 - II - Hinweise für die Benutzung: Zum Bestellen und Zitieren von Akten sind die Signaturen zu verwenden, die sich aus der Teilbestandsnummer und – durch einen Bindestrich angehängt – der laufenden Nummer der Akte zusammensetzen. Beispiel: 7,97/5 – 111 Die Benutzung richtet sich nach den Bestimmungen des Bremischen Archivgesetzes. Inhaltsverzeichnis Vorwort II 1. Wilhelm Kaisen 1 1.1. Persönliche Unterlagen 1 1.1.1. Personenstand und Biographisches 1 1.1.2. Rechnungsunterlagen 3 1.2. Unterlagen aus Politik und gesellschaftlicher Tätigkeit 4 1.2.1. Senat, Bürgerschaft, Land Bremen, Tätigkeit als Präsident des Senats 4 1.2.2. Sozialdemokratische Partei Deutschlands 11 1.2.3. Veröffentlichungen, Reden, Presse- und Rundfunkbeiträge 13 1.2.4. Reisen 14 1.2.5. Auszeichnungen, Ehrungen 15 1.3. Korrespondenz 16 1.3.1. Briefe von Wilhelm Kaisen an Helene Kaisen 16 1.3.2. Briefe von Helene Kaisen an Wilhelm Kaisen 17 1.3.3. Briefe an/von Familie 17 1.3.4. Briefe an Wilhelm und Helene Kaisen, privat 18 1.3.5. Briefwechsel mit Wilhelm Kaisen (Korrespondenzmappen) 19 1.3.6. Glückwünsche 23 1.4. Unterlagen zur Person 24 1.5. Verschiedenes 25 1.6. Fotos und Fotoalben 26 2. Helene Kaisen 45 2.1. Persönliche Unterlagen 45 2.2. Unterlagen aus politischer und gesellschaftlicher Tätigkeit 46 2.3. Nachbarschaftshaus Ohlenhof 48 2.4. Korrespondenz 53 2.5. Unterlagen zur Person 54 2.6. Fotoalben 55 3. Weitere Personen 55 3.1. Hans Henrik Kaisen 55 3.2. -

History of Germans in Maryland, P
UNIVERSITY OF CALIFORN A, SAN DIEGO 3 1822019442714 AN ;. ..'. ;TY ARYLAND i I DIEGO UNIVERSITY OF CAUFORN A SAN 3 1822019442714 Central University Library University of California, San Diego Please Note: This item is subject to recall. Date Due o ? Cl 39 (7/93) UCSDLi). HISTORY OF THE ^ortrtg of JOHN STRICKER HISTORY OF THE iij of IHarglmtd COMPILED BY LOUIS P. HENNIGHAUSEN READ AT THE MEETINGS OF THE SOCIETY FOR THE HISTORY OF THE GERMANS IN MARYLAND 1909 For Sale by W. E. C. Harrison & Sons, Booksellers and Stationers 214 E. Baltimore Street, Baltimore, Md. 1909 Copyright, 1909, by Louis P. Hennighausen Press of The Sun Job Printing Office Baltimore HISTORY OF THE <g*rmatt Swiet 0f The history of "The German Society of Maryland" will be more interesting and better understood by some knowledge of the formation and histories of similar soci- eties in other Atlantic ports of North America during the eighteenth century, who still continue their noble work of charity at the present time. They came into existence during the years of 1764 to 1784 in the cities of Phila- delphia, Pa. ; Charleston, South Carolina ; Baltimore, Maryland, and New York, with the object to assist Ger- man immigrants in distress and to mitigate and finally to abolish a pernicious system of contract labor of free white persons, which in reality became a system of slavery limited in years. We find that most of the laws govern- ing the conduct of negro slaves, were in the course of time made applicable to the white contract immigrant laborers usually called "Redemptioners." There is an erroneous impression that these redemp- tioners were all Germans, when, in fact, persons of all nationalities were kept under that bondage. -

1. April 1962 – »Genossin Ella« Wird Landesvorsitzende Der AWO Bremen 19
Historisches Kalenderblatt der SPD Bremen 1. April 1962 – »Genossin Ella« wird Landesvorsitzende der AWO Bremen 19 Ella Ehlers hatte bereits lange Zeit aktiv daran gearbeitet, dass sowohl die prakti- sche Arbeit als auch die Strukturen des Bremer Ortsausschusses der Arbeiterwohl- fahrt zukunftsfähiger wurden. Sie war dafür bekannt, Missstände anzusprechen und Verbesserungen anzuregen beziehungsweise umzusetzen. Ihre Forderung nach einer »gleichermaßen politischen, effizien- ten und klientenorientierten Wohlfahrtsorganisation« mündete schließlich unter anderem in die Gründung des Landesverbandes der Bremer Arbeiterwohlfahrt, dessen Vorsitz Ella am 1.4.1962 einnahm und die Bremer AWO für viele Jahre prägte. Geboren wurde Ella Ehlers am 30.5.1904 in Dresden. Da beide Eltern sowohl in der Gewerkschaft waren als auch seit 1900 in der SPD, erlebte Ella eine stark an den Werten der Arbeiterbewe- gung ausgerichtete Kindheit und Jugend. Nach der Volksschule Ella Ehlers, geb. Schimpf (1904–1985) arbeitete Ella in der Kinderstation eines Krankenhauses sowie in einem Sanatorium und lernte viele Dinge, die für ihr späteres berufliches Wirken von hoher Bedeutung waren. Nach dem Eintritt der Eltern in die KPD und ihrem eigenen Eintritt in den Kommunistischen Jugendverband machte Ella eine Ausbil- dung als Kindergärtnerin. Sie arbeitete im Kindererholungsheim der Roten Hilfe in Worpswede, welches sie ab 1926 leitete. Hier lernte Ella auch den späteren Bremer Senator und Bürgermeister Adolf »Adje« Ehlers kennen, den sie 1935 heiratete. Zur Zeit des NS arbeitete Ella für die SAP und half unter anderem, gefährdete Genoss*innen außer Landes zu bringen. Weitere Stationen ihres bewegten Lebens waren die Arbeit für die »Kampfgemeinschaft gegen den Faschismus«, die Grün- dung des Arbeiterhilfswerks als Zusammenschluss der Kommunisten und Sozialde- mokraten nach der Befreiung von 1945 sowie der Wechsel von der KPD in die SPD, gemeinsam mit ihrem Mann. -
Im Land Bremen Begegnen Sich Menschen Verschiedenster Kulturen Und Religionen Mit Ganz Unterschiedlichen Lebensformen, Sprachen Und Gebräuchen
1 2 Im Land Bremen begegnen sich Menschen verschiedenster Kulturen und Religionen mit ganz unterschiedlichen Lebensformen, Sprachen und Gebräuchen. Dies bereichert das Zusammenleben und erweitert Horizonte. Es macht Bremen aber auch zu einem bunten, freundlichen und weltoffenenen Land. In den letzten Jahren haben wir viele neue Mitbürgerin- nen und Mitbürger in unseren Städten begrüßt. Das große Engagement vieler Menschen in Bremen und Bremerhaven hat entscheidend dazu beigetragen, sie in unserer Mitte zu integrieren. Und wir brauchen auch weiterhin viel ehrenamt- liche Unterstützung, um ein stabiles Umfeld für ein gutes Zusammenleben aller zu schaffen. Wie lässt sich ein friedliches, von Respekt und Anerkennung geprägtes Miteinander der unterschiedlichen Kulturen und Lebenserfahrungen realisieren? Wie kann die Integra- tion der zu uns Geflüchteten gelingen? Wie bekämpfen wir wirkungsvoll Rassismus und Menschenfeindlichkeit? Wie machen wir unsere Stadt noch menschenfreundlicher? Mit diesen und anderen Fragen beschäftigt sich unsere Integrationswoche, die dieses Jahr zum sechsten Mal statt- findet. Mit vielen Veranstaltungen, auch in den Stadtteilen, wollen wir vor allem Begegnungen und Gespräche ermögli- chen, die der Schlüssel für ein gutes Miteinander sind. Es wird aber auch um Bildung und Ausbildung gehen, um Sprache und Wohnen, um Teilhabe, Wertvorstellungen und ethische Fragen, um Wirtschaft, Arbeit, Kultur, Gesund- heit, Rechtsstaat und Demokratie. Denn Integration fängt zwar mit der Sprache an, zieht sich aber durch alle Lebensbereiche. -

Rundbrief Stadtteilarbeit Als Pdf Download
Rundbrief 1–2020 Rundbrief Stadtteilarbeit ISSN 2510-5132 54. Jahrgang, Heft Nr. 1 Verbundene Vielfalt April 2020 Innovation und Tradition in der Nachbarschaftsarbeit Inhaltsverzeichnis Vorwort. 3 Position beziehen . 4 Tradition und Geschichte der Nachbarschaftsarbeit . 4 Vom Verband deutscher Nachbarschaftsheime zum Verband für sozial-kulturelle Arbeit . 12. Lebenswelt „Nachbarschaft“ als lokales Potenzial städtischer Entwicklung . 15 . Die Bedeutung einer Orientierung am Gemeinwesen für die Potentiale von Nachbarschafts häusern . 19 Haltungen in der Gemeinwesenarbeit entwickeln . .24 . Methoden in der Gemeinwesen - und Nachbarschaftsarbeit . 25 . Berichte und Erfahrungen aus der Praxis . 29 Praxisbeispiele zum Arbeitsfeld Nachhaltigkeit . 29. Praxisbeispiele zum Arbeitsfeld Partizipation und Demokratie . .30 . Praxisbeispiele zum Arbeitsfeld Digitalisierung . 34. Praxisbeispiele zum Arbeitsfeld Begegnung . 36 . Praxisbeispiel zum Arbeitsfeld Nachbarschaftshilfe . 40 Neues aus Verband und Mitgliedschaft . 41 Vorstellung neuer Mitglieder . 41 Wir gratulieren . 42. Impressum . 43 Rundbrief Stadtteilarbeit 1-2020 VERBUNDENE VIELFALT // INNOVATION UND TRADITION IN DER NACHBARSCHAFTSARBEIT POSITIONEN, EINDRÜCKE UND BERICHTE AUS FORSCHUNG UND PRAXIS ISSN 2510-5132 54 . Jahrgang, Heft Nr . 1 April 2020 VskA // Verband für sozial-kulturelle Arbeit e V. Fachverband der Nachbarschaftshäuser 2 Rundbrief 1-2020 | Verbundene Vielfalt // Innovation und Tradition in der Nachbarschaftsarbeit 1 Vorwort Mich fasziniert immer wieder wie groß die Konti- -
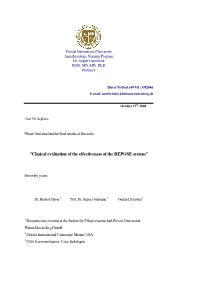
"Clinical Evaluation of the Effectiveness of the REPOSE System"
Florida International University Anesthesiology Nursing Program Dr. Jürgen Osterbrink RGN, MN (HP), Ph.D Professor Direct To Desk (49-911) 3982046 E-mail: [email protected] October 15th, 2004 Dear Mr. Seghers, Please find attached the final results of the study: "Clinical evaluation of the effectiveness of the REPOSE system" Sincerely yours, Dr. Herbert Mayer 1 Prof. Dr. Jürgen Osterbrink 2 Gerhard Schröder3 1 Biometrician, scientist at the Institut für Pflegewissenschaft Private Universität Witten/Herdecke gGmbH 2 Florida International University, Miami, USA 3 GSK Kommunikation, Uslar-Sohlingen Table of Contents 1 Introduction ....................................................................................................................3 2 Research literature ........................................................................................................ 6 2.1 Comments on research literature.............................................................................................6 2.2 Knowledge of pressure-reducing systems in the literature...................................................7 2.3 An overview of the literature according to the criteria..........................................................8 2.3.1 Prevention studies.........................................................................................................10 2.3.2 Therapeutic studies.......................................................................................................22 2.3.3 Treatment and therapeutic studies -

AWO BREMEN Engagiert 3•2018
AWO BREMEN engagiert 3•2018 Moderne KiTa im AWO So schön können AWO-Projekt Sozialzentrum West Sommerferien sein „Kinder in die Mitte“ Neue KiTa Ella-Ehlers-Haus Mit den Ferienfreizeiten Kindern Einblicke in offiziell eingeweiht des Kreisjugendwerks die Stadt ermöglichen :: INHALT :: EDITORIAL :: 02 :: 03 Woltmann Wir halten Sie mobil! Sommerferien mit dem Kreisjugendwerk der AWO Bremen am Unisee sind immer wieder ein tolles Erlebnis in der Natur Für unsere Marken als auch für alle anderen Fabrikate bündeln wir unser Know-how und AUS DEM INHALT bieten Ihnen u. a.: Hauptuntersuchung KINDER Neue KiTa Ella-Ehlers-Haus mit umfassendem Konzept 04 :: 05 Reifenservice & -einlagerung Spannende Umweltbildung mit Kartoffeln 14 tägliche TÜV-Abnahme Vereinbaren UNTERNEHMENSGRUPPE Verbesserungen stets im Blick 07 Autoglasreparatur Sie jetzt „Es geht nur gemeinsam!“ 12 :: 13 Klimaanlagenservice einen Termin. KREISJUGENDWERK So schön können Sommerferien sein 08 :: 09 Hersteller-Ersatzteile Wir beraten PROMI-KOCHEN Für die Rechte von Kindern unterwegs 10 Sie gerne! PROJEKTE „Gurkenquark und Sonnengruß“ 15 Woltmann Delmenhorst Syker Straße 111 · 27751 Delmenhorst Kinder in die Mitte | Wünsche für‘s Zusammenleben 16 :: 17 Oliver Mandalka ASYL Kulturelle Vielfalt im Übergangswohnheim 18 :: 19 T. 04221 / 976 5-412 JUGEND Viele Projekte bei „gemeinsam gut“ prämiert 22 :: 23 [email protected] Erstes gemeinsames Sommerfest in Vegesack 24 :: 25 www.woltmann-gruppe.de Brendel 2012_Layout 1 04.10.2012 10:46 Seite 1 ENGAGEMENT Mitgliederverband stärken! 26 | Seien Sie per E-Mail aktuell informiert! 27 EDITORIAL Ihr professioneller Partner für Küchen und Hausgeräte Dekorationsstoffe Polsterei Teppichboden Liebe Freund*innen der AWO Bremen, Ihr professioneller Partner für Küchen und Hausgeräte Sonnenschutz Brendel liebe Leser*innen, SSchöne Räume Kinder sind die Zukunft unserer Gesellschaft – ihnen bereits in jungen Jahren gute Rahmenbedingungen zu schaffen, ist Ziel des Kita-Ausbaus, den sich die AWO Bremen zum Schwerpunkt ge- macht hat. -

Schwachhausen
Erinnern Sie sich? Damals und heute - Zeitzeugen erzählen Ambiente. Charakter. Geschichte. Schwachhausen ENTSTEHUNG EINES KREISELS: Der Stern UMDEUTUNG EINER UNTERFÜHRUNG: Der Friedenstunnel GEWANDELTE ERINNERUNGSKULTUR: Der Elefant WOHLFÜHLEN IN SICHT WOHNEN MIT BLICK AUFS WASSER MIETWOHNUNGEN IN DER ÜBERSEESTADT AB FRÜHJAHR 2017 Die modernen Weserhäuser liegen › große, tiefe Balkone oder Loggien in der Überseestadt nahe des › Fußbodenheizung in der malerischen, mehr als hundertjäh- gesamten Wohnung rigen Molenturms, direkt an der › helle, bodentiefe Fenster Weser. In diesem dynamischen › neuester Energiestandard Stadtteil erleben Sie viele besondere › barrierearm Momente, die das Leben lebenswert machen. › lichte Deckenhöhe von 2,70m Zur Vermietung kommen 2- bis › moderne Bäder mit Handtuchheizkörper, bodengleichen Duschen 4-Zimmer Wohnungen ab ca. 50m2. und/oder Wannen BAUHERR & VERMIETUNG VERMIETUNG T. 30 80 68 94 T. 20 16 018 WWW.WESERHÄUSER.DE 3 1032: Erwähnung der Bürgerweide in einer Legende Wichtige Wandlungen im Lauf der Zeit eschichte schreitet voran Im kommenden Frühjahr Der Rembertitunnel wiederum zurzeit verhüllt – er wird er- G– selbstverständlich auch wird zum Beispiel der „Stern“ hat sich jüngst von einer ge- neut saniert. Auch in puncto in Schwachhausen, wo zwar bis umgebaut – der Verkehrs- wöhnlichen Bahnunterführung Deutungshoheit ist die Zeit heute viele geschichtsträchtige knotenpunkt soll danach unter vielen in ein Symbol der nicht spurlos an dem Denkmal Orte, Einrichtungen und übersichtlicher und deutlich Toleranz, Vielfalt und Verstän- vorbeigegangen – diesbezüglich Gebäude von vergangenen sicherer für alle Verkehrsteil- digung verwandelt: Eine enga- hat es einen gravierenden Be- Zeiten erzählen, sich gleichzei- nehmer sein. Unter anderem gierte Bremerin hatte 2001 die deutungswandel durchgemacht. tig aber auch ständig irgendwo ist geplant, dass der Kreisel Vision eines „Friedenstunnels“, Der Elefant erinnert an einen irgendetwas tut. -

The Jazz Republic: Music, Race, and American Culture in Weimar Germany
0/-*/&4637&: *ODPMMBCPSBUJPOXJUI6OHMVFJU XFIBWFTFUVQBTVSWFZ POMZUFORVFTUJPOT UP MFBSONPSFBCPVUIPXPQFOBDDFTTFCPPLTBSFEJTDPWFSFEBOEVTFE 8FSFBMMZWBMVFZPVSQBSUJDJQBUJPOQMFBTFUBLFQBSU $-*$,)&3& "OFMFDUSPOJDWFSTJPOPGUIJTCPPLJTGSFFMZBWBJMBCMF UIBOLTUP UIFTVQQPSUPGMJCSBSJFTXPSLJOHXJUI,OPXMFEHF6OMBUDIFE ,6JTBDPMMBCPSBUJWFJOJUJBUJWFEFTJHOFEUPNBLFIJHIRVBMJUZ CPPLT0QFO"DDFTTGPSUIFQVCMJDHPPE Revised Pages The Jazz Republic Revised Pages Social History, Popular Culture, and Politics in Germany Kathleen Canning, Series Editor Recent Titles Bodies and Ruins: Imagining the Bombing of Germany, 1945 to the Present David Crew The Jazz Republic: Music, Race, and American Culture in Weimar Germany Jonathan Wipplinger The War in Their Minds: German Soldiers and Their Violent Pasts in West Germany Svenja Goltermann Three-Way Street: Jews, Germans, and the Transnational Jay Howard Geller and Leslie Morris, Editors Beyond the Bauhaus: Cultural Modernity in Breslau, 1918–33 Deborah Ascher Barnstone Stop Reading! Look! Modern Vision and the Weimar Photographic Book Pepper Stetler The Corrigible and the Incorrigible: Science, Medicine, and the Convict in Twentieth- Century Germany Greg Eghigian An Emotional State: The Politics of Emotion in Postwar West German Culture Anna M. Parkinson Beyond Berlin: Twelve German Cities Confront the Nazi Past Gavriel D. Rosenfeld and Paul B. Jaskot, Editors Consumption and Violence: Radical Protest in Cold-War West Germany Alexander Sedlmaier Communism Day-to-Day: State Enterprises in East German Society Sandrine Kott Envisioning -

Tracing Immigrant Origins Research Outline
Tracing Immigrant Origins Research Outline Table of Contents Introduction Part 1. Search Strategies Step 1. Identify What You Know About The Immigrant Step 2. Decide What You Want To Learn Step 3: Select The Records To Search Step 4. Find And Search The Records Step 5. Use The Information Part 2. Country-of-arrival Records Part 3. Country-of-origin Records For Further Reading Comments And Suggestions INTRODUCTION This outline introduces the principles, search strategies, and various record types you can use to identify an immigrant ancestor's original hometown. These principles can be applied to almost any country. If you are just beginning your research, you may need additional information about genealogical records and search strategies. Finding an immigrant ancestor's place of origin is the key to finding earlier generations of the family. It provides access to many family history resources in that home area. Once you know a former place of residence or a birthplace, you may be able to add more generations to your pedigree. Learning about your family's history and experiences can be a source of enjoyment and education for you and your family. Tracing immigrant origins can be one of the hardest parts of family history research. Even if you know which country your family came from, it can still be hard to identify a specific hometown or birthplace. Using This Outline This outline is a reference tool. It has several features to help you learn about sources and strategies to find an immigrant's hometown. • Arrangement. This outline is divided into three main parts.