Jahrbuch 2009
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

Karl Plagge Ein Gerechter Unter Den Völkern
Karl Plagge Ein Gerechter unter den Völkern – Begleitheft zur Ausstellung – Herausgegeben von der Darmstädter Geschichtswerkstatt e.V. Ausstellungsinformationen / Impressum Ausstellungsinformationen: KARL PLAGGE, ein „Gerechter unter den Völkern“ Ausstellung herausgegeben vom Magistrat der Wissenschaftsstadt Darmstadt. Ein Projekt der Darmstädter Geschichtswerkstatt e.V. Unterstützt von: Vilna Gaon Jewish State Museum (Vilnius), Studienkreis Deutscher Wider- stand 1933–1945 (Frankfurt a.M.), Hilfsfonds Jüdische Sozialstation e.V. (Freiburg i.Br.). Finanziell gefördert durch die Stadtsparkasse Darmstadt und weitere Spenden. Verantwortlich für den Inhalt der Ausstellung: Hannelore Skroblies und Christoph Jetter. Gestaltung der Ausstellung: archetmedia Darmstadt GbR (www.archetmedia.de). Druck der Ausstellungstafeln: roboplot Darmstadt (www.roboplot.de). Informationen: www.darmstaedter-geschichtswerkstatt.de Kontakt: [email protected] Die Ausstellung besteht aus: 6 Ausstellungstafeln 2 x 1 m, doppelseitig bedruckt, mit der Auf- stellungstechnik aufbewahrt in einer transportablen Kiste; benötigter Raum: mindestens 5 x 10 m. Die Ausleihe für Darmstädter Schulen und Bildungseinrichtungen bei Selbstabholung ist kostenlos, Ausleihe für andere Einrichtungen gegen Kaution. Vormerkung und Ausleihe über: Ludwig-Georgs-Gymnasium Darmstadt (Telefon: 06151-132562 – E-Mail: [email protected]). Impressum: Begleitheft zur Ausstellung „KARL PLAGGE, ein Gerechter unter den Völkern.“ Herausgegeben von der Darmstädter Geschichtswerkstatt -

Schoen Consulting Claims Conference Holocaust Topline – AUSTRIA, US, CANADA March 2019 Screening Questions
Schoen Consulting Claims Conference Holocaust Topline – AUSTRIA, US, CANADA March 2019 Screening Questions United States Canada Austria • {Age} 18 and older 100% Under 18 [TERMINATE] --1 General Awareness - Open Ended Questions Intro: Thank you for your participation in this survey. The next questions in the survey are about a particular historical topic – the Holocaust. These questions don’t have right or wrong answers, so please be as honest and open as you can. 1. Have you ever seen or heard the word Holocaust before? Yes, I have definitely heard about the 89% 85% 87% Holocaust Yes, I think I’ve heard about the Holocaust 7% 9% 9% No, I don’t think I have heard about the 3% 3% 2% Holocaust No, I definitely have not heard about the 1% 3% 2% Holocaust IF NO, SKIP TO Q9 2. In your own words, what does the term Holocaust refer to? OPEN ENDED WITH PRECODES (MULTIPLE ANSWERS ACCEPTED) Extermination of the Jews/Jewish people 62% 64% 58% Genocide generally 18% 19% 27% World War II 4% 32% 16% The Nazis 3% 24% 7% Adolf Hitler 3% 15% 6% Other 14% 8% 15% Not sure 3% 4% 5% 1 Throughout this document “--” indicates no response while a “blank space” indicates that the question or answer choice was not asked in that specific country. Schoen Consulting Claims Conference Holocaust Topline – AUSTRIA, US, CANADA March 2019 United States Canada Austria 3. Who or what do you think caused the Holocaust? OPEN ENDED WITH PRECODES (MULTIPLE ANSWERS ACCEPTED) Adolf Hitler 83% 48% 39% The Nazis 67% 19% 21% Jews 10% 3% 8% World War I 6% 3% 4% Germany 36% 12% 2% Antisemitism -- -- 2% Other 1% 18% 19% Not sure 4% 8% 6% 4. -

The Austrian Resistance 1938–1945 This Book Was Produced with Support from the Zukunftsfonds Der Republik Österreich / Future Fund of the Republic of Austria
Wolfgang Neugebauer The Austrian Resistance 1938–1945 This book was produced with support from the Zukunftsfonds der Republik Österreich / Future Fund of the Republic of Austria. City of Vienna - Cultural Department, Science and Research Promotion Bibliographical information of the German National Library The German National Library has registered this book in the German National Bibliography; detailed bibliographical data is accessible on the Internet under http://dnb.ddb.de. Edition Steinbauer All rights reserved © Edition Steinbauer GmbH Vienna 2014 This book is a translation by John Nicholson and Eric Canepa of Wolfgang Neugebauer’s Der österreichische Widerstand 1938–1945 (Edition Steinbauer, 2008) in a revised version including the following new sections and chapters: Introduction, section 3; XIV.1; IV and XIII. Nicholson: Introduction, Chapters III–IV, VIII–XIII, XVIII–XIX, and general editing; Canepa: Chapters I–II, V–VII, XIV–XVII. Cover design: D&K Publishing Service Typography and layout: typothese.at / Matthäus Zinner Printed in Austria by Druckerei Theiss GmbH ISBN: 978-3-902494-66-5 Wolfgang Neugebauer The Austrian Resistance 1938–1945 Translated from the German by John Nicholson and Eric Canepa The Dachau Song The Dachau Song of September 1938 was the creation of two Viennese inmates, Jura Soyfer (words) and Herbert Zipper (music). The refrain ‘Arbeit macht frei’ was an allusion to the motto affixed to the concentration camp gates. Both Soyfer and Zipper were subsequently transferred to KZ Buchenwald, where Soyfer perished in 1939, while Zipper was released and survived the war to pen the English translation quoted here. Das Dachaulied Stacheldraht, mit Tod geladen, Schlepp den Stein und zieh den Wagen, Ist um unsre Welt gespannt. -

Geschichtsästhetik Und Affektpolitik. Stauffenberg Und Der 20
Repositorium für die Medienwissenschaft Drehli Robnik Geschichtsästhetik und Affektpolitik. Stauffenberg und der 20. Juli im Film 1948 - 2008 2009 https://doi.org/10.25969/mediarep/3736 Veröffentlichungsversion / published version Buch / book Empfohlene Zitierung / Suggested Citation: Robnik, Drehli: Geschichtsästhetik und Affektpolitik. Stauffenberg und der 20. Juli im Film 1948 - 2008. Wien: Turia + Kant 2009. DOI: https://doi.org/10.25969/mediarep/3736. Nutzungsbedingungen: Terms of use: Dieser Text wird unter einer Creative Commons - This document is made available under a creative commons - Namensnennung - Weitergabe unter gleichen Bedingungen 4.0/ Attribution - Share Alike 4.0/ License. For more information see: Lizenz zur Verfügung gestellt. Nähere Auskünfte zu dieser Lizenz https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ finden Sie hier: https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ GESCHICHTSÄSTHETIK UND AFFEKTPOLITIK Drehli Robnik Historiker und Filmwissenschaftler; Studium in Wien und Amsterdam; Forschungstätigkeit am Ludwig Boltzmann-Institut für Geschichte und Gesellschaft, Wien; Lehrtätigkeit an der Universität Wien, an der Masaryk University, Brno und der Johann Wolfgang Goethe-Universität, Frankfurt/M. Gelegentlich Disk-Jockey und Edutainer. »Lebt« in Wien-Erdberg. DREHLI ROBNIK Geschichtsästhetik und Affektpolitik Stauffenberg und der 20. Juli im Film 1948 - 2008 VERLAG TURIA + KANT WIEN Bibliografische Information Der Deutschen Bibliothek Die Deutsche Bibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; -

Reichskommissariat Ostland from Wikipedia, the Free Encyclopedia
Create account Log in Article Talk Read Edit View history Reichskommissariat Ostland From Wikipedia, the free encyclopedia "Ostland" redirects here. For the province of the Empire in Warhammer 40,000, see Ostland (Warhammer). Navigation Reichskommissariat Ostland (RKO) was the civilian occupation regime established by Main page Germany in the Baltic states (Estonia, Latvia, and Lithuania), the north-eastern part of Reichskommissariat Ostland Contents Poland and the west part of the Belarusian SSR during World War II. It was also known Reichskommissariat of Germany Featured content [1] initially as Reichskommissariat Baltenland ("Baltic Land"). The political organization Current events ← → for this territory—after an initial period of military administration before its establishment— 1941–1945 Random article was that of a German civilian administration, nominally under the authority of the Reich Donate to Wikipedia Ministry for the Occupied Eastern Territories (German: Reichsministerium für die besetzten Ostgebiete) led by Nazi ideologist Alfred Rosenberg, but was in reality Interaction controlled by the Nazi official Hinrich Lohse, its appointed Reichskommissar. Help The main political objective, which the ministry laid out in the framework of National Flag Emblem About Wikipedia Socialist policies for the east established by Adolf Hitler, were the complete annihilation Community portal of the Jewish population and the settlement of ethnic Germans along with the expulsion or Recent changes Germanization of parts of the native population -

Schulmaterial Zum Film Von Christian Frosch
Schulmaterial zum Film von Christian Frosch 1! INHALTSVERZEICHNIS Vorwort | Impressum..............................................3 Stab.............................................................4 Synopsis.........................................................5 Christian Frosch im Interview über MURER.........................6 GLOSSAR| Murer ..................................................9 Nationalsozialismus | Täter & Opfer.............................10 Vergangenheitsbewältigung | Recht & Gerechtigkeit...............13 FACT SHEETS | Franz Murer und seine Umfeld......................17 Inszenierung | Kamera | Musik...................................21 Arbeitsaufgaben.................................................23 Christian Frosch | Biografie, Filmografie.......................26 Ergänzungen | Material und Literatur............................27 2! VORWORT „Nicht die Erinnerung, sondern das Vergessen ist und bleibt die wahre Gefahr.“ (Primo Levi) Dieser Film lässt niemanden kalt. Regisseur Christian Frosch nimmt die ZuseherInnen mit auf Zeitreise. Mit Murer nehmen wir im Gerichtsaal Platz, hören die Verteidigung des Angeklagten, das Leid der Zeugen, das dramatische Plädoyer des Anwalts und das zwiespältige Urteil der Geschworenen. Dabei hinterfragt Christian Frosch nicht nur kritisch den Charakter Franz Murer, sondern auch den der politischen Parteien und Medien. Wie, so fragt mensch sich, kann ein Täter zum Opfer werden und die Opfer zu zweifelhaften ZeugInnen. Die ZuseherInnen bleiben betroffen zurück: Recht und Gerechtigkeit -

Harvard Und Das Office of Strategic Services* Ein Akademischer Beitrag Zu Einem Freien Und Unabhängigen Österreich
BRGÖ 2020 Beiträge zur Rechtsgeschichte Österreichs Stefan RASTL, Wien Harvard und das Office of Strategic Services* Ein akademischer Beitrag zu einem freien und unabhängigen Österreich Harvard and the Office of Strategic Services An academic contribution to a free and independent Austria When the tide turned in favor of the Allies in the Second World War, preparations for the denazification and re‐ democratization of Europe began as the war progressed. These preparations posed significant challenges for the US authorities, as they had to rely on local people in the liberated areas for administrative tasks in the immediate post‐ war period. The Office of Strategic Services was commissioned to collect the relevant information to ensure the best possible selection of pro‐democratic individuals. The OSS in turn used a group of Harvard University employees who had opposed the Nazi regime before the United States entered the war and were well networked with the OSS on the one hand and possible academic informants on the other. They worked together on the Biographical Records Project and other intelligence projects that should contribute to the liberation and re‐democratization of Europe. Keywords: Harvard University – intelligence studies – Office of Strategic Services – World War II Vorwort1 und Kunz das Vertrauen der US‐Geheimdienste gewinnen konnten, um für eine Lehrtätigkeit in Während eines Seminars von Prof. Thomas Frage zu kommen. Ebenfalls war es ein Ziel die‐ Olechowski im Jahr 2016 über Hans Kelsen und ser Arbeit, einzelne Prozesse und Vorbereitun‐ seinen Kreis erwähnte Prof. Olechowski, dass gen der USA bezüglich einer Militärregierung im Hans Kelsen und Josef Laurenz Kunz in den Nachkriegsösterreich, unter Beteiligung österrei‐ 1950er Lektoren für Völkerrecht am United States chischer Exilanten, zu erforschen. -

Widerstand 1938-1945
Ausg. Nr. 30 • 7. Feber 2005 Unparteiisches, unabhängiges und – derzeit noch – kostenloses Magazin speziell für Österreicherinnen und Österreicher in aller Welt in zwei pdf- Formaten • http://www.oe-journal.at Widerstand 1938-1945 Nationalratspräsident Andreas Khol lud, gemeinsam mit dem Verteidigungs- ministerium, der Politischen Akademie der ÖVP, dem Renner-Institut, dem Dokumentationsarchiv des österreichischen Widerstands und der katholischen Kirche, zur Tagung »Widerstand in Österreich 1938 - 1945«. Foto: Parlament / Gregor Zeitler ie Tagung „Widerstand in Österreich zur Eröffnung des Symposions. Es gehe dar- Identifikation mit ihm sei lange nicht so D1938 – 1945“ fand im Rahmen der Auf- um, mit scharfem Blick auch die Schatten- stark gewesen, wie dies wünschenswert ge- taktveranstaltungen zum Jubiläumsjahr 2005 seiten unserer Vergangenheit ins Auge zu wesen wäre, klagte Khol. Viele Widerstands- statt. In einer Reihe von Vorträgen wurden fassen, meinte Khol und erinnerte daran, daß gruppen seien auch in der Bevölkerung iso- verschiedene Aspekte des Widerstands be- im Jänner 1945 die Mordmaschine des NS- liert gewesen und es habe lange gebraucht, leuchtet. Abgeschlossen wurde die Veranstal- Regimes noch voll im Gange war. Das KZ bis der Widerstand vom 20. Juli 1944 auch tung mit einer Podiumsdiskussion zum Mauthausen war noch in Betrieb, Todes- in Österreich Anerkennung gefunden und in Tagungsthema, an der auch hochrangige urteile wurden verhängt und vollstreckt, seiner Bedeutung für Österreich erkannt Wissenschafter und Zeitzeugen teilnahmen. Menschen an Laternenpfählen aufgehängt. wurde. Der Angriffskrieg der Nationalsozia- Es habe aber auch Hoffnung gegeben – den listen war kein österreichischer Krieg, man Nationalratspräsident Widerstand unter dem Titel „Walküre“ in hat sich daher nicht mit dem Aufstand dage- Dr. -
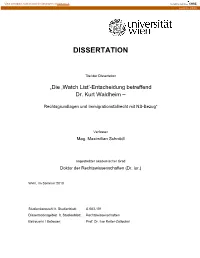
Dissertation
View metadata, citation and similar papers at core.ac.uk brought to you by CORE provided by OTHES DISSERTATION Titel der Dissertation „Die ‚Watch List‘-Entscheidung betreffend Dr. Kurt Waldheim – Rechtsgrundlagen und Immigrationsfallrecht mit NS-Bezug“ Verfasser Mag. Maximilian Schnödl angestrebter akademischer Grad Doktor der Rechtswissenschaften (Dr. iur.) Wien, im Sommer 2010 Studienkennzahl lt. Studienblatt: A 083-101 Dissertationsgebiet lt. Studienblatt: Rechtswissenschaften Betreuerin / Betreuer: Prof. Dr. Ilse Reiter-Zatloukal Meinen Eltern. INHALTSVERZEICHNIS Abkürzungsverzeichnis (Begriffe und Literatur) 9 1. Abkürzungsverzeichnis (Begriffe) 9 2. Abkürzungsverzeichnis (Literatur) 11 Abbildungsverzeichnis 14 Danksagung 15 I. Beschreibung des Forschungsprojekts sowie seiner Methoden 17 1. Die Forschungsfrage(n) 17 2. Forschungsstand und Quellenlage 18 A. Die Watch List-Entscheidung im Lichte der 1987 geltenden Rechtslage 18 B. Die Watch List-Entscheidung im Lichte der von 1987 bis 2007 geltenden Rechtslage 21 C. Rechtsvergleichende bzw. rechtsphilosophische Aspekte 22 3. Angewendete Forschungsmethoden 22 4. Struktur der Arbeit 23 II. Inhaltliche Einführung 25 1. Vorbemerkungen 25 2. Registrierungsmechanismen und Übereinkommen der Alliierten 25 A. Initiale Konzeptionen 25 B. Die United Nations War Crimes Commission 26 C. Das Central Registry of War Criminals and Security Suspects 28 D. Die Moskauer Deklaration und ihre Folgen 28 3. Relevante internationale Rechtsvorschriften in Kurt Waldheims Fall 30 A. Die Nürnberger Charta 30 B. Das Kontrollratsgesetz Nr. 10 30 4. Exkurs: Gesetzeslage und Gerichtspraxis in Österreich ab 1945 32 A. Einführung 32 B. Rechtspolitische Zielsetzungen im Jahr 1945 32 C. Umsetzung der 1945 geschaffenen Gesetzesbestimmungen 34 D. Konsolidierung der Entnazifizierungsbemühungen 35 E. Die ab 1948 geschaffenen Amnestiebestimmungen 38 F. Weiterentwicklung der NS-Judikatur nach 1955/57 39 III. -
S: I. M. O. N. Shoah: Intervention
01/2020 S: I. M. O. N. SHOAH: INTERVENTION. METHODS. DOCUMENTATION. S:I.M.O.N. – Shoah: Intervention. Methods. DocumentatiON. S:I.M.O.N. is the open-access e-journal of the Vienna Wiesenthal Institute for Holocaust Studies (VWI). It is committed to immediate open access for academic work. S: I.M.O.N. serves as a forum for discussion of vari- ous methodological approaches. The journal especially wishes to strengthen the exchange between researchers from different scientific communities and to integrate both the Jewish history and the history of the Holocaust into the different ‘national’ narratives. It also lays a special emphasis on memory studies and the analysis of politics of memory. The journal operates under the Creative Commons Licence CC-BY-NC-ND (Attribution- Non Commercial-No Derivatives). The copyright of all articles remains with the author of the article. The copyright of the layout and design of articles remains with S:I.M.O.N. Articles can be submitted in German or English. S:I.M.O.N. ist das Open-Access-E-Journal des Wiener Wiesenthal Instituts für Holocaust-Studien (VWI). Es setzt sich für einen sofortigen offenen Zugang zur wissenschaftlichen Arbeit ein. S:I.M.O.N. dient als Diskus- sionsforum für verschiedene methodische Ansätze. Die Zeitschrift möchte insbesondere den Austausch zwi- schen ForscherInnen aus unterschiedlichen Forschungszusammenhängen stärken und sowohl die jüdische Geschichte als auch die Geschichte des Holocaust in die verschiedenen „nationalen“ Erzählungen integrieren. Ein besonderer Schwerpunkt liegt auch auf Ansätzen der Memory Studies und der Analyse der Geschichts- politik. Die Zeitschrift arbeitet unter der Creative Commons-Lizenz CC-BY-NC-ND. -

MURER Anatomie Eines Prozesses
MURER Anatomie eines Prozesses von Christian Frosch Dramaturg Olaf Winkler Juristische Fachberatung Dr. Gabriele Pöschl Übersetzung Jiddisch/Hebräisch Tirza Lemberger Fassung 7.1 26.03.2017 © Prisma Film- und Fernsehproduktion GmbH © Paul Thiltges Distributions Rathausstrasse 3/18 27, zone industrielle A-1010 Wien L-8287 Kehlen (Luxembourg) Tel. +43 1 406 37 70 Tel. +352 250393 [email protected] [email protected] www.prismafilm.at www.ptd.lu 1. BÜRO WIESENTHAL INNEN/TAG Detail - man sieht, wie Frauenhände geschickt ein Tonband in ein tragbares Gerät einlegen. Im Hintergrund Off das Stimmen von Streichinstrumenten. SIMON WIESENTHAL (OFF) Sie schreiben für eine amerikanische Zeitung und sprechen Deutsch? ROSA SEGEV (OFF) Meine Familie ist 33 aus Deutschland emigriert. Zuerst London und dann in die Staaten. Bitte, Herr Wiesenthal… SIMON WIESENTHAL (OFF) 1,2,3,4,5. Sprechprobe Das Band spannt sich. Die Räder beginnen sich zu drehen. Es erklingen Streicher. 2. HOFBURG INNEN/TAG Ein Streichquartett spielt ein Potpourri aus Johann Strauß Walzern. Im Festsaal sitzt eine kleine Gruppe erlauchter Gäste. Auf dem Ehrenplatz das dänische Königspaar Frederik und Inge. Die Kamera streift über die Gäste hinaus in den Flur. 2A. HOFBURG – TOILETTENVORRAUM INNEN/TAG Eine Klofrau wippt zu der Melodie und blickt zum Toiletteneingang. Im Waschraum vor der Toilette steht MINISTER BRODA (48) und kontrolliert den Windsorknoten seiner Krawatte. Da sieht er im Spiegel ROBERT WALLNER (61). Im Gegensatz zum urbanen Broda trägt Wallner eine Festtracht. Wallner wäscht sich die Hände. WALLNER Herr Minister… Broda nimmt den Ball auf und antwortet grinsend, jede Silbe überdeutlich artikulierend. BRODA (IRONISCH) Herr Bauernbundpräsident... 2 Wallner grinst. -

Plunder of Jewish Property in the Nazi-Occupied Areas of the Soviet Union
Plunder of Jewish Property in the Nazi-Occupied Areas Of the Soviet Union Yitzhak Arad One of the by-products of the mass murder of the Jews in the Nazi- occupied areas of the Soviet Union between 1941 and 1944, was the confiscation and plunder of their property. This also fit into the broader policy of the Nazi exploitation of slave labor and economic resources in the occupied territories for the benefit of the German war economy. The aim was to supply the needs of the German armies in combat on the Eastern Front and of the German administration and its institutions in the occupied zones, and to help meet the essential needs of the population in Germany proper for agricultural produce. Due to the prevailing conditions in the Soviet Union, the murder and plunder of the Jews there differed from the murder in other German occupied countries. Soviet Jews were murdered at killing pits near their homes, and not in distant extermination camps. Consequently, all their money, valuables and other property were left on the spot at the disposal of the local authorities. Another significant difference lay in the concept of “private property” in a communist state including the property belonging to the individual Jew, which was different from the property kept by Jews in capitalist countries occupied by Nazi Germany. An array of German authorities operated in the occupied Soviet territories: the Wehrmacht and military administration, various SS formations, and the German civil administration. As a result, jurisdictional competition and the question of who rightfully “controlled” confiscated Jewish property were distinctive features associated with this pillage.