Strategische Umweltprüfung (SUP)
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

Verbandsordnung Des Kindertagesstätten-Zweckverbandes Simmern-Rheinböllen Vom 04.11.2019 Zuletzt Geändert Durch Die 1
Verbandsordnung des Kindertagesstätten-Zweckverbandes Simmern-Rheinböllen vom 04.11.2019 zuletzt geändert durch die 1. Änderung der Verbandsordnung in der Fassung der Bekanntmachung vom 15.01.2021 (durchgeschriebene Fassung) Präambel Die Trägerschaft der Kindertagesstätten ist in den Verbandsgemeinden Rheinböllen und Simmern unterschiedlich geregelt. So stehen die kommunalen Kindertagesstätten in der Verbandsgemeinde Rheinböllen in der Trägerschaft der Verbandsgemeinde Rheinböllen. Die kommunalen Kindertagesstätten in der Verbandsgemeinde Simmern dagegen stehen in der originären Trägerschaft der Ortsgemeinden, der Stadt Simmern bzw. bei dem Zweckverband Kindergarten Biebertal. Im Zuge der Fusion der beiden Verbandsgemeinden zur neuen Verbandsgemeinde Simmern-Rheinböllen wurde die Zusammenführung der unterschiedlichen Modelle vereinbart. Mit der Gründung des Kindertagesstätten- Zweckverbandes soll diesem Umstand nun Rechnung getragen werden. Mit dieser Verbandsordnung wird in einem ersten Schritt der gemeinsame Betrieb und die Trägerschaft geregelt. Um langfristig zu einer gemeinsamen Finanzierung des Zweckverbandes zu gelangen, sollen zunächst die ungedeckten Personalkosten nach § 12 des Kindertagesstättengesetzes sowie die den Kindertagesstätten zur Verfügung gestellten Budgets nach einem einheitlichen Abrechnungsschlüssel auf alle Mitglieder umgelegt werden. Hinsichtlich der Kosten für Betrieb und Unterhaltung der Gebäude sowie der Investitionskosten sollen die bisherigen Abrechnungsmodelle zunächst beibehalten werden um nach einem -

Gebäude Und Wohnungen Am 9. Mai 2011, Womrath
Gebäude und Wohnungen sowie Wohnverhältnisse der Haushalte Gemeinde Womrath am 9. Mai 2011 Ergebnisse des Zensus 2011 Zensus 9. Mai 2011 Womrath (Landkreis Rhein-Hunsrück-Kreis) Regionalschlüssel: 071405004163 Seite 2 von 32 Zensus 9. Mai 2011 Womrath (Landkreis Rhein-Hunsrück-Kreis) Regionalschlüssel: 071405004163 Inhaltsverzeichnis Einführung ................................................................................................................................................ 4 Rechtliche Grundlagen ............................................................................................................................. 4 Methode ................................................................................................................................................... 4 Systematik von Gebäuden und Wohnungen ............................................................................................. 5 Tabellen 1.1 Gebäude mit Wohnraum und Wohnungen in Gebäuden mit Wohnraum nach Baujahr, Gebäudetyp, Zahl der Wohnungen, Eigentumsform und Heizungsart .............. 6 1.2 Gebäude mit Wohnraum nach Baujahr und Gebäudeart, Gebäudetyp, Zahl der Wohnungen, Eigentumsform und Heizungsart ........................................................... 8 1.3.1 Gebäude mit Wohnraum nach regionaler Einheit und Baujahr, Gebäudeart, Gebäudetyp, Zahl der Wohnungen, Eigentumsform und Heizungsart ..................................... 10 1.3.2 Gebäude mit Wohnraum nach regionaler Einheit und Baujahr, Gebäudeart, Gebäudetyp, Zahl der Wohnungen, -

Theaterabende in Kümbdchen Vom 10
Mitteilungsblatt Nr. 2 Freitag, 10. Januar 2020 Jahrgang 01 Tanzgruppe „Saphir“ vom TuS Rheinböllen Jahresrückblick 2019 mit Stadtbürgermeisterin Bernadette Jourdant Verbandsbürgermeister Michael Boos über Ziele und Aufgaben der Verbandsgemeinde Simmern - Rheinböllen Tanzgruppe „Youngstars“ der AWO Rheinböllen Jugendleiter Serdar Öz und Stadteilkoordinatorin Nadja Hoffmann über Jung und Alt Ehrung ehemaliger Ratsmitglieder Verabschiedung Verbandsgemeinde Bürgermeister Arno Imig und Verleihung des Ehrenamtspreises der Stadt Rheinböllen Tanzgruppe „Blackout“ vom TuS Rheinböllen Gemälde-Ausstellung der Künstlerin Teresa Dura aus Kisselbach Für Ihr leibliches Wohl ist mit Kaffee, Kuchen und Herzhaftem bestens vorgesorgt Theaterabende in Kümbdchen Vom 10. – 12. Januar 2020 Aufführungen: Freitag:10.01.2020 - 19.00 Uhr Samstag: 11.01.2020 - 19.30 Uhr – Anschließend Musik Sonntag: 12.01.2020 - 18.30 Uhr Karten für die Samstag-Aufführung sind auch im Vorverkauf erhältlich. Der Förderverein des TV Kümbdchen-Keidelheim freut sich auf Ihren Besuch. Aktuelle Informationen auch unter www.sim-rhb.de 2 2I2020 Verbandsgemeinde Simmern-Rheinböllen Freitag, 10. Januar 2020 Bereich ehemalige Verbandsgemeinde Simmern Notdienst Wasserversorgung ........................................ 01713348371 NOTRUFE Notdienst Abwasserbeseitigung..................................... 01712114354 Notdienst Nahwärmeversorgung.................................. 01751805045 UND BEREITSCHAFTSDIENSTE RHEINHUNSRÜCK WASSER; ZWECKVERBAND; DÖRTH Die Wasserversorgung der Stadt Rheinböllen -

Gebäude Und Wohnungen Am 9. Mai 2011, Nieder Kostenz
Gebäude und Wohnungen sowie Wohnverhältnisse der Haushalte Gemeinde Nieder Kostenz am 9. Mai 2011 Ergebnisse des Zensus 2011 Zensus 9. Mai 2011 Nieder Kostenz (Landkreis Rhein-Hunsrück-Kreis) Regionalschlüssel: 071405004105 Seite 2 von 32 Zensus 9. Mai 2011 Nieder Kostenz (Landkreis Rhein-Hunsrück-Kreis) Regionalschlüssel: 071405004105 Inhaltsverzeichnis Einführung ................................................................................................................................................ 4 Rechtliche Grundlagen ............................................................................................................................. 4 Methode ................................................................................................................................................... 4 Systematik von Gebäuden und Wohnungen ............................................................................................. 5 Tabellen 1.1 Gebäude mit Wohnraum und Wohnungen in Gebäuden mit Wohnraum nach Baujahr, Gebäudetyp, Zahl der Wohnungen, Eigentumsform und Heizungsart .............. 6 1.2 Gebäude mit Wohnraum nach Baujahr und Gebäudeart, Gebäudetyp, Zahl der Wohnungen, Eigentumsform und Heizungsart ........................................................... 8 1.3.1 Gebäude mit Wohnraum nach regionaler Einheit und Baujahr, Gebäudeart, Gebäudetyp, Zahl der Wohnungen, Eigentumsform und Heizungsart ..................................... 10 1.3.2 Gebäude mit Wohnraum nach regionaler Einheit und Baujahr, Gebäudeart, Gebäudetyp, -
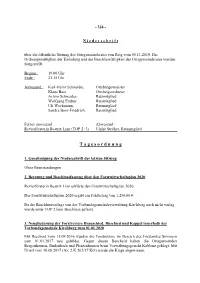
T a G E S O R D N U N G
- 324 - N i e d e r s c h r i f t über die öffentliche Sitzung des Ortsgemeinderates von Belg vom 05.11.2019. Die Ordnungsmäßigkeit der Einladung und die Beschlussfähigkeit des Ortsgemeinderates wurden festgestellt. Beginn : 19.00 Uhr Ende : 21.15 Uhr Anwesend : Karl-Heinz Schneider, Ortsbürgermeister Klaus Bast, Ortsbeigeordneter Achim Schneider, Ratsmitglied Wolfgang Endres, Ratsmitglied Uli Weckmann, Ratsmitglied Sandra Boor-Friedrich, Ratsmitglied Ferner anwesend : Abwesend : Revierförsterin Beatrix Linn (TOP 2+3) Ulrike Ströher, Ratsmitglied T a g e s o r d n u n g 1. Genehmigung der Niederschrift der letzten Sitzung Ohne Beanstandungen 2. Beratung und Beschlussfassung über den Forstwirtschaftsplan 2020 Revierförsterin Beatrix Linn erklärte den Forstwirtschaftsplan 2020. Der Forstwirtschaftsplan 2020 ergibt ein Fehlbetrag von 1.250,00 €. Da die Beschlussvorlage von der Verbandsgemeindeverwaltung Kirchberg noch nicht vorlag wurde unter TOP 2 kein Beschluss gefasst. 3. Neugliederung der Forstreviere Brauschied, Buschied und Kappel innerhalb der Verbandsgemeinde Kirchberg zum 01.01.2020 Mit Bescheid vom 15.09.2016 wurden die Forstreviere im Bereich des Forstamtes Simmern zum 01.01.2017 neu gebildet. Gegen diesen Bescheid haben die Ortsgemeinden Bergenhausen, Budenbach und Pleizenhausen beim Verwaltungsgericht Koblenz geklagt. Mit Urteil vom 30.08.2017 (Az: 2 K 262/17.KO) wurde die Klage abgewiesen. - 325 - Auch die Berufung beim OVG Koblenz (Az: 8 A 10826/18) wurde abgewiesen. Eine Revision wurde nicht zugelassen, so dass die Revierneugliederung, die mit Bescheid vom 15.09.2016 zum 01.01.2017 festgesetzt wurde, rechtskräftig ist. Zwischenzeitlich haben die drei zuvor genannten Ortsgemeinden nach § 9 Landeswaldgesetz (LWaldG) ein Revierabgrenzungsverfahren eingeleitet und mit Zustimmung aller Waldbesitzenden des gleichen Forstrevieres die Abgrenzung eines eigenen Forstrevieres mit Schreiben vom 24.03.2019 beantragt. -

Biebertaler Rundweg Biebertaler Rundweg
Biebertaler Rundweg Biebertaler Rundweg BiebertalerRadeln, Wandern und Walken im Biebertal r RundwegR Länge: 9,9 km, Start/Ende: Biebern am Park- Etappenvorschläge für drei kleinere platz des Gemeindehauses. werbeagentur 06761.3625 art Biebertaler Rundwege Wegebeschreibung: Vom Parkplatz des Gemeindehauses in Biebern Den Weg in Etappen aufzuteilen, bietet sich an, geht es geradeaus am Gasthaus "Pferdestall" huthwelkers da alle Orte ohne große Umwege von beiden Rundweg vorbei zum Biebertaler Rundweg (0,2 km) und Seiten des Rundweges zu erreichen sind und dann nach Fronhofen, dessen südöstlichstes so jede Etappe eine selbständige kleine Rundtour Ende bei der Durchquerung des Bieberbachtales darstellt. Gerade für Wanderer und Walker bietet „gestreift“ wird (2,6 km), wobei der Rundweg sich die Aufteilung in Etappen an, aber auch verlassen und auf der Höhe nach 500 m wieder Radfahrer, die schon große Strecken über Ver- erreicht wird. Die Rückrunde offenbart weite bindungsrouten zurückgelegt haben, können Hunsrückblicke ins Tal mit seinen Gemeinden, den Biebertaler Rundweg etappenweise mit in Radeln, Wandern und Walken im Biebertal und Walken Wandern Radeln, und weit darüber hinaus nach Kirchberg und Rundweg ihre Strecke einplanen. bis zum Soonwald. Nach einem kurzen Stück auf der K 20 geht's nach 1,8 km links talwärts 1 Rund um die Quellhöhe durch Reich auf die andere Seite des Rundweges des Bieberbaches (8,1 km) und im Bogen zurück nach Biebern (9,9 km). Länge: 14,1 km, Start/Ende: Wüschheim an Auf dem Weg: Weite Hunsrückblicke; Durch- der Grillhütte querung der Hunsrückgemeinden Reich, Biebern Wegebeschreibung: und Fronhofen. Von der Grillhütte in Wüschheim rechtsrum am Waldrand entlang wird der Biebertaler Rundweg über die "kleine Runde" nach 600 m erreicht. -

Ranglisten Gemeinde Von Nannhausen
27.09.2021 Karten, Analysen und Statistiken zur ansässigen Bevölkerung Bevölkerungsbilanz, Bevölkerungs- und Familienentwicklung, Altersklassen und Durchschnittsalter, Familienstand und Ausländer Skip Navigation Links GERMANIA / Rheinland-Pfalz / Provinz von Rhein-Hunsrück-Kreis / Nannhausen Powered by Page 1 L'azienda Contatti Login Urbistat on Linkedin Adminstat logo DEMOGRAPHIE WIRTSCHAFT RANGLISTEN SUCHEN GERMANIA Gemeinden Powered by Page 2 Nebeneinander anzeigen >> L'azienda Contatti Login Urbistat on Linkedin Alterkülz Horn Adminstat logo DEMOGRAPHIE WIRTSCHAFT RANGLISTEN SUCHEN AltweidelbachGERMANIAHungenroth Argenthal Kappel Badenhard Karbach, Hunsrück Bärenbach b Simmern, Kastellaun Hunsrück Keidelheim Belg Kirchberg Belgweiler (Hunsrück) Bell (Hunsrück) Kisselbach Beltheim Klosterkumbd Benzweiler Kludenbach Bergenhausen Korweiler Beulich Kratzenburg Bickenbach, Külz (Hunsrück) Hunsrück Kümbdchen Biebern Lahr Birkheim Laubach b Boppard, Kastellaun verbandsfr. Laudert Gemeinde Laufersweiler Braunshorn Lautzenhausen Bubach Leiningen Buch, Hunsrück Liebshausen Büchenbeuren Lindenschied Budenbach Lingerhahn Damscheid Maisborn Dichtelbach Maitzborn Dickenschied Mastershausen Dill Mengerschied Dillendorf Mermuth Dommershausen Metzenhausen Dörth Michelbach, Ellern (Hunsrück) Hunsrück Emmelshausen Mörschbach Erbach, Mörsdorf Hunsrück Powered by Page 3 Fronhofen Morshausen L'azienda Contatti Login Urbistat on Linkedin Gehlweiler Mühlpfad Adminstat logo DEMOGRAPHIE WIRTSCHAFT RANGLISTEN SUCHEN Gemünden, GERMANIAMutterschied Hunsrück Nannhausen -

Kirchberg Gültig Ab 01.08.19
FAHRPLANHEFT Verbandsgemeinde Kirchberg Gültig ab 01.08.19 Neue Linien, neue Ziele. 2019 kostenfrei, INFO-HOTLINE 0800 5 986 986 täglich von 8 bis 20 Uhr 6 MoritzheimM MerlMeMerrll HaserichHHaaseserriicchh 7222 71971919 6536 BudenbachB 657•7199 727 791 657 657 Leideneckk Alterkülzül 719 Völkenroth 652 Zell (Mosel) Kloster- Bergen- Tellig 719 657 Panzweiler 653 kumbd hausen 648 Pleizen- 641 Schauren Wal- 750 657 659 651 620 722 hausen Wüschheim Neuerkirch hausen 642•652 642•65252 653•659 653 3 Althaus Löffel- 666 Nieder- 642 607•642 Rayer- Benz-Ben Michelbach 653 schied wweiler Peterswald scheid 658 kumbd 640 653•657 659 Külz 642•6644 723 653•659 646•6655 761 657 653 Kappel 663 653 607•641•642 Wahlbach Rödel- Reich 658•659 653 655•657 607 620 hausen 655 641 640 Altweidelbach 723 655 657 Keidel- 649 607 607 723 657 Kludenbach 658•659 659 642 761 Altlay Würrich 663 Biebern heim 651 Belg 663 607 655 655 Reckers- Fronhofen Schnorbach 663 659 650 607 649 655 655 653 hausen 658 607 657 655 649 607 662•663655 658 Mutterschied 662 608 663 609 Maier- Hohen- Briedeler Todenroth 653•657 607•609 230•649 655 Nannhausen Simmern 601 620 640 Argenthalg mund stein Heck 655 662 Metzen- Heinzen- 608•609 609•669 660 650 660 230 602 603 609 750 663 hausen bach Unzenberg 609•658Ohlweiler 604 607 609 641 642 Schwarzen 602•604 662 Hahn 661•663 666 Nickweiler 649 651 659 669 645 Ravers- 662 669 beuren 657 602 Riesweiler 608•669 604 604•669 660 750 615 662 Ober Kostenz 655 608 Holzbach 602 (VRM-LINIENNETZPLAN) Hahn (Hunsr) 660 Schönborn Bärenbach 661 Rödern 604 665 Flughafen Nieder Kostenz 663 Opperts- 608 Belgweiler 660 669 608 661 608 hausen 604•606 606 Tiefenbach Lautzenhausen 663 604 608 32321 663•669 669 Kirchberg Maitz- 606 1 352 662 602 665 605 608 born 608 602 661•668 Sargenroth 605 Lötzbeuren 669 664•665 Nieder- Liederbach 605 609 655 665 Büchenbeuren Sohren 667•669 Ravengiers- 321•665 sohren 661 668 608 657 661 Weitere Liniennetzpläne, z.B. -

Kirchberg/Hunsrück – St. Michael
Kirchberg/Hunsrück – St. Michael Alphabetische Liste Familiennamen Ortschaften Alphabetische Liste Alphabetische Liste - 19.874 Personen Kirchberg/Hunsrück - St. Michael (kath.) 1675-1900 Autoren: Käthe Wimmer, Michael Frauenberger und Rudolf Schwan A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Z A ABELS Heinrich *u1890, Denzen u1920 ASSMANN Catharina ABINCKE Peter *Gascogne 1705 GOFFIN Catharina ABSOVEN Wilhelm vhKirchberg 1707 WEBER Anna Catharina ACHT Catharina *1791 Niedert 1834 REIBEL Georg Wilhelm ACHT Matthias 1659 SCHMIDT Elisabeth Catharina ACHT Philipp *e1761, Raum Niedert FISCHER Helena ACKERMANN Johann Peter *1728 Kirchberg 1752 SPENGLER Susanna Kunigunde Catharina ACKERMANN Maria Elisabeth *1726 Kirchberg <1752 SUPHÜL Philipp ACKERMANN Maria Magdalena *1719 Kirchberg ACKERMANN Maria Magdalena *1723 Kirchberg ACKERMANN Maria Magdalena *1731 Kirchberg ACKERMANN Peter Salomon *u1695, +Kirchberg I. <1719 NN Anna Barbara II. 1722 WEIHNACHT Anna Elisabeth III. 1741 NN Anna Catharina ADAM Anna Catharina *1786 Schönborn 1807 LINK Johann Peter ADAM Anna Elisabeth *e1770, Raum Dickenschied MÜLLER Johann Nikolaus ADAM Anna Elisabeth *e1724, vhHeinzenbach 1754 ZINCK Franz Nikolaus ADAM Caroline *u1849 Lindenschied 1874 WAGNER Johann Peter ADAM Christian *e1730, Lindenschied <1760 NN Anna Maria ADAM Christian *1760 Lindenschied 1783 GRÜNEWALD Anna Gertrud ADAM Elisabeth *e1804 Spesenroth I. 1837 DILLMANN Caspar II. 1849 LUKAS Johann Nikolaus ADAM Elisabeth *u1870, Raum Kirchberg <1894 KITSCH Johann ADAM Johann *e1741, Raum Kirchberg <1771 -

Biebertaler R Rundw Eg
Leporello_Biebertal_DRUCK!! 03.05.2007 10:04 Uhr Seite 1 C M Y CM MY CY CMY K Biebertaler Rundweg Biebertaler Rundweg BiebertalerRadeln, Wandern und Walken im Biebertal RRundweg Länge: 9,9 km, Start/Ende: Biebern am Park- Etappenvorschläge für drei kleinere platz des Gemeindehauses. Biebertaler Rundwege Wegebeschreibung: Vom Parkplatz des Gemeindehauses in Biebern Den Weg in Etappen aufzuteilen, bietet sich an, geht es geradeaus am Gasthaus "Pferdestall" da alle Orte ohne große Umwege von beiden vorbei zum Biebertaler Rundweg (0,2 km) und Seiten des Rundweges zu erreichen sind und dann nach Fronhofen, dessen südöstlichstes so jede Etappe eine selbständige kleine Rundtour Ende bei der Durchquerung des Bieberbachtales darstellt. Gerade für Wanderer und Walker bietet „gestreift“ wird (2,6 km), wobei der Rundweg Rundweg sich die Aufteilung in Etappen an, aber auch verlassen und auf der Höhe nach 500 m wieder Radfahrer, die schon große Strecken über Ver- erreicht wird. Die Rückrunde offenbart weite bindungsrouten zurückgelegt haben, können Hunsrückblicke ins Tal mit seinen Gemeinden, den Biebertaler Rundweg etappenweise mit in Radeln, Wandern und Walken im Biebertal und Walken Wandern Radeln, und weit darüber hinaus nach Kirchberg und Rundweg ihre Strecke einplanen. bis zum Soonwald. Nach einem kurzen Stück auf der K 20 geht's nach 1,8 km links talwärts 1 Rund um die Quellhöhe durch Reich auf die andere Seite des Rundweges des Bieberbaches (8,1 km) und im Bogen zurück nach Biebern (9,9 km). Länge: 14,1 km, Start/Ende: Wüschheim an Auf dem Weg: Weite Hunsrückblicke; Durch- der Grillhütte querung der Hunsrückgemeinden Reich, Biebern Wegebeschreibung: und Fronhofen. -
Traumschleifen
111 Traumschleifen Premium-Rundwanderwege in der Region um den Saar-Hunsrück-Steig Wanderführer 12. Auflage 1 111 Traumschleifen „Wie erklärt man jemandem, der noch nie davon gehört hat, was eine Traumschleife ist? “ Ganz einfach, hier sind die 11 Paragraphen des Traumschleifen-Grundgesetz: §1 Rundwanderwege Wie eine Schleife, die man um ein Geschenk bindet, ist jede Traumschleife ein Rundwanderweg. Der Vorteil: Die Wanderer haben eine bequeme und gut ausgeschilderte Anfahrt mit dem Auto oder den öffentlichen Verkehrsmitteln zum Startpunkt jeder Wanderung, dem Wanderportal. Dann darf man eine Schleife wandern. Und schon ist man wieder am Ausgangspunkt, und es geht wieder nach Hause. Oder zum Belohnungsbier in eine Gaststätte. Wanderregion §2 Saarland-Hunsrück Alle Traumschleifen findet man in der Wanderregion Saarland- Hunsrück in der Nähe des Saar-Hunsrück-Steigs, des besten Weitwanderwegs Deutschlands. Von der Obermosel am deutsch-französisch-luxemburgischen Dreiländereck im Westen bis zum Weltkulturerbe am Mittelrhein im Osten. Von der Mittelmosel im Norden bis zur Nahe im Süden. Die Saar- Hunsrück-Region ist eine Wanderregion. 2 §3 Unverlaufbar Alle Traumschleifen sind unverlaufbar. Was bedeutet das? Das heißt, dass man die Wanderkarte daheim lassen kann. Auch der Kompass wird nicht gebraucht, genauso wenig wie das GPS-Gerät. Wenn ich meinen Startpunkt am Wanderportal der Traumschleife gefunden habe, kann das Wandervergnügen starten. Damit bleibt ausreichend Zeit für das Wesentliche beim Wandern: Das Schauen, Riechen, Lauschen, Genießen in der Natur. Das Symbol der Traumschleifen mit dem jeweiligen Namen zeigt Ihnen immer und zuverlässig den richtigen Weg! §4 Landschaftserlebnisse Landschaftserlebnisse der Extraklasse sind garantiert im Traumschleifenland. Geschwungene Hügel, tief eingeschnittene Täler, atemraubende Felskulissen, verwunschene Burgen. -

Ewbstbl Und Anhang 20191231
Bundeszentralamt für Steuern, 53221 Bonn Bekanntmachung des Bundeszentralamtes für Steuern Familienleistungsausgleich; Liste der Körperschaften, Anstalten und Stiftungen des öffentli- chen Rechts, die auf ihre Zuständigkeit nach § 72 Abs. 1 EStG ver- zichtet haben (IV. Quartal 2019) St II 2 - S 2479-PB/19/00002 – bei Antwort bitte angeben – Bonn, 13. Oktober 2020 1 Anlage Gemäß § 72 Abs. 1 Satz 5 Einkommensteuergesetz (EStG) sind die Na- men und Anschriften der Körperschaften, Anstalten und Stiftungen des öffentlichen Rechts, die auf die Zuständigkeit für die Festsetzung und Zahlung des Kindergeldes nach § 72 Abs. 1 Satz 3 EStG verzichtet haben, sowie der Zeitpunkt, zu dem der Verzicht wirksam geworden ist, zu veröffentlichen. Die nachfolgend abgedruckte Übersicht führt die Körperschaften, An- stalten und Stiftungen des öffentlichen Rechts auf, die bis zum 31. De- zember 2019 auf ihre Zuständigkeit verzichtet haben und deren Aufga- ben als Familienkasse von der Bundesagentur für Arbeit übernommen werden, sowie den jeweiligen Zeitpunkt, zu dem der Verzicht wirksam wird. Die Übersicht ist nach dem Datum des Verzichts und der Postleit- zahl sortiert. Im Auftrag gez. Haag St II 2 - S 2479-PB/19/00002 Anlage Liste der Körperschaften, Anstalten und Stiftungen des öffentlichen Rechts, die auf die Zuständigkeit für die Festsetzung und Zahlung des Kindergeldes nach § 72 Abs. 1 Satz 3 EStG verzichtet haben Verzicht zum 1. Mai 2017: Nationalparklandkreis Birkenfeld Schneewiesenstr. 25 Wasser- und Bodenverband Warnow-Beke 55765 Birkenfeld Neukirchener Weg 27 18246 Jürgenshagen Verzicht zum 1. März 2018: Verzicht zum 1. Juni 2017: Stadt Nienburg (Saale) Marktplatz 1 Zahnärztlicher Bezirksverband 06429 Nienburg (Saale) Oberfranken Justus-Liebig-Str. 113 Gemeinde Berga 95447 Bayreuth Lange Str.