Stadtteil-Historiker“ 2014 Bis 2018
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

Degussa-Areal Taunusturm/Bankenviertel
1 Innenstadtkonzept 2 Dom-Römer-Areal 3 Degussa-Areal 4 Taunusturm/Bankenviertel 5 Stadtumbau Bahnhofsviertel 6 Campus Westend 7 Senckenberganlage/Bockenheimer Warte 9 Europaviertel/Messeerweiterung Rahmenplan für die Entwicklung der Innenstadt Neubebauung eines kleinteiligen Altstadtquartiers nach Zukünftiges „MainTor-Quartier“ wird im Zuge der Stadträumliche Verdichtung und Bündelung von Hoch- Neues Wohnen & Entwicklung einer Campus-Universität „im Park“ Wandel des ehemaligen Universitätsquartiers zum Immenses Potential für die Innenentwicklung dem Abriss des Technisches Rathauses Neubebauung öffentlich zugänglich und aufgewertet häusern im traditionellen Bankenviertel Leben im Bahnhofsviertel urbanen „Kultur Campus Bockenheim“ Zukünftiger Boulevard Berliner Straße, Perspektive: Büro raumwerk Städtebauliches Modell des Dom-Römerberg-Areals Panorama „MainTor-Quartier“ (KSP Architekten) © DIC Projektentwicklung GmbH & Co.KG Taunusturm (Bildmitte) von der Neuen Mainzer Straße © Gruber + Kleine-Kraneburg Architekten „1000 Balkone“ auf den Hofseiten der Gebäude: Idee des Büros bb22 Blick auf den zentralen Campusplatz und das neue Hörsaalgebäude Modell zur überarbeiteten Rahmenplanung Sommer 2010, Entwurf: K9 Architekten Blick in das Areal „Helenenhöfe“, Visualisierung: aurealis Real Estate GmbH& Co.KG Planungsanlass: Die Frankfurter Innenstadt ist Wohn- und Arbeitsort und Planungsanlass: Nach Abriss des Technischen Rathauses soll das Areal Planungsanlass: Die als Deutsche Gold- und Silber-Scheide-Anstalt Planungsanlass: Der geplante Taunusturm -
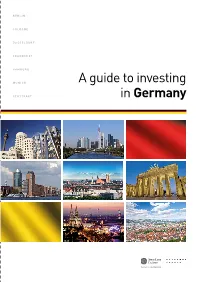
A Guide to Investing in Germany Introduction | 3
BERLIN COLOGNE DUSSELDORF FRANKFURT HAMBURG MUNICH A guide to investing STUTTGART in Germany ísafördur Saudharkrokur Akureyri Borgarnes Keflavik Reykjavik Selfoss ICELAND Egilsstadir A guide to investing in Germany Introduction | 3 BERLIN FINLAND ME TI HT NORWAY IG HELSINKI FL COLOGNE R 2H SWEDEN TALLINN OSLO INTRODUCTION ESTONIA STOCKHOLM IME T T GH LI DUSSELDORF F IN 0M 3 RIGA INVESTING IN GERMANY R 1H LATVIA E FRANKFURT EDINBURGH IM T T LITHUANIA GH DENMARK LI F R COPENHAGEN VILNIUS BELFAST 1H MINSK IRELAND HAMBURG DUBLIN BELARUS IME HT T LIG F IN HAMBURG M 0 UNITED KINGDOM 3 WARSAW Germany is one of the largest Investment Markets in Europe, with an average commercial AMSTERDAM BERLIN KIEV MUNICH NETHERLANDS POLAND transaction volume of more than €25 bn (2007-2012). It is a safe haven for global capital and LONDON BRUSSELS DÜSSELDORF COLOGNE UKRAINE offers investors a stable financial, political and legal environment that is highly attractive to both BELGIUM PRAGUE STUTTGART FRANKFURT CZECH REPUBLIC domestic and international groups. LUXEMBOURG PARIS SLOVAKIA STUTTGART BRATISLAVA VIENNA MUNICH BUDAPEST This brochure provides an introduction to investing in German real estate. Jones Lang LaSalle FRANCE AUSTRIA HUNGARY BERN ROMANIA has 40 years experience in Germany and today has ten offices covering all of the major German SWITZERLAND SLOVENIA markets. Our full-service real estate offering is unrivalled in Germany and we look forward to LJUBLJANA CROATIA BUCHAREST ZAGREB BELGRADE sharing our in-depth market knowledge with you. BOSNIA & HERZEGOVINA SERBIA SARAJEVO BULGARIA ITALY SOFIA PRESTINA KOSOVO Timo Tschammler MSc FRICS SKOPJE HAMBURG MACEDONIA International Director ROME TIRANA MADRID ALBANIA Management Board Germany PORTUGAL Lisboa (Lisbon) SPAIN GREECE Office and Industrial, Jones Lang LaSalle Setúbal ATHENS BERLIN Germany enjoys a thriving, robust and mature real estate market which is one of the DÜSSELDORF cornerstones of the German economy. -

Ahsgramerican Historical Society of Germans from Russia Germanic Origins Project Ni-Nzz
AHSGR American Historical Society of Germans From Russia Germanic Origins Project Legend: BV=a German village near the Black Sea . FN= German family name. FSL= First Settlers’ List. GL= a locality in the Germanies. GS= one of the German states. ML= Marriage List. RN= the name of a researcher who has verified one or more German origins. UC= unconfirmed. VV= a German Volga village. A word in bold indicates there is another entry regarding that word or phrase. Click on the bold word or phrase to go to that other entry. Red text calls attention to information for which verification is completed or well underway. Push the back button on your browser to return to the Germanic Origins Project home page. Ni-Nzz last updated Jan 2015 Ni?, Markgrafschaft Muehren: an unidentified place said by the Rosenheim FSL to be homeUC to Marx family. NicholasFN: go to Nicolaus. Nick{Johannes}: KS147 says Ni(c)k(no forename given) left Nidda near Buedingen heading for Jag.Poljanna in 1766. {Johannes} left Seelmann for Pfieffer {sic?} Seelmann in 1788 (Mai1798:Mv2710). Listed in Preuss in 1798 with a wife, children and step-children (Mai1798:Ps52). I could not find him in any published FSL. NickelFN: said by the Bangert FSL to be fromUC Rod an der Weil, Nassau-Usingen. For 1798 see Mai1798:Sr48. Nickel{A.Barbara}FN: said by the 1798 Galka census to be the maiden name of frau Fuchs{J.Kaspar} (Mai1798:Gk11). Nickel{J.Adam}FN: said by the Galka FSL to be fromUC Glauburg, Gelnhausen. For 1798 see Mai1798:Gk21. -

Und Bodenschutzalarmplan
Gewässer- und Bodenschutzalarmplan für die Stadt Frankfurt am Main Stand 10/17 Herausgeber: Magistrat der Stadt Frankfurt am Main Umweltamt Untere Wasser- und Bodenschutzbehörde Galvanistraße 28 60486 Frankfurt am Main 1 Inhaltsverzeichnis Seite 1. Allgemeines 1.1 Gültigkeitsbereich mit Übersichtsplan 3 1.2 Alarmschema 4 1.3 Meldebogen 5 2. Zweck des Gewässerschutzalarmplanes 2.1 Geltungsbereich 7 2.2 Umweltgefährdende/wassergefährdende Stoffe 7 2.3 Meldepflicht und Meldung 7 2.4 Zuständigkeiten 8 3. Gebiete von besonderer wasserwirtschaftlicher Bedeutung 3.1 Trinkwasserschutzgebiete 10 3.1.1 Auflistung der festgesetzten und beantragten Trinkwasserschutzgebiete 10 3.1.2 Kartenausschnitte der festgesetzten Trinkwasserschutzgebiete 11 3.2 Heilquellenschutzgebiete (Auflistung) 14 3.3 Festgesetzte Überschwemmungsgebiete (Auflistung) 15 3.4 Gebiete mit Trennkanalisation (Auflistung) 16 4. Verzeichnis der Meldestellen 4.1 Meldestellen in besonderen Fällen 17 4.2 Weitere in Anspruch zu nehmende Stellen 26 Stand 05/13 2 1. Allgemeines 1.1 Gültigkeitsbereich mit Übersichtsplan 1.1.1 Der Gewässerschutz-und Bodenschutzalarmplan gilt für das Stadtgebiet Frankfurt am Main 1.1.2 Stadtgebietsgrenze Main: Linkes Ufer: Main-Kilometer 22,445 - 38,385 Rechtes Ufer: Main-Kilometer 19,685 - 46,445 1.1.3 Übersichtskarte mit angrenzenden Landkreisen und Stadtgebiet Offenbach geänderter Auszug aus: Hessen 1 : 200 000 Verwaltungsgrenzenausgabe mit Gemarkung. Hrsg.: Hessisches Landesvermessungsamt 1992 Zuständige Wasser- und Bodenschutzbehörde für die jeweiligen -

Frankfurt Am Main Kalbach-Riedberg
Frankfurt am Main Kalbach-Riedberg Informationsbroschüre 2. Auflage 2018 10-5190 SUNFL Anz 205x195li V2_Merkur_Layout 1 24.03.17 10:38 Seite 1 Wir sind mehr als ein Garten-Center • Frischemarkt • Gartenplanung • Floristik/Dekoartikel • Gartenmöbel • Saunen und Whirlpools • Gartentechnik • Kulturelle Veranstaltungen • Grills/Grillschule • Exklusive Gartenbekleidung • Café/Restaurant und natürlich Pflanzen in großer Vielfalt und Qualität Wir freuen uns auf Ihren Besuch SUNFLOWERGARTENCENTER An der A 661 · Am Martinszehnten 15 · 60437 Frankfurt Telefon 069 - 50 00 49 - 0 · www.sunflower-gartencenter.de 10-5190 SUNFL Anz 205x195li V2_Merkur_Layout 1 24.03.17 10:38 Seite 1 Wir sind mehr als ein Garten-Center Grußwort der Ortsvorsteherin • Frischemarkt • Gartenplanung • Floristik/Dekoartikel • Gartenmöbel • Saunen und Whirlpools • Gartentechnik • Kulturelle Veranstaltungen • Grills/Grillschule • Exklusive Gartenbekleidung • Café/Restaurant Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger, wir haben unsere Informationsbroschüre aktualisiert. Das kommt und natürlich Pflanzen in großer Vielfalt und Qualität nicht von ungefähr, denn in den vergangenen Jahren ist viel in unserem Ortsbezirk passiert. Kalbach und Riedberg sind ge- wachsen und die Infrastruktur ebenfalls. Es war ein langer und spannender Weg. Sowohl für das alte, hier wohnen, wertvolle Hinweise und interessante Informatio- ehemals dörfliche Kalbach, dessen Ursprung im 8. Jahrhundert nen in dieser Broschüre finden. Neben der Darstellung der Kal- liegt, wie für den Riedberg als Frankfurts größte und jüngste bacher und Riedberger Geschichte finden Sie mit den Auflistun- Stadterweiterung. Ein neuer, moderner und urbaner Stadtteil, gen über die Verwaltung, Kirchen, Schulen, Kitas und Vereine, der an den naturwissenschaftlichen Campus der Goethe-Uni- gemeinsam mit den Hinweisen zum Geschäftsleben, ein aktuel- versität angrenzt, aber doch von attraktiven Grünflächen durch- les und lebendiges Abbild unseres Stadtteils. -

U-Bahn Linie U8 Fahrpläne & Netzkarten
U-Bahn Linie U8 Fahrpläne & Netzkarten Frankfurt (Main) Riedberg - Frankfurt (Main) Im Website-Modus Anzeigen Südbahnhof Die U-Bahn Linie U8 (Frankfurt (Main) Riedberg - Frankfurt (Main) Südbahnhof) hat 2 Routen (1) Nieder-Eschbach / riedberg: 24 Stunden (2) Südbahnhof: 24 Stunden Verwende Moovit, um die nächste Station der U-Bahn Linie U8 zu ƒnden und, um zu erfahren wann die nächste U-Bahn Linie U8 kommt. Richtung: Nieder-Eschbach / Riedberg U-Bahn Linie U8 Fahrpläne 22 Haltestellen Abfahrzeiten in Richtung Nieder-Eschbach / riedberg LINIENPLAN ANZEIGEN Montag 24 Stunden Dienstag 24 Stunden Frankfurt (Main) Nieder-Eschbach Görlitzer Straße, Frankfurt am Main Mittwoch 24 Stunden Frankfurt (Main) Bonames Mitte Donnerstag 24 Stunden Friedrich-Stampfer-Straße 1, Frankfurt am Main Freitag 24 Stunden Frankfurt (Main) Kalbach Samstag 24 Stunden Frankfurt (Main) Riedberg Sonntag 24 Stunden Bertha-Bagge-Straße 68, Frankfurt am Main Frankfurt (Main) Uni Campus Riedberg Riedbergallee 15, Frankfurt am Main U-Bahn Linie U8 Info Frankfurt (Main) Niederursel Richtung: Nieder-Eschbach / Riedberg Krautgartenweg 8, Frankfurt am Main Stationen: 22 Fahrtdauer: 27 Min Frankfurt (Main) Wiesenau Linien Informationen: Frankfurt (Main) Nieder- Krautgartenweg 75, Frankfurt am Main Eschbach, Frankfurt (Main) Bonames Mitte, Frankfurt (Main) Kalbach, Frankfurt (Main) Riedberg, Frankfurt (Main) Zeilweg Frankfurt (Main) Uni Campus Riedberg, Frankfurt Aßlarer Straße 36, Frankfurt am Main (Main) Niederursel, Frankfurt (Main) Wiesenau, Frankfurt (Main) Zeilweg, Frankfurt -

Frankfurter Sozialbericht
REIHE SOZIALES UND JUGEND | 41 Wir bieten Hilfe an. FRANKFURTER SOZIALBERICHT TEIL X: FAMILIEN IN FRANKFURT AM MAIN – LEBENSWIRKLICHKEIT UND UNTERSTÜTZUNGSBEDARFE Ergebnisse einer empirischen Erhebung unter Frankfurter Müttern und Vätern mit minderjährigen Kindern Dezernat für Soziales, Senioren, Jugend und Recht FRANKFURTER SOZIALBERICHT TEIL X: FAMILIEN IN FRANKFURT AM MAIN – LEBENSWIRKLICHKEIT UND UNTERSTÜTZUNGSBEDARFE Verfasser/-innen: Pia Bolz Dr. Herbert Jacobs Nicole Lubinski Wissenschaftliche Begleitung: Prof. Dr. Diether Döring Europäische Akademie der Arbeit in der Universität Frankfurt am Main Reiner Höft-Dzemski Deutscher Verein für öffentliche und private Fürsorge e. V., Berlin Mitglieder des Beirats der Sozialberichterstattung: Karl-Heinz Huth Agentur für Arbeit Frankfurt am Main Dr. Jürgen Richter Arbeiterwohlfahrt, Kreisverband Frankfurt am Main e.V. Petra Becher Bürgerinstitut e.V. Hartmut Fritz Caritasverband Frankfurt e.V. Michael Zimmermann-Freitag Der PARITÄTISCHE Hessen, Regionalgeschäftsstelle Ffm Horst Koch-Panzner DGB, Kreis Frankfurt am Main Pfarrer Dr. Michael Frase Diakonisches Werk Frankfurt am Main Prof. Dr. Gero Lipsmeier Fachhochschule Frankfurt am Main, Fachbereich 4 Rebekka Rammé Frankfurter Jugendring Dr. Ralf Geruschkat Industrie- und Handelskammer Frankfurt am Main Iris Behr Institut Wohnen und Umwelt, Darmstadt Dezernat für Soziales, Senioren, Jugend und Recht Frankfurt am Main, 2014 3 VORWORT 4 FRANKFURTER SOZIALBERICHT, TEIL X – FAMILIEN IN FRANKFURT AM MAIN 5 den vorliegenden Bericht eine umfangreiche -

Die Tunnelbaustelle Am Albaufstieg Seite 6
JULI 2013 | AusGABE 5 REPORTAGE Die Tunnelbaustelle am Albaufstieg SEITe 6 INTERVIEW Peter Ramsauer über Stuttgart 21 SEITe 4 PORTRÄT Flughafenchef Georg Fundel SEITe 18 Herausgeber: Bahnprojekt Stuttgart–Ulm e.V. Stuttgart–Ulm Bahnprojekt Herausgeber: ESSAY Ein Schüler blickt in die nahe Zukunft SEITe 12 2 INHALT INTERVIEW Verkehrsminister Peter Ramsauer 4 REPORTAGE Die Tunnelbaustelle am Albaufstieg 6 ESSAY Eine Reise ins Morgen 12 IM BILDE 14 PORTRÄT 28 Flughafenchef Georg Fundel 18 KURZ NOTIERT 21 INTERVIEW Das letzte Interview vor seinem tödlichen Unfall: Polizeipräsident Thomas Züfle 22 PORTRÄT Seelsorger Peter Maile 28 HINTERGRUND Sechs Fragen an Volker Kefer 30 18 6 PERSÖNLICH 31 IMPRESSUM Herausgeber: Bahnprojekt Stuttgart–Ulm e.V. • Kommunikationsbüro Jägerstraße 2 • 70174 Stuttgart Telefon: 0711 / 21 3 21 - 200 • E-Mail: [email protected] www.bahnprojekt-stuttgart-ulm.de V.i.S.d.P.: Wolfgang Dietrich, Vorstandsvorsitzender Realisierung: Lose Bande Druck: Konradin Druck GmbH Titelfoto: Steinbühltunnel Hohenstadt, Startbaugrube Pfaffenäcker Bildnachweis: Reiner Pfisterer (1, 2, 3, 7 – 11, 14 – 16, 24, 27, 31), Bastian Eller/BMVBS (S. 5), Patrick Gruenenwald (S. 14), René Schmitz (S. 14), Andreas Rosar (S. 14, 15), Arnim Kilgus (16), Stuttgarter Zeitung (S. 26), Wikipedia (27), Deutsche Bahn AG (30), Auflage: 150.000 Exemplare Die nächste Ausgabe erscheint im Oktober 2013. 3 INHALT VORWORT edem Anfang wohnt ein Zauber inne!” An dieses „Es ist eine Jgeflügelte Wort von Hermann Hesse fühlt sich so Aufbruchstimmung mancher Zaungast in diesen Tagen erinnert, wenn zu spüren.“ er auf die Baustellen für den neuen Bahnknoten in Wolfgang Dietrich, Stuttgart blickt. Zwar wird schon seit geraumer Zeit Projektsprecher an dem Projekt gearbeitet, in der großen Dimension wahrgenommen wird es aber erst, seit der Aufsichtsrat der Bahn die Zeit der Unsicherheit beendet und damit das finale Go für die Bautrupps gegeben hat. -

Report Frankfurt Am Main - the Metropolis on the River Main with an International Format, a Global City at the Centre of Europe
RESIDENTIAL MARKET FRANKFURTREPORT FRANKFURT AM MAIN - THE METROPOLIS ON THE RIVER MAIN WITH AN INTERNATIONAL FORMAT, A GLOBAL CITY AT THE CENTRE OF EUROPE FRANKFURT AM MAIN A CITY WHICH IS GROWING HORIZONTALLY AND VERTICALLY, INTEGRATING MEETING THE DEMAND FOR LIVING SPACE WITH MODERN CONCEPTS! RESIDENTIAL MARKETREPORTFRANKFURT 3 BOOMTOWN 5,722,000 759,000 2,300,000 Population of the Rhine- Population of Population of Frankfurt FRANKFURT am Main Main metropolitan region Frankfurt am Main am Main and its suburbs The most international city in Germany, the largest financial centre in continental Europe & the fastest growing major city 2019: 759,000 +13.3% +7.1% P O P U L +4.4% A 2035: +2.4% TOP 4 T POPULATION GROWTH IO N FORECAST 2019–2035 (%) GR OWTH 860,000 HAMBURG BERLIN MUNICH FRANKFURT AM MAIN POPULATION GROWTH IN THE FRANKFURT RHINE/MAIN METROPOLITAN REGION FORECAST 6,100 Frankfurt am main IS THE CITY WITH BY FAR THE 5,900 STRONGEST POPULATION GROWTH FORECAST AMONG 5,700 THE TOP 4 IN GERMANY. IN ADDITION, THE RHINE-MAIN thousandsin REGION AS A WHOLE IS ALSO GROWING AT AN ABOVE- 5,500 AVERAGE RATE. 5,300 1999 2003 2007 2011 2015 2019 2023 2027 2031 2035 Source: Oxford Economics, Stadt Frankfurt am Main 4 5 FRANKFURT NO.1 Financial Centre AM MAIN Continental Europe GLOBAL FINANCIAL CENTRE 311 destinations in 97 countries BREXIT-WINNER 70.5 M Approx. 25 applications to Passengers in 2019 BaFin for new banking licences >1,400 NORDRHEIN-WESTFALEN FLIGHTS departures and arrivals daily HESSEN INTERNATIONAL REACH 1 of 30 global gateway cities 5 MOTORWAYS & 6 MAJOR TRUNK ROADS link Frankfurt with SECTOR MIX TALENT BASE the whole of Europe Frankfurt am Main is regarded as the job 27 Universities and other motor of the Rhine-Main area and has by institutions of higher education, far the highest office employment rate in Frankfurt am Main 50 educational facilities with Wiesbaden Germany at over 50%. -

RMV Wabenplan
Übersichtskarte Tarifgebiete Preisstufen im Nahbereich Zennern Niedermöllrich Viermünden Udenborn Rengers- Wabern Der Nahbereich ist in orange A0-Tarifgebiete unterteilt. Je Somplar hausen Hommers- hausen Harle RMV-Tarifgebiet Wangers- Schreufa Utters- nach Linienverlauf können Sie anhand der Anzahl und Art hausen Großen- hausen 8501 Geismar englis Uns- Klein- hausen Frankenberg 85 Rockshausen 8101 (Eder) 8420 der befahrenen Tarifgebiete mit der unten stehenden Dörnholz- Falkenberg Dankerode Friedrichs- Gombeth Lendorf Hebel Osterfeld hausen hausen Kersten- Singlis Preisbildungsregel die Preisstufe bestimmen. Röddenau Haubern 8201 Hütten- hausen Arnsbach Seifershausen 8030 rode Übergangstarifgebiet Borken Willersdorf Halge- Trocken- Haine hausen 8830 Erkshausen Allendorf Römers- Battenhausen erfurth Pfaffenhausen 8010 hausen Haina (Eder) Nassen- Schwarzenhasel Diese Tarifgebiete gehören zu Birken- erfuth Rotenburg Bottendorf Oberholz- Mohnhausen Römersberg Freudenthal Preis- Fahrtwege mit Start und Ziel Rennerte- bring-81Industrie- (Fulda) Rauten- Haddenberg hausen hausen hausen Haar- hausen hof Bockendorf Bischhausen hausen Stolzenbach an den RMV angrenzenden Battenberg 8120 Dodenhausen Reptich Lispen- stufe 80 Wiesenfeld Dillich Braach hausen 8810 Dodenau (Eder) Battenfeld Burgwald Lispen- Sehlen 82 8401 Neuenhain Solz Herbelhausen Gilsa 84Zimmersrode hausen Bf Verkehrsverbünden. Bei der Fahrt Willers- Densberg Jesberg Neuental Braunhausen Berghofen hausen Grüsen Walters- Biebighausen Reddig- Ellnrode brück 8410 Imshausen Lehn- Schönstein -

Office Market Profile
Office Market Profile Frankfurt | 1st quarter 2020 Published in April 2020 Frankfurt Development of Main Indicators Low space take-up in the fi rst quarter Take-up in the fi rst quarter of 2020 was just 67,600 sqm, the fourth worst quarterly take-up result for more than 20 years. This was mainly due to the low deal overhang from the previous year, as the fourth quarter of 2019 was the third strongest quarter in the last ten years, and to the eff ects of the current coronavirus crisis. In contrast, the number of deals was comparatively high, since mainly medium and large-sized searches for space were post- poned. The vacancy rate rose slightly to 5.8% due to infrastructure; these investments will also have an impact numerous vacancies resulting from contracts signed in on space concepts in the medium and long-term. If the 2018 and 2019. Across the submarkets, prime and average catch-up eff ects come in the second half of the year, over- rents remained unchanged. In the current economic all performance in 2020 could remain strong, provided climate, owners and (existing) tenants are engaged in that there is enough time for deals to be concluded and intensive exchanges and solutions are being sought in that property owners do not put together too attractive the form of incentives, subletting or fl exible contractual lease extension packages. arrangements. In the short term, many companies will focus on creating or improving their remote working Frankfurt: Off ice Space Market Areas with Rental Bands (€/sqm/month) Frankfurt: Office Space Market Areas with Rental Bands (€/sqm/month) JLL Research 2020/Q1 Kalbach Oberhoechstadt/Ts. -

Werkphase 3 (1967-1984) – Situative Architektur
Werkphase 3 (1967-1984) Werkphase 3 (1967-1984) – Situative Architektur Vorbedingungen und zeitlicher Kontext Nach den vor allem an technischen Aspekten der Produktion orientierten Jahren begann mit den Schulen in Oppelsbohm 1966-1969 und Lorch 1970-1973 sowie vor allem mit den Anlagen für die Olympischen Spielen in München 1967-1972 ein neuer Abschnitt in Werk von Behnisch & Partner, der eine radikale Abkehr von den bis- herigen Grundzügen bedeutete. Die Auseinandersetzung mit politisch-gesellschaftlichen Werten und Entwick- lungen, neue Aufgaben als Architekturlehrer sowie die Auseinandersetzung mit seinen architektonischen Wurzeln führten Behnisch zu neuen, entscheidenden Erkenntnissen für das Bauen. Der Anfang dieser Phase war gekenn- zeichnet durch die Gleichzeitigkeit von mehreren Aufgaben und Ereignissen in den Jahren 1967 und 1968, die große Auswirkungen auf die weitere Entwicklung hatten. Die gesellschaftliche Aufbruchstimmung der späten 60er Jahre mündete in die Studentenbewegung des Jahres 1968 und beeinflusste nachhaltig das Denken und Handeln in der Gesellschaft. Auch architektonische Denk- und Ausdrucksweisen wurden dadurch geprägt. Die neben dem technisch-wirtschaftlichen Umbruch stattgefundene geistige Modernisierung der Gesellschaft ermöglichte ein Hinterfragen und eine Kritik am Ist-Zustand. Zudem zeigten gerade der Wettbewerb 1967 und die Planung 1967-1972 für die Anlagen der Olympischen Spiele in München diese neue gesellschaftliche Stimmung und die sich daraus entwickelnde neue Freiheit der Architektur- sprache. Die Arbeit für München hatte große Auswirkungen auf die Positionsbestimmung von Günter Behnisch als Architekt und bestimmte neue Grundzüge seiner späteren Arbeit mit. Als weiterer Bestandteil des Wende- punktes im Werk von Behnisch waren die neuen Aufgaben als Hochschullehrer im Jahre 1967 in der Nachfolge von Ernst Neufert an der TH Darmstadt auch Impulsgeber für die eigene Arbeit.