Hartmut Scherzer 60 Jahre Erlebnisse Einer Reporter-Legende
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

Das Wunder Von Bern (Version III-Gedicht) Von Reinhold Nisch
Das Wunder von Bern (Version III-Gedicht) von Reinhold Nisch - http://www.reinhold-nisch.de Das Wunder von Bern (Version III-Gedicht) Zum Tode von Ottmar Walter am 16.Juni 2013 1954. Das Land kriegszertrümmert. Manche Steine aus dem Wege geräumt. Trümmerfrauen allerorten. Manches Gegenüber nicht zurückgekehrt. Wiederaufbau zaghaft, dann beschleunigend. Gnade der späten Geburt noch nicht existent. Fernsehen massenhaft unerschwinglich. Ätherwellen populär, Kleinkneipen gefüllt bis zum Geht-nicht-mehr: "Jedes Kind braucht einen Vater. Jeder Mensch braucht einen Traum. Jedes Land braucht eine Legende." * Das Wunder von Bern. Wir sind wieder wer. Es geht wieder aufwärts mit ... page 1 / 5 Das Wunder von Bern (Version III-Gedicht) von Reinhold Nisch - http://www.reinhold-nisch.de Seppl Herberger, Fritz Walter, dem Gründungsvater, ** mit Helmut Rahn, Ottmar Walter, Horst Eckel, Werner Kohlmeyer, Werner Liebrich, Karl Mai, Max Morlock, Jupp Posipal, Hans Schäfer, Toni Turek ... mit Deutschland. Dem größeren wenigstens. Glaube der Kriegsgeneration. Und der Aufbaugeneration. Legendenhaft schön. Auch 2003. Eben fast fünfzigjährig. Noch mehr 2013. Fast sechzigjährig. page 2 / 5 Das Wunder von Bern (Version III-Gedicht) von Reinhold Nisch - http://www.reinhold-nisch.de page 3 / 5 Das Wunder von Bern (Version III-Gedicht) von Reinhold Nisch - http://www.reinhold-nisch.de Reinhold Nisch vgl. auch: www.daswundervonbern-derfilm.de * Die Leitsätze wurden dem gleichnamigen Film "Das Wunder von Bern" (Regie: Sönke Wortmann) entnommen. Dieser Kinofilm erhielt den Publikumspreis beim 56. Inter- nationalen Filmfestival Locarno. ** Der Publizist Joachim Fest "hat gesagt, es gibt drei Gründungsväter der Bundes- republik: Konrad Adenauer, Ludwig Erhard u n d Fritz Walter."(zitiert nach: Christof Siemes, Das Wunder von Bern, Köln (KiWi) 2003, S.276) Von der WM-Elf 1954 leben jetzt nur noch Hans Schäfer und der damalige "Benjamin" Horst Eckel. -

„WIR MÜSSEN WISSEN BÜNDELN UND VERTEILEN“ SPORTDIREKTOR ROBIN DUTT ÜBER ERWARTUNGEN, ERGEBNISSE UND RESPEKT VOR DEM EHRENAMT 1963 Bis Torfabrik
DAS OFFIZIELLE MAGAZIN DES DEUTSCHEN FUSSBALL-BUNDES | 03 2012 WWW.DFB.DE | WWW.FUSSBALL.DE | TEAM.DFB.DE | 5 EURO BLICKRICHTUNG BRASILIEN ALS GRUPPENERSTER GEHT DAS DFB-TEAM IN DIE PAUSE DER WM-QUALIFIKATION VORBILDLICHES VERHALTEN JULIUS-HIRSCH-PREISTRÄGER UND GEWINNER DER AKTION „FAIR IST MEHR“ GEEHRT „WIR MÜSSEN WISSEN BÜNDELN UND VERTEILEN“ SPORTDIREKTOR ROBIN DUTT ÜBER ERWARTUNGEN, ERGEBNISSE UND RESPEKT VOR DEM EHRENAMT 1963 bis torfabrik. der neue ball für die 50. bundesliga-saison. © 2012 adidas AG. adidas, the 3-Bars logo and 3-Stripes mark are registered trademarks of Group. ›› EDITORIAL Liebe Leserinnen und Leser, es ist die einzigartige Kraft des Fußballs, dass er die Menschen auf eine ganz besondere Weise emotionalisiert. Es gehört zu seiner Faszination, dass man leidenschaftlich über ihn diskutiert. Trotzdem lohnt sich manchmal ein Blick in die Statistik, um Sachlichkeit in eine Diskussion zu bringen. Vier Spiele, 15 Tore, zehn Punkte, Platz eins in der Gruppe. Auch so lässt sich die bis- herige WM-Qualifi kation unserer Nationalmannschaft zusammenfassen. Natürlich muss das schier unfassbare 4:4 gegen Schweden aufgearbeitet werden. Natür- lich müssen kritische Analysen erlaubt sein. Aber die Kritik muss sachlich bleiben. Die ersten 60 Minuten haben gezeigt, welch unglaublich großes Potenzial in dieser Mannschaft steckt. Sie haben auf begeisternde Weise deutlich gemacht, welch außergewöhnliche Talente wir haben. Spieler, um die uns international viele Verbände beneiden. Und sie haben gezeigt, dass unser Trainerteam mit diesem jungen Kader einen klaren Weg verfolgt. Einen Weg, der – trotz des kollektiven Einbruchs in der letzten halben Stunde – in die richtige Richtung geht. Es sind aber nicht nur die Ergebnisse, die im Fußball zählen. -

Goalden Times: December, 2011 Edition
GOALDEN TIMES 0 December, 2011 1 GOALDEN TIMES Declaration: The views and opinions expressed in this magazine are those of the authors of the respective articles and do not necessarily reflect the official policy or position of Goalden Times. All the logos and symbols of teams are the respective trademarks of the teams and national federations. The images are the sole property of the owners. However none of the materials published here can fully or partially be used without prior written permission from Goalden Times. If anyone finds any of the contents objectionable for any reasons, do reach out to us at [email protected]. We shall take necessary actions accordingly. Cover Illustration: Neena Majumdar & Srinwantu Dey Logo Design: Avik Kumar Maitra Design and Concepts: Tulika Das Website: www.goaldentimes.org Email: [email protected] Facebook: Goalden Times http://www.facebook.com/pages/GOALden-Times/160385524032953 Twitter: http://twitter.com/#!/goaldentimes December, 2011 GOALDEN TIMES 2 GT December 2011 Team P.S. Special Thanks to Tulika Das for her contribution in the Compile&Publish Process December, 2011 3 GOALDEN TIMES | Edition V | First Whistle …………5 Goalden Times is all set for the New Year Euro 2012 Group Preview …………7 Building up towards EURO 2012 in Poland-Ukraine, we review one group at a time, starting with Group A. Is the easiest group really 'easy'? ‘Glory’ – We, the Hunters …………18 The internet-based football forums treat them as pests. But does a glory hunter really have anything to be ashamed of? Hengul -

Österreichs Deutschland-Komplex. Paradoxien in Der Österreichisch- Deutschen Fußballmythologie
1 Österreichs Deutschland-Komplex. Paradoxien in der österreichisch- deutschen Fußballmythologie. Abbildung 1. Das so genannte „Anschluss“-Spiel zwischen der „Deutschen Nationalmannschaft“ und der „Deutschösterreichischen Mannschaft“ am 12. März 1938 im Wiener Praterstadion: Mathias Sindelar (rechts) und der deutsche Mannschaftskapitän Reinhold Münzenberg beim Shakehands vor dem Spiel – in der Mitte der Berliner Unparteiische Alfred Birlem, der damals prominenteste deutsche Schiedsrichter. 2 Prolog Als Struktur und Inhalte der vorliegenden Arbeit sich erstmals – im Zuge der Recherchen und nach Fertigstellung meiner Diplomarbeit1 – abzuzeichnen begannen, war von einer „EURO 2008“ noch keine Rede. Das Thema meiner Dissertation wurde mehr als ein Jahr, bevor das Los wieder einmal Österreich und Deutschland zu Gegnern gemacht hatte, eingereicht. Angesichts des Medien-Hype, zahlreicher Neuerscheinungen der Fußball-Literatur und des Veranstaltungs-Booms im Soge der Fußball-Europameisterschaft während der Fertigstellung dieser Dissertation scheint mir diese Anmerkung besonders wichtig. Der bundesdeutsche Boulevard ließ angesichts der Neuauflage des österreichisch-deutschen Duells Ende 2007 die Gelegenheit nicht aus, sofort wieder zu sticheln und die Stimmung rechtzeitig aufzuheizen. „Wir leihen euch unsere B-Elf“, lautete der „Bild“-Vorschlag gegen den „Ösi-Jammer“. Prompt begab sich die Tageszeitung „Österreich“ auf dieselbe Stufe und titelte, auf die aktuelle Krise im deutschen Skispringerlager anspielend, höhnisch: „Wir leihen euch unsere -

Die 50Er Jahre in Lippe
MUSIKHERBST AM WILDEN KAISER – 5 TAGE 25.09.19 – 29.09.19 Der Komfort in unseren Bussen: 1. Tag: Anreise 2. Tag: Achensee Schifffahrt, „Großer Ahornboden“ 3. Tag: Bergbahnfahrt, > 90 cm Sitzabstand, Frühshoppen am Berg und großer „Kaiser- Kopflehne individuell anpassbar. abend“ 4. Tag: Großer Bauernmarkt im Ellmau und großer Preis p. P. im DZ r 498,00 Starabend Die Sitzplätze punkten mit Komfortkopf- und EZ-Zuschlag r 52,00 5. Tag: Heimreise Fußstützen die individuell einstellbar sind, Wir begrüßen den Herbst in einer im- voll dekorierten und beheizten Festzelt oder Hotel in Tirol. Mit gewohnter Tiro- posanten Bergkulisse mit den Topstars singen und tanzen wir zu den Klängen ler Gastfreundlichkeit genießen Sie hier ausklappbaren Tischen an den Vordersitzen und der Volks- und Schlagermusik. Der Mu- von u.a. Semino Rossi, Andy Borg, Han- einen einmaligen Aufenthalt. sikherbst am Wilden Kaiser ist eines si Hinterseer, Roland Kaiser, Maite Kel- verstellbaren Beinablagen. der erfolgreichsten Volksmusikfeste im ly, DJ Ötzi. Am 3. Abend erwartet Sie Leistungen: Fahrt in einem mod. Lu- Alpenraum. Auch in diesem Jahre wer- noch ein Überraschungsgast. Seien sie xus-Reisebus, Frühstück im Bus, 4 x den wieder tausende von begeisterten gespannt! Übern. in der Region der Kitzbühler Al- Komfortabel in die Welt hinaus … mit Auto Gaus! Gästen anreisen um an diesem beson- Ihr Hotel: Ihre Unterbringung erfolgt pen, 4 x Halbpension, 3 x Eintritt im deren Ereignis teilzunehmen. Im liebe- in einem komfortablen 3* Gasthof Festzelt mit reserv. Sitzplätzen u. v. m. Samstag/Sonntag, 13./14. Juli 2019 28. Woche Nr. 160 25145101_800119 19704001_800119 DasWundervonBern:Am5.Juli1954stehtdiedeutscheFußball-Na- tionalelf mit (Bild oben von links) Fritz Walter, Toni Turek, Horst Eckel, Helmut Rahn, Ottmar Walter, Werner Liebrich, Jupp Posi- pal, Hans Schäfer, Werner Kohlmeyer, Karl Mai und Max Morlock im Finale der Weltmeisterschaft gegen Ungarn. -

K227 Description.Indd
AGON SportsWorld 1 51st Auction AGON SportsWorld 2 51st Auction AGON SportsWorld 3 51st Auction 51st AGON Sportsmemorabilia Auction 6th - 7th December 2013 Contents SPORTSWORLD 6th December 2013 Lots 1 - 412 Olympic Autographs 6 Other Sports 8 7th December 2013 Lots 413- 1243 Football Hightlights 50 Football World Cup 55 Football in general 71 German Football 76 International Football 82 Football Autographs 98 Olympics 110 The essentials in a few words: - all prices are estimates - they do not include value-added tax; 7% VAT will be additionally charged with the invoice. - if you cannot attend the public auction, you may send us a written order for your bidding. - in case of written bids the award occurs in an optimal way. For example:estimate price for the lot is 100,- €. You bid 120,- €. a) you are the only bidder. You obtain the lot for 100,-€. b) Someone else bids 100,- €. You obtain the lot for 110,- €. c) Someone else bids 130,- €. You lose. - In special cases and according to an agreement with the auctioneer you may bid by telephone during the auction. (English and French telephone service is availab- le). - The price called out ie. your bid is the award price without fee and VAT. - The auction fee amounts to 15%. - The total price is composed as follows: award price + 15% fee = subtotal + 7% VAT = total price. - The items can be paid and taken immediately after the auction. Successful orders by phone or letter will be delivered by mail (if no other arrange- ment has been made). In this case post and package is payable by the bidder. -

K232 Description.Indd
AUCAGON SportsWorld TION_531 53rd Auction 30-31 05 2014 Big Live-Auction Kassel Germany Football Olympic Games AGON_SportsWorld 0049 (0)561 - 927 98 27 www.agon-auction.de AGON SportsWorld 2 53rd Auction 53rd AGON Sportsmemorabilia Auction 30th - 31st May 2014 Contents 30th May 2014 Lots 1 - 680 Olympics 6 Other Sports 76 31st May 2014 Lots 681 - 1484 Football Highlights 88 Football World Cup 107 Football in general 134 German Football 148 International Football 160 Football Autographs 176 The essentials in a few words: - all prices are estimates - they do not include value-added tax; 7% VAT will be additionally charged with the invoice. - if you cannot attend the public auction, you may send us a written order for your bidding. - in case of written bids the award occurs in an optimal way. For example:estimate price for the lot is 100,- €. You bid 120,- €. a) you are the only bidder. You obtain the lot for 100,-€. b) Someone else bids 100,- €. You obtain the lot for 110,- €. c) Someone else bids 130,- €. You lose. - In special cases and according to an agreement with the auctioneer you may bid by telephone during the auction. (English and French telephone service is availab- le). - The price called out ie. your bid is the award price without fee and VAT. - The auction fee amounts to 15%. - The total price is composed as follows: award price + 15% fee = subtotal + 7% VAT = total price. - The items can be paid and taken immediately after the auction. Successful orders by phone or letter will be delivered by mail (if no other arrange- ment has been made). -

Dieser Cup Macht Lust Auf Mehr! 2 CDN-NEWSLETTER 20/2014
No. 20/2014 Dieser Cup macht Lust auf mehr! 2 CDN-NEWSLETTER 20/2014 EDITORIAL Ganz oben: Weltmeister Die WM, die Elfmeter Manuel Neuer ist Deutschlands und wir: eiskalt am Punkt, Von Wolfgang Niersbach „Fußballer des Jahres“ // ganz cool auf der Linie // Lehmann: „Seine besten „Bärentöter“ beim Danke Philipp, danke Jahre kommen noch“ 15 Goldenen Schuss 23 Miro, danke „Merte“! 04 AKTUELL IM BLICKPUNKT DER WM-TITEL 2014 UND DIE FOLGEN Dieser Cup macht Lust auf mehr! // Bilderbogen 06 Die deutschen Journalisten 7. Jahrestreffen wählten Joachim Löw des „Clubs der National- zum „Trainer des Jahres“ // spieler“ am 14. Oktober „Das macht uns in Gelsenkirchen // alle stolz“ 17 Viele gute Gründe zum Wiedersehen Lahm, Klose, Mertesacker „Auf Schalke“ 26 und ihr emotionaler Abschied von der Nationalmannschaft // „Danke für alles! Wir werden euch vermissen“ 18 Hans Schäfer – der älteste Weltmeister und „Held von Bern“ über die Zukunft des WM-Titelträgers // 2018 den 5. Stern vom Himmel holen 08 Warum ein Bundestrainer auch ohne große Spieler- Karriere ein Siegertyp sein kann // Joachim Löw oder: das nächste Stück zum großen Glück 11 3 VOR 50 JAHREN AKTUELL IM BLICKPUNKT Altkanzler Kohl mit Eckel in Herberger-Austellung 42 Was der begeisternde Regionale CdN-Doppel- Medaillengewinn 1964 für den veranstaltung in Fußball der DDR bedeutete // Düsseldorf und Dort- Mehr Freiheit mund mit hochkarätiger dank Bronze 28 Besetzung // Mit den Besten im Westen 36 Die Besten im Westen // Bilderbogen 38 Rahns und Schweinsteigers Schuhe im Fußballmuseum 43 Weltmeister-Team -
Projekt 2014! Inhalt | 3
Das Ausstellungskonzept | Multimedial, überraschend und innovativ Die Projektgesellschaft | DFB und Stadt Dortmund verbindet eine Vision Das Exponat | Fußballmuseum erhält Weltmeister-Trikot von 1954 Ausgabe 1 Dezember 2010 MAGAZIN DES DFB-FUSSBALLMUSEUMS PROJEKT2014! Das DFB-Fußballmuseum soll ab 2014 in Dortmund begeistern www.dfb-fussballmuseum.de 2 | PROJEKT 2014! INHALT | 3 | EDITORIAL „Die Vision im Auge“ _________________________________ 4 | THEMA Ausstellungskonzept___________________________________ 6 Mit einem innovativen, attraktiven Ausstellungs- WIR SIND FUSSBALL: format will das DFB-Fußballmuseum begeistern Das DFB-Fußballmuseum richtet sich und überraschen. an ein breites Publikum. Leitbild____________________________________________________________ 14 Seite 6 Seite 14 | STICHWORTE Namen & Fakten__________________________________________ 16 | DIE STIFTUNG Projektgesellschaft ____________________________________ 20 Mitten in der Dortmunder Innenstadt DFB, Stadt Dortmund und die Stiftung werben deutsche Fußball-Legenden für DFB-Fußballmuseum realisieren bis 2014 das einzigartige Projekt. ein gemeinsames Leuchtturmprojekt. Projektentwicklung ____________________________________ 22 Seite 16 Seite 20 | DIE SAMMLUNG Exponat___________________________________________________________ 24 | MEDIEN Herausragendes Objekt in der Sammlung: Schon jetzt berichten die Medien umfassend Resonanzanalyse_________________________________________ 30 Das Original-Trikot von Karl Mai aus dem über die Planungen – die Auswertung liefert WM-Endspiel -

„Fußball Ist Niemals Nur Ein Spiel”
11th International Conference of J. Selye University Section on Language – Culture – Intercultural Relationships https://doi.org/10.36007/3310.2019.47-62 „FUßBALL IST NIEMALS NUR EIN SPIEL” Alice EGED1 ABSTRACT The Hungarian national football team, the Golden Team arrived at the Swiss World Cup in 1954 as the highest potential team and a medal worthy of their reputation was expected from them all over the world. Leading up to the final, everything went as expected, however, something happened that the football fans least expected: Germany defeated Hungary 3-2, thus the German Federal Republic became the world champion for the first time. The significance of the victory reached far beyond the framework of a football match. In the Germans, it evoked the feeling of „we-are-somebody-again” and it restored the self-esteem of a nation that was ashamed. Many people look upon the Bern final as a far more significant event than the ratification of the Fundamental Law, the post-war currency reform or the fall of the Berlin Wall. For them, the real date of the foundation of the German Federal Republic is 1954. KEYWORDS 1954 FIFA World Cup, Bern, German football team, post-war period 1. EINLEITUNG: SO EIN SIEG BLEIBT IN ERINNERUNG Die ungarische Nationalmannschaft, fuhr 1954 als die Mannschaft mit den höchsten Siegeschancen zur Weltmeisterschaft in die Schweiz. Von der Goldenen Elf erwartete man weltweit die ihrem Namen gebührende Medaille. Bis hin zum Endspiel verlief alles wie gehabt, doch dann geschah das, womit wohl kaum ein Fußballanhänger gerechnet hatte. Am 4. Juli besiegte die von Bundestrainer Sepp Herberger vorbereitete deutsche Nationalelf unter der Leitung ihres Mannschaftskapitäns Fritz Walter die ungarische Mannschaft mit einem 3:2. -
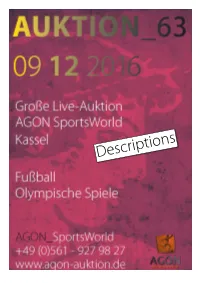
K257 Description.Indd
AGON SportsWorld 1 63 rd Auction Descriptions AGON SportsWorld 2 63 rd Auction 63 rd AGON Sportsmemorabilia Auction 9th December 2016 Contents 9th December 2016 Lots 1 - 899 Football World Cup 4 German match worn shirts 31 Football in general 42 German Football 42 International Football 48 International match worn shirts 58 Football Autographs 68 Olympics 84 Olympic Autographs 123 Other Sports 126 The essentials in a few words: Bidsheet extra sheet - all prices are estimates - they do not include value-added tax; 7% VAT will be additionally charged with the invoice. - if you cannot attend the public auction, you may send us a written order for your bidding. - in case of written bids the award occurs in an optimal way. For example:estimate price for the lot is 100,- €. You bid 120,- €. a) you are the only bidder. You obtain the lot for 100,-€. b) Someone else bids 100,- €. You obtain the lot for 110,- €. c) Someone else bids 130,- €. You lose. - In special cases and according to an agreement with the auctioneer you may bid by telephone during the auction. (English and French telephone service is availab- le). - The price called out ie. your bid is the award price without fee and VAT. - The auction fee amounts to 15%. - The total price is composed as follows: award price + 15% fee = subtotal + 7% VAT = total price. - The items can be paid and taken immediately after the auction. Successful orders by phone or letter will be delivered by mail (if no other arrange- ment has been made). In this case post and package is payable by the bidder. -

Kevin Kuranyi, Schalke 04 „Fußball Ist Mein Leben, Ich Habe Als Kind Schon Alles Dafür Gegeben“
INHALT MD/GaW/d-d/0206 Messe Düsseldorf: Offizieller Co Partner der deutschen Olympiamannschaften Salt Lake City, Athen, Turin, Peking 8 Unsere Leit- und Spezialmessen sind maßgeschneiderte Plattformen für erfolgreiche Geschäfte. Die Schwerpunkte: 20 Inhalt Gastfreundschaft ›› Maschinen, Anlagen und Ausrüstungen Handel, Handwerk und 3 Editorial - Die Reise nach Jerusalem weltweit Dienstleistungen Wintersport-Special 8 Wintersportland NRW Medizin und Gesundheit 11 Backside 720 grab tail Mode und Lifestyle 14 Ski und Rodel gut Freizeit 16 Der „Rheinische Gletscher“ 18 Der größte Coktail des Ruhrgebiets Insgesamt organisieren wir über 40 Messen in Düsseldorf, 20 Ein märchenhaftes Winter-Wunderland - Biathlon AufSchalke davon sind über 20 die Nr. 1 24 Wintersport-Mekka Düsseldorf ihrer Branche. Darüber hinaus 32 26 DEL - Die Halbzeit-Bilanz der NRW-Vereine führen wir rund 100 weitere 28 Glanz und Arbeit Veranstaltungen weltweit durch. Fußball-Special 30 Bundesliga - Eine NRW-Zwischenbilanz Wir sind da, wo Sie uns brauchen – 32 Die glorreichen Sieben - Teil 2 - die Stürmer überall auf der Welt. 36 Borussia Mönchengladbach - Oliver Neuville 40 FC Schalke 04 - Kevin Kuranyi 44 1. FC Köln - Lukas Podolski 46 Bayer 04 Leverkusen - Andrej Voronin 48 MSV Duisburg - Markus Kurth 50 Arminia Bielefeld - Isaac Boakye 70 52 BVB Borussia Dortmund - Ebi Smolarek 54 Nicht nur Fußball im Sinn 55 Mit Schneeball-Prinzip zum Fanclub 56 Bayer 04-Club - auch „auswärts“ ein Treffer 58 WM 1954 - „Rahn schießt... Tooor! Tooor! Tooor! Tooor!“ 62 WM-Heroes - Die Stars des 1. FC Köln 66 Top-Teams unter dem Bayer-Kreuz Succeed with us all over the world ›› 70 Abtauchen in die Welt der Kugeln 72 „Geil, geil, geil“-Gekreische um einen Gebiss-Chirurgs-Kandidaten 74 Die Basketball-Magier 76 Formel1 - Die Leiden des jungen F.