Iuppiter Dolichenus
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

Siegfried Found: Decoding the Nibelungen Period
1 Gunnar Heinsohn (Gdańsk, February 2018) SIEGFRIED FOUND: DECODING THE NIBELUNGEN PERIOD CONTENTS I Was Emperor VICTORINUS the historical model for SIEGFRIED of the Nibelungen Saga? 2 II Siegfried the Dragon Slayer and the Dragon Legion of Victorinus 12 III Time of the Nibelungen. How many migration periods occurred in the 1st millennium? Who was Clovis, first King of France? 20 IV Results 34 V Bibliography 40 Acknowledgements 41 VICTORINUS (coin portrait) 2 I Was Emperor VICTORINUS the historical model for SIEGFRIED of the Nibelungen Saga? The mythical figure of Siegfried from Xanten (Colonia Ulpia Traiana), the greatest hero of the Germanic and Nordic sagas, is based on the real Gallic emperor Victorinus (meaning “the victorious”), whose name can be translated into Siegfried (Sigurd etc.), which means “victorious” in German and the Scandinavian languages. The reign of Victorinus is conventionally dated 269-271 AD. He is one of the leaders of the so-called Gallic Empire (Imperium Galliarum; 260-274 AD), mostly known from Historia Augusta (Thayer 2018), Epitome de Caesaribus of Aurelius Victor (Banchich 2009), and the Breviarum of Eutropius (Watson 1886). The capital city of this empire was Cologne, 80 km south of Xanten. Trier and Lyon were additional administrative centers. This sub-kingdom tried to defend the western part of the Roman Empire against invaders who were taking advantage of the so-called Crisis of the Third Century, which mysteriously lasted exactly 50 years (234 to 284 AD). Yet, the Gallic Empire also had separatist tendencies and sought to become independent from Rome. The bold claim of Victorinus = Siegfried was put forward, in 1841, by A. -

Xantener Berichte 23
XANTENER BERICHTE Band 23 XANTENER BERICHTE LEGIO XXX ULPIA VICTRIX Grabung – Forschung – Präsentation Ihre Geschichte, ihre Soldaten, ihre Denkmäler herausgegeben von Martin Müller Marcus Reuter E ine Veröffentlichung des Landschaftsverbandes Rheinland LV R-Archäologischer Park Xanten / LVR-RömerMuseum VERLAG PHILIPP VoN ZABERN LEGIO XXX ULPIA VICTRIX Ihre Geschichte, ihre Soldaten, ihre Denkmäler Marcus Reuter VERLAG PHILIPP VON ZABERN Bibliografische Informationen der Deutschen Bibliothek Die Deutsche Bibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über <http://dnb.ddb.de> abrufbar. ISBN 978-3-8053-4586-6 LVR-Archäologischer Park Xanten LVR-RömerMuseum Alle Rechte vorbehalten Copyright Landschaftsverband Rheinland LVR-Archäologischer Park Xanten / LVR-RömerMuseum 2012 Redaktion: Linden Soft Verlag e. K., Aichwald Satz: www.comlay.de Druck: B.o.s.s Druck und Medien, Goch Printed in Germany Print kompensiert Id-Nr. 1113222 www.bvdm-online.de VRE LAG PHILIPP VON ZABERN · DARMSTADT / MAINZ I nhalt Vorwort des Herausgebers • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • VII Vorwort • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • IX Danksagung • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • X Einleitung – Die römischen Legionen und die legio XXX Ulpia victrix als Forschungsgegenstand • • 1 1 Geschichte • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 5 1.1 Die Gründung der Legion unter Traian -

A Note on the Terminology: I Use “Brick” to Refer to Flat Building Units
Cambridge University Press 978-1-107-05935-1 - Innovative Vaulting in the Architecture of the Roman Empire: 1st to 4th Centuries CE Lynne C. Lancaster Index More information INDEX A note on the terminology: I use “brick” to refer to flat building units for walls and vaults, whereas I use “tile” to refer to items that have more complex forms, such as roof tiles and box-tiles (the distinction is not appropriate for all contexts, e.g. a “tile maker” can also make bricks). For place names, I have used the name that is most common, regardless of whether it is modern or ancient, but some cross references to alternative designations are provided. The monuments and places in the Web Catalogs and the Web Figures are not included in this index. Numbers in bold indicate pages with illustrations. ACoruna,˜ Spain, 175 Angmering, Britain (bath), 134, 136–37, Archimedes, 127, 181, 202 Aelius Aristides, 87 136, 137, 138, 142, 145 architect, 9, 10, 65, 110, 192 Aemilius Macer, 8 annona, 94, 112, 113, 196, 200 Amenhotep, son of Hapu, 49 Aeolian Islands (pumice), 31 annona militaris, 176 Menophilos, 11, 97 Aesica. See Great Chesters anthrocological (charcoal) studies, 197–98 Aretas IV, Nabatean king, 79 African Red Slip, 113, 127, 197. See also Antiochia in Pisidia, Turkey (bath), 34, Argos, Greece, 52, 69 pottery industry 35 “Serapeum”. See cult complex (Theater Agricola, 6 Antoninus Pius, 50 Baths) agricultural production, 127, 173, 176 Aphrodisias, Turkey agora drains, 52, 55 importance for construction technology, Flavian Basilica, 43 aqueducts, 52, 54, 210n66 112–13 individuals at Bath A. -
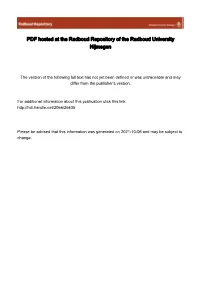
PDF Hosted at the Radboud Repository of the Radboud University Nijmegen
PDF hosted at the Radboud Repository of the Radboud University Nijmegen The version of the following full text has not yet been defined or was untraceable and may differ from the publisher's version. For additional information about this publication click this link. http://hdl.handle.net/2066/26435 Please be advised that this information was generated on 2021-10-06 and may be subject to change. ROMEINSE TROEPEN IN NIJMEGEN DOOR J.K. HAALEBOS De militaire geschiedenis van Nijmegen in de eerste twee eeuwen na Chr. is gecom pliceerd. De functie en de sterkte van de daar gelegerde troepen hebben gewisseld. In de midden-Augusteïsche tijd speelde de Hunerberg een rol in het offensief van Drusus (12-9 voor Chr.). Later zijn op het Kops Plateau en bij het Trajanusplein kleinere garnizoenen gelegerd die slechts beperkte taken kunnen hebben vervuld. Na de opstand der Bataven werd weer een legioen op de Hunerberg gestationeerd ter bewaking van de opnieuw onder Romeins gezag gebrachte bewoners van het Neder-Rijn-gebied. Het terrein bleef tot in de tweede helft van de 2e eeuw door kleinere afdelingen Romeinse troepen bezet. Sinds de stimulerende in 1967 verschenen studie van J.E. Bogaers over dit onderwerp is de samenstelling van de Nijmeegse garnizoenen niet meer uitvoerig besproken.1 Nieuwe epigrafische gegevens, gewijzigde inzichten in de structuur en het functioneren van het Romeinse leger en de toegenoinen kennis van de archeo logische overblijfselen maken een nieuw overzicht van de in Nijmegen gelegerde troepen gewenst. De voor-Flavische troepen Inleiding Onze kennis over de troepen die in de Julisch-Claudische tijd in Nijmegen gelegerd zijn geweest, is beperkt. -

Timeline1800 18001600
TIMELINE1800 18001600 Date York Date Britain Date Rest of World 8000BCE Sharpened stone heads used as axes, spears and arrows. 7000BCE Walls in Jericho built. 6100BCE North Atlantic Ocean – Tsunami. 6000BCE Dry farming developed in Mesopotamian hills. - 4000BCE Tigris-Euphrates planes colonized. - 3000BCE Farming communities spread from south-east to northwest Europe. 5000BCE 4000BCE 3900BCE 3800BCE 3760BCE Dynastic conflicts in Upper and Lower Egypt. The first metal tools commonly used in agriculture (rakes, digging blades and ploughs) used as weapons by slaves and peasant ‘infantry’ – first mass usage of expendable foot soldiers. 3700BCE 3600BCE © PastSearch2012 - T i m e l i n e Page 1 Date York Date Britain Date Rest of World 3500BCE King Menes the Fighter is victorious in Nile conflicts, establishes ruling dynasties. Blast furnace used for smelting bronze used in Bohemia. Sumerian civilization developed in south-east of Tigris-Euphrates river area, Akkadian civilization developed in north-west area – continual warfare. 3400BCE 3300BCE 3200BCE 3100BCE 3000BCE Bronze Age begins in Greece and China. Egyptian military civilization developed. Composite re-curved bows being used. In Mesopotamia, helmets made of copper-arsenic bronze with padded linings. Gilgamesh, king of Uruk, first to use iron for weapons. Sage Kings in China refine use of bamboo weaponry. 2900BCE 2800BCE Sumer city-states unite for first time. 2700BCE Palestine invaded and occupied by Egyptian infantry and cavalry after Palestinian attacks on trade caravans in Sinai. 2600BCE 2500BCE Harrapan civilization developed in Indian valley. Copper, used for mace heads, found in Mesopotamia, Syria, Palestine and Egypt. Sumerians make helmets, spearheads and axe blades from bronze. -

Cults and Religious Integration in the Roman Cities of the Drava Valley (Southern Pannonia)
CULTS AND RELIGIOUS INTEGRATION IN THE ROMAN CITIES OF THE DRAVA VALLEY (SOUTHERN PANNONIA) BY BLANKA MIŠIĆ A DISSERTATION SUBMITTED FOR THE DEGREE OF DOCTOR OF PHILOSOPHY DEPARTMENT OF CLASSICS AND PHILOSOPHY ROYAL HOLLOWAY UNIVERSITY OF LONDON JANUARY 2013 1 DECLARATION OF AUTORSHIP I, Blanka Mišić, hereby declare that this thesis and the work presented in it is entirely my own. Signed: ______________________ Dated: _______________________ 2 For my dearest parents. 3 ABSTRACT This work is a detailed examination of pagan cults and deities in three settlements along the Pannonian section of the Drava river (Aquae Iasae – modern Varaždinske Toplice; Iovia- Botivo – modern Ludbreg; and Mursa – modern Osijek) situated within the present-day territory of Croatia. The evidence examined consists primarily of inscribed votive dedications in stone, dating from the Roman conquest of Pannonia to the late third century A.D. Evidence is examined within the theoretical framework of cultural change, taking into account recent theoretical developments in the concepts of “Romanisation”, acculturation, identity- expression and syncretisation in order to determine the extent of cultural and religious integration along the Drava. A thorough examination of evidence reveals the emergence of differing and flexible religious identities specific to each settlement although united by the larger prevailing trend of nature-divinity worship. Our Drava evidence also reveals that economic, social, political and geographic factors all produced an impact on the process and extent of cultural and religious integration, thus helping to form local, regional, provincial and imperial expressions of identity(ies). 4 TABLE OF CONTENTS 1. LIST OF ILLUSTRATIONS AND MAPS………………………………………......07 2. -

And the Material Culture of the Late 3Rd Century
The theory of ‘Limesfall’ and the material culture of the late 3rd century By Stijn Heeren Keywords: Late Roman period / fall of the Limes / Lower Rhine / Obergermanisch-Raeti- scher limes / Niederbieber horizon / pottery / brooches Schlagwörter: spätrömische Zeit / Limesfall / Niederrhein / Obergermanisch-Raetischer Limes / Niederbieber-Horizont / Keramik / Fibeln Mots-clés : époque romaine tardive / chute du limes / Bas-Rhin / Obergermanisch-Raeti- scher limes / horizon Niederbieber / céramique / fibules Introduction In many historical and archaeological studies concerning the decline of Roman power in the 3rd century, the ‘Limesfall’ is addressed, either explicitly or implicitly. With the term ‘Limesfall’ the destruction of limes forts by barbarian raiders between AD 259/260 and 275 and the subsequent abandonment of settlements in the hinterland of the limes is meant. The traditional opinion is that most of the forts and cities were never inhabited again. This idea has shaped the basic chronology of provincial-Roman archaeology: the transition of the Middle to the Late Roman period is set at ca. 260 and many items of material culture in the so-called Niederbieber horizon are dated to the period 190−260. New archaeological analysis shows that this presentation of past events is an oversimpli- fication: for several stretches of the limes there is no proof for destruction and subsequent abandonment at all, and evidence to the contrary, a continued occupation of several cas- tella, is available. This has far-reaching consequences for the chronology of the material culture of the late 3rd century and our dating of the Middle to Late Roman transition. In this article it will be argued that a ‘Limesfall’ never took place along the Lower Rhine and only partially at the Obergermanisch-Raetische limes. -
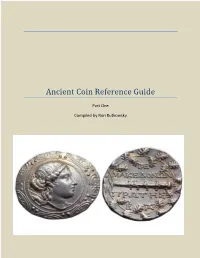
Ancient Coin Reference Guide
Ancient Coin Reference Guide Part One Compiled by Ron Rutkowsky When I first began collecting ancient coins I started to put together a guide which would help me to identify them and to learn more about their history. Over the years this has developed into several notebooks filled with what I felt would be useful information. My plan now is to make all this information available to other collectors of ancient coinage. I cannot claim any credit for this information; it has all come from many sources including the internet. Throughout this reference I use the old era terms of BC (Before Christ) and AD (Anno Domni, year of our Lord) rather than the more politically correct BCE (Before the Christian era) and CE (Christian era). Rome With most collections, there must be a starting point. Mine was with Roman coinage. The history of Rome is a subject that we all learned about in school. From Julius Caesar, Marc Anthony, to Constantine the Great and the fall of the empire in the late 5th century AD. Rome first came into being around the year 753 BC, when it was ruled under noble families that descended from the Etruscans. During those early days, it was ruled by kings. Later the Republic ruled by a Senate headed by a Consul whose term of office was one year replaced the kingdom. The Senate lasted until Julius Caesar took over as a dictator in 47 BC and was murdered on March 15, 44 BC. I will skip over the years until 27 BC when Octavian (Augustus) ended the Republic and the Roman Empire was formed making him the first emperor. -
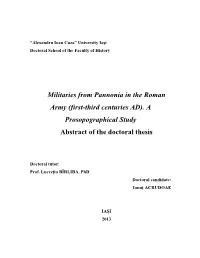
Militaries from Pannonia in the Roman Army (First-Third Centuries AD)
“Alexandru Ioan Cuza” University Iaşi Doctoral School of the Faculty of History Militaries from Pannonia in the Roman Army (first-third centuries AD). A Prosopographical Study Abstract of the doctoral thesis Doctoral tutor: Prof. Lucreţiu BÎRLIBA, PhD Doctoral candidate: Ionuţ ACRUDOAE IAŞI 2013 CONTENTS ACKNOWLEDGMENTS ................................................................................... 5 ABBREVIATIONS............................................................................................... 6 INTRODUCTION................................................................................................ 8 I. REFERENCE POINTS ON THE POLITICAL AND MILITARY HISTORY OF PANNONIA DURING THE PRINCIPATE...................................... 19 II. MILITARIES FROM PANNONIA IN THE LEGIONS OF THE ROMAN ARMY.............................................................................................................. 31 1. THE LEGIONS IN THE ROMAN EMPIRE: BRIEF HISTORY AND STRUCTURE................................................................................................................... 31 2. PROSOPOGRAPHY OF THE MILITARIES FROM PANNONIA IN THE LEGIONS OF THE ROMAN ARMY ............................................................................ 37 LEGIO I ADIUTRIX .......................................................................................... 37 LEGIO I MINERVIA ......................................................................................... 49 LEGIO II ADIUTRIX ........................................................................................ -

Die Inschriften Vom Thermenterrain Mit Fotos Definitiv
Lateinische Inschriften vom Thermengelände in Heerlen Joes Minis MA Prof. Dr Stefan Schorn Heerderweg 90n KU Leuven 6224 LH Onderzoeksgroep Geschiedenis: Oudheid Maastricht (Nederland) Blijde Inkomststraat 21, bus 3307 [email protected] 3000 Leuven (België) [email protected] Im Auftrag des Thermenmuseums Heerlen 2019 © des Textes Joes Minis und Stefan Schorn Inhalt Einleitung ................................................................................................................................... 3 Nr. 1: Bauinschrift? .................................................................................................................... 4 Nr. 2: Weihinschrift des M. Sattonius Iucundus ........................................................................ 8 Nr. 3: Weihaltar für Fortuna ..................................................................................................... 18 Nr. 4: Weihaltar ........................................................................................................................ 22 Nr. 5: Grabinschrift .................................................................................................................. 24 Nr. 6: unbestimmbares Fragment ............................................................................................. 30 Nr. 7: Graffito auf Panzerbeschlag ........................................................................................... 31 Nr. 8 a-e: Ziegelstempel der legio XXX Ulpia Victrix ............................................................. -
Batavi in the Roman Army of the Principate
Bonner Jahrbücher 218, 2018, S. 53–80 Ton Derks and Hans Teitler Batavi in the Roman Army of the Principate An Inventory of the Sources The purpose of this paper is to present a new comprehensive overview of the sources that are presently available for a history of Batavi in the Roman army. Previous scholar- ship often dealt only with certain specific units in which Batavians served (the imperial bodyguard, for example, or the cavalry regiments), or exclusively treated either the historical or the epigraphic sources. Andrew Fear’s recent article on the Batavi in the Roman army during the Principate in Yann Le Bohec’s Encyclopedia of the Roman Army is too short to cover all the issues treated here1. It is predicated on a choice of the epigraphical evidence2, and its review of the units in which Batavi served is only based on selected documents. Other more embracing studies are outdated. In this respect, new discoveries of inscriptions on stone as well as of military diplomas should be mentioned, which make it »worthwhile to re- visit and to retest hypotheses to see if modifications are needed to earlier conclusions«3. Therefore a more lengthy treatment of the available sources seems justified, pace what Spaul wrote in 2000: »More than enough has been written about the Batavians«4. This paper focuses on the Batavian auxilia as well as on individual Batavian soldiers, who served either in regiments which were named after their tribe or in other units of the Roman army, including the imperial bodyguard. The personal biographies of these individual Batavian soldiers, fragments of which we encounter in inscriptions, were strongly linked up with the history of the units they served in and the strategies of the In this article we do not deal with all the units of Handbook of Roman Epigraphy (Oxford 2015) the Roman army in which we find Batavi. -

Legio Ii Traiana Fortis and Judaea Under Hadrian's Reign
LEGIO II TRAIANA FORTIS AND JUDAEA UNDER HADRIAN’S REIGN Radu Urloiu∗∗∗ [email protected] Abstract: This paper is dedicated to a controversial issue with regard to both the history of the legio II Traiana Fortis and the history of Judaea, that are tightly connected. Attested for the first time in Judaea in 119/120 A.D., legio II Traiana is left without any base prior to this date. Its presence in Judaea proves this province had been raised to consular rank the latest by this date. We advance a theory previously proposed by the german scholar Werner Eck that is the transfer of the legio II Traiana in Judaea since 107/8 A.D. Therefore we assume Judaea had been given consular rank in the aftermath of Trajan’s Dacian War and the annexation of the Nabataean Kingdom. keywords: Caparcotna, consularis, legio II Traiana, legio XXII Deiotariana, procurator, vexillatio. Despite the increasing number of epigraphic and papyrological documents on legio II Traiana , the data offered by these sources did not provide new information on the history of the legion. In these circumstances, all we are left to do is to try to reconstruct by the the documentation we have the picture of the distribution of the Roman legions in the East during Trajan’s and Hadrian’s reign. The history of the legio II Traiana in its first two decades of existence is closely intertwined with that of the province of Judaea. As a imperial province of praetorian rank, in which only one legion stationed i. e. X Fretensis , Judaea became a province of consular rank.