Xantener Berichte 23
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

The Roman Army in the Third Century Ad Lukas De Blois My Issue In
INTEGRATION OR DISINTEGRATION? THE ROMAN ARMY IN THE THIRD CENTURY A.D. Lukas de Blois My issue in this paper is: what was the main trend within the Roman military forces in the third century ad? Integration, or disintegration into regional entities? This paper is not about cultural integration of ethnic groups in multicultural parts of the Roman Empire, such as the city of Rome, thriving commercial centres, and border regions to which the armies had brought people from various parts of the Empire, and where multicultural military personnel lived together with indigenous groups, craftsmen from different origins, and immigrants from commercially active regions, either in canabae adjacent to castra stativa, or in garrison towns, as in the Eastern parts of the Empire. In variatio upon an issue raised by Frederick Naerebout in another paper published in this volume, I might ask myself in what sense an army, which in the third century ad was progressively composed of ethnically and culturally different units, kept functioning as an integrated entity, or in actual practice disintegrated into rivalling, particularistic regional forces whose actual or potential competition for money and supplies con- stantly threatened peace and stability in the Empire, particularly in times of dangerous external wars, when the need for supplies increased. The discussion should start with Septimius Severus. After his victories over Pescennius Niger, some tribes in northern Mesopotamia, and Albinus in Gaul, Severus had to replenish the ranks of his armies, for example at the Danube frontiers, which had yielded many men to Severus’ field armies and his new praetorian guard. -

The Importance of Internal Borders in the Roman Empire: Written Sources and Model Cases
Philippe Della Casa & Eckhard Deschler-Erb (eds.). Rome’s Internal Frontiers. Proceedings of the 2016 RAC session in Rome. Zurich Studies in Archaeology, Vol. 11, 2016, 11–16. The importance of internal borders in the Roman Empire: Written sources and model cases Anne Kolb & Lukas Zingg Universität Zürich, Historisches Seminar, Karl Schmid-Strasse 4, CH-8006 Zürich, [email protected], [email protected] Throughout the Roman Empire, borders divided territories such as provinces, customs areas, and cities. This paper aims at presenting examples of written sources which illustrate the function and significance of internal borders. A dispute over a canal building (Tac. ann. 13,53) provides an example for problems that could arise from cross-border activities. The control of boundaries could be ensured by military posts, as indicated by votive inscriptions to border gods. The exceptional marking of a provincial boundary in the Danube area has to be seen in context of territorial changes. Some milestones refer to provincial borders and seem to have occasionally served as border markers. Keywords: Provincial Borders, Provincial Territories, Military Stations, Boundary Markers, Milestones 1. Introduction of dispute between cities, tribes, or private individuals, the Over an area of approximately 6 million square kilomet- decision fell usually in the realm of the provincial governor res, the Romans ruled an enormous Empire, encompassing or an official commissioned with the task (Dilke 1971; Gals- about 50 to 80 million people. The consolidation and ad- terer 1992; Von Cranach 1996; Campbell 2000; Lewis 2001; ministrative pervasion of this global empire was the pri- Willi 2014; Kolb 2016). -

The Impact of the Roman Army (200 BC – AD 476)
Impact of Empire 6 IMEM-6-deBlois_CS2.indd i 5-4-2007 8:35:52 Impact of Empire Editorial Board of the series Impact of Empire (= Management Team of the Network Impact of Empire) Lukas de Blois, Angelos Chaniotis Ségolène Demougin, Olivier Hekster, Gerda de Kleijn Luuk de Ligt, Elio Lo Cascio, Michael Peachin John Rich, and Christian Witschel Executive Secretariat of the Series and the Network Lukas de Blois, Olivier Hekster Gerda de Kleijn and John Rich Radboud University of Nijmegen, Erasmusplein 1, P.O. Box 9103, 6500 HD Nijmegen, The Netherlands E-mail addresses: [email protected] and [email protected] Academic Board of the International Network Impact of Empire geza alföldy – stéphane benoist – anthony birley christer bruun – john drinkwater – werner eck – peter funke andrea giardina – johannes hahn – fik meijer – onno van nijf marie-thérèse raepsaet-charlier – john richardson bert van der spek – richard talbert – willem zwalve VOLUME 6 IMEM-6-deBlois_CS2.indd ii 5-4-2007 8:35:52 The Impact of the Roman Army (200 BC – AD 476) Economic, Social, Political, Religious and Cultural Aspects Proceedings of the Sixth Workshop of the International Network Impact of Empire (Roman Empire, 200 B.C. – A.D. 476) Capri, March 29 – April 2, 2005 Edited by Lukas de Blois & Elio Lo Cascio With the Aid of Olivier Hekster & Gerda de Kleijn LEIDEN • BOSTON 2007 This is an open access title distributed under the terms of the CC-BY-NC 4.0 License, which permits any non-commercial use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original author(s) and source are credited. -

Siegfried Found: Decoding the Nibelungen Period
1 Gunnar Heinsohn (Gdańsk, February 2018) SIEGFRIED FOUND: DECODING THE NIBELUNGEN PERIOD CONTENTS I Was Emperor VICTORINUS the historical model for SIEGFRIED of the Nibelungen Saga? 2 II Siegfried the Dragon Slayer and the Dragon Legion of Victorinus 12 III Time of the Nibelungen. How many migration periods occurred in the 1st millennium? Who was Clovis, first King of France? 20 IV Results 34 V Bibliography 40 Acknowledgements 41 VICTORINUS (coin portrait) 2 I Was Emperor VICTORINUS the historical model for SIEGFRIED of the Nibelungen Saga? The mythical figure of Siegfried from Xanten (Colonia Ulpia Traiana), the greatest hero of the Germanic and Nordic sagas, is based on the real Gallic emperor Victorinus (meaning “the victorious”), whose name can be translated into Siegfried (Sigurd etc.), which means “victorious” in German and the Scandinavian languages. The reign of Victorinus is conventionally dated 269-271 AD. He is one of the leaders of the so-called Gallic Empire (Imperium Galliarum; 260-274 AD), mostly known from Historia Augusta (Thayer 2018), Epitome de Caesaribus of Aurelius Victor (Banchich 2009), and the Breviarum of Eutropius (Watson 1886). The capital city of this empire was Cologne, 80 km south of Xanten. Trier and Lyon were additional administrative centers. This sub-kingdom tried to defend the western part of the Roman Empire against invaders who were taking advantage of the so-called Crisis of the Third Century, which mysteriously lasted exactly 50 years (234 to 284 AD). Yet, the Gallic Empire also had separatist tendencies and sought to become independent from Rome. The bold claim of Victorinus = Siegfried was put forward, in 1841, by A. -

Centurions, Quarries, and the Emperor
Comp. by: C. Vijayakumar Stage : Revises1 ChapterID: 0002507155 Date:5/5/15 Time:11:37:24 Filepath://ppdys1122/BgPr/OUP_CAP/IN/Process/0002507155.3d View metadata,Dictionary : OUP_UKdictionarycitation and similar 289 papers at core.ac.uk brought to you by CORE OUP UNCORRECTED PROOF – REVISES, 5/5/2015,provided SPi by University of Liverpool Repository 16 Centurions, Quarries, and the Emperor Alfred M. Hirt INTRODUCTION The impact of Rome on the exploitation of natural resources remains highly visible in the many ancient stone and marble quarries dotting the landscape of the former empire. Not only do they reveal the techniques employed in separating the marble or granite from the rock face, the distribution of their output can still be traced. The progressively more scientific determination of type and origin of these stones used in sacred and profane architecture of the Roman Empire reveals an increasingly detailed image of the distributive patterns of coloured stones. Even so, the analysis of these patterns stays vexed: the written sources are frightfully mute on the core issues, expressly on the emperor’s role in the quarrying industry and his impact on the marble trade. Scholarly discourse has oscillated between two positions: John Ward- Perkins argued that by the mid-first century AD all ‘principal’ quarries were ‘nationalized’, i.e. put under imperial control and leased out to contractors for rent; the quarries were a source of revenue for the emperor, the distribution of its output driven by commercial factors.1 Clayton Fant, however, offered a different view: the emperor monopolized the use of coloured and white marbles and their sources not for profit, but for ‘prestige’, consolidating his position as unchallenged patron and benefactor of the empire. -

A Note on the Terminology: I Use “Brick” to Refer to Flat Building Units
Cambridge University Press 978-1-107-05935-1 - Innovative Vaulting in the Architecture of the Roman Empire: 1st to 4th Centuries CE Lynne C. Lancaster Index More information INDEX A note on the terminology: I use “brick” to refer to flat building units for walls and vaults, whereas I use “tile” to refer to items that have more complex forms, such as roof tiles and box-tiles (the distinction is not appropriate for all contexts, e.g. a “tile maker” can also make bricks). For place names, I have used the name that is most common, regardless of whether it is modern or ancient, but some cross references to alternative designations are provided. The monuments and places in the Web Catalogs and the Web Figures are not included in this index. Numbers in bold indicate pages with illustrations. ACoruna,˜ Spain, 175 Angmering, Britain (bath), 134, 136–37, Archimedes, 127, 181, 202 Aelius Aristides, 87 136, 137, 138, 142, 145 architect, 9, 10, 65, 110, 192 Aemilius Macer, 8 annona, 94, 112, 113, 196, 200 Amenhotep, son of Hapu, 49 Aeolian Islands (pumice), 31 annona militaris, 176 Menophilos, 11, 97 Aesica. See Great Chesters anthrocological (charcoal) studies, 197–98 Aretas IV, Nabatean king, 79 African Red Slip, 113, 127, 197. See also Antiochia in Pisidia, Turkey (bath), 34, Argos, Greece, 52, 69 pottery industry 35 “Serapeum”. See cult complex (Theater Agricola, 6 Antoninus Pius, 50 Baths) agricultural production, 127, 173, 176 Aphrodisias, Turkey agora drains, 52, 55 importance for construction technology, Flavian Basilica, 43 aqueducts, 52, 54, 210n66 112–13 individuals at Bath A. -
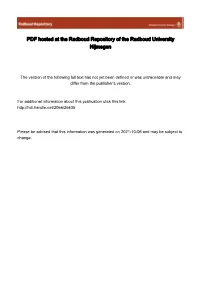
PDF Hosted at the Radboud Repository of the Radboud University Nijmegen
PDF hosted at the Radboud Repository of the Radboud University Nijmegen The version of the following full text has not yet been defined or was untraceable and may differ from the publisher's version. For additional information about this publication click this link. http://hdl.handle.net/2066/26435 Please be advised that this information was generated on 2021-10-06 and may be subject to change. ROMEINSE TROEPEN IN NIJMEGEN DOOR J.K. HAALEBOS De militaire geschiedenis van Nijmegen in de eerste twee eeuwen na Chr. is gecom pliceerd. De functie en de sterkte van de daar gelegerde troepen hebben gewisseld. In de midden-Augusteïsche tijd speelde de Hunerberg een rol in het offensief van Drusus (12-9 voor Chr.). Later zijn op het Kops Plateau en bij het Trajanusplein kleinere garnizoenen gelegerd die slechts beperkte taken kunnen hebben vervuld. Na de opstand der Bataven werd weer een legioen op de Hunerberg gestationeerd ter bewaking van de opnieuw onder Romeins gezag gebrachte bewoners van het Neder-Rijn-gebied. Het terrein bleef tot in de tweede helft van de 2e eeuw door kleinere afdelingen Romeinse troepen bezet. Sinds de stimulerende in 1967 verschenen studie van J.E. Bogaers over dit onderwerp is de samenstelling van de Nijmeegse garnizoenen niet meer uitvoerig besproken.1 Nieuwe epigrafische gegevens, gewijzigde inzichten in de structuur en het functioneren van het Romeinse leger en de toegenoinen kennis van de archeo logische overblijfselen maken een nieuw overzicht van de in Nijmegen gelegerde troepen gewenst. De voor-Flavische troepen Inleiding Onze kennis over de troepen die in de Julisch-Claudische tijd in Nijmegen gelegerd zijn geweest, is beperkt. -

Timeline1800 18001600
TIMELINE1800 18001600 Date York Date Britain Date Rest of World 8000BCE Sharpened stone heads used as axes, spears and arrows. 7000BCE Walls in Jericho built. 6100BCE North Atlantic Ocean – Tsunami. 6000BCE Dry farming developed in Mesopotamian hills. - 4000BCE Tigris-Euphrates planes colonized. - 3000BCE Farming communities spread from south-east to northwest Europe. 5000BCE 4000BCE 3900BCE 3800BCE 3760BCE Dynastic conflicts in Upper and Lower Egypt. The first metal tools commonly used in agriculture (rakes, digging blades and ploughs) used as weapons by slaves and peasant ‘infantry’ – first mass usage of expendable foot soldiers. 3700BCE 3600BCE © PastSearch2012 - T i m e l i n e Page 1 Date York Date Britain Date Rest of World 3500BCE King Menes the Fighter is victorious in Nile conflicts, establishes ruling dynasties. Blast furnace used for smelting bronze used in Bohemia. Sumerian civilization developed in south-east of Tigris-Euphrates river area, Akkadian civilization developed in north-west area – continual warfare. 3400BCE 3300BCE 3200BCE 3100BCE 3000BCE Bronze Age begins in Greece and China. Egyptian military civilization developed. Composite re-curved bows being used. In Mesopotamia, helmets made of copper-arsenic bronze with padded linings. Gilgamesh, king of Uruk, first to use iron for weapons. Sage Kings in China refine use of bamboo weaponry. 2900BCE 2800BCE Sumer city-states unite for first time. 2700BCE Palestine invaded and occupied by Egyptian infantry and cavalry after Palestinian attacks on trade caravans in Sinai. 2600BCE 2500BCE Harrapan civilization developed in Indian valley. Copper, used for mace heads, found in Mesopotamia, Syria, Palestine and Egypt. Sumerians make helmets, spearheads and axe blades from bronze. -

Finding Roman Brickyards in Germania Superior by Model-Based Cluster Analysis of Archaeometric Data
360 Layers of Perception – CAA 2007 Hans-Joachim Mucha – Hans-Georg Bartel – Jens Dolata Finding Roman Brickyards in Germania Superior by Model-Based Cluster Analysis of Archaeometric Data Abstract: Chemical analysis of ancient ceramics and of other archaeologically important materials has been used frequently to support archaeological research. Often the dimensionality of the measurements has been high. Therefore, multivariate statistical techniques such as cluster analysis have to be applied. The aim of the present paper is to give a review of the research on bricks and tiles from Roman military brick- yards in Germania Superior and to present the main results obtained by multivariate statistical analysis. In particular, new adaptive cluster analysis methods and modified model-based clustering are applied on archaeometric data (MUCHA / BA R TEL / DOLATA 2002; 2003a; 2005b; in press; BA R TEL / DOLATA / MUCHA 2000; 2003). The main result was the discovery of military brickyards that were not known when the project began about ten years ago. Recently, they have been discovered by the application of these multivariate sta- tistical analysis models. Newly developed visualization methods support and facilitate the interpretation of both the data set and the results of grouping. This means archaeologists can easily identify a new finding of a Roman brick or tile by comparing its chemical fingerprint with those from the detected provenances. Introduction period of operation was from the middle of the first century AD until the end of the fourth century. About 1000 Roman stamped bricks and tiles from Archaeologists are most interested in the location the Upper Rhine area were the objects under of brickyards and in the chronology of the pro- investigation by methods of chemical and statisti- duction-marks, which are found on the building- cal analysis. -

Integration Or Disintegration? the Roman Army in the Third Century A.D
INTEGRATION OR DISINTEGRATION? THE ROMAN ARMY IN THE THIRD CENTURY A.D. Lukas de Blois My issue in this paper is: what was the main trend within the Roman military forces in the third century ad? Integration, or disintegration into regional entities? This paper is not about cultural integration of ethnic groups in multicultural parts of the Roman Empire, such as the city of Rome, thriving commercial centres, and border regions to which the armies had brought people from various parts of the Empire, and where multicultural military personnel lived together with indigenous groups, craftsmen from different origins, and immigrants from commercially active regions, either in canabae adjacent to castra stativa, or in garrison towns, as in the Eastern parts of the Empire. In variatio upon an issue raised by Frederick Naerebout in another paper published in this volume, I might ask myself in what sense an army, which in the third century ad was progressively composed of ethnically and culturally different units, kept functioning as an integrated entity, or in actual practice disintegrated into rivalling, particularistic regional forces whose actual or potential competition for money and supplies con- stantly threatened peace and stability in the Empire, particularly in times of dangerous external wars, when the need for supplies increased. The discussion should start with Septimius Severus. After his victories over Pescennius Niger, some tribes in northern Mesopotamia, and Albinus in Gaul, Severus had to replenish the ranks of his armies, for example at the Danube frontiers, which had yielded many men to Severus’ field armies and his new praetorian guard. -

Iuppiter Dolichenus
Orientalische Religionen in der Antike Ägypten, Israel, Alter Orient Oriental Religions in Antiquity Egypt, Israel, Ancient Near East (ORA) Herausgegeben von / Edited by Angelika Berlejung (Leipzig) Joachim Friedrich Quack (Heidelberg) Annette Zgoll (Göttingen) 8 Iuppiter Dolichenus Vom Lokalkult zur Reichsreligion Herausgegeben von Michael Blömer und Engelbert Winter Mohr Siebeck Michael Blömer, geboren 1975; Studium der Klassischen Archäologie, Alten Geschichte und Latei- nischen Philologie; 2009 Promotion; wissenschaftlicher Mitarbeiter am Exzellenzcluster „Religion und Politik“ der Universität Münster. Engelbert Winter, geboren 1959; 1987 Promotion; 1995 Habilitation; seit 2001 apl. Prof. für Alte Geschichte und wissenschaftlicher Mitarbeiter an der Forschungsstelle Asia Minor im Seminar für Alte Geschichte der Westfälischen Wilhelms-Universität Münster; seit 2007 Leiter der Ausgrabun- gen im Zentralheiligtum des Iuppiter Dolichenus in Doliche. ISBN 978-3-16-151797-6 / eISBN 978-3-16-160597-0 unveränderte eBook-Ausgabe 2021 ISSN 1869-0513 (Orientalische Religionen in der Antike) Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbiblio- graphie; detaillierte bibliographische Daten sind im Internet über http://dnb.d-nb.de abrufbar. © 2012 Mohr Siebeck Tübingen. Das Werk einschließlich aller seiner Teile ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwer tung außerhalb der engen Grenzen des Urheberrechtsgesetzes ist ohne Zustimmung des Verlags unzulässig und strafbar. Das gilt insbesondere für Vervielfältigungen, -

Cults and Religious Integration in the Roman Cities of the Drava Valley (Southern Pannonia)
CULTS AND RELIGIOUS INTEGRATION IN THE ROMAN CITIES OF THE DRAVA VALLEY (SOUTHERN PANNONIA) BY BLANKA MIŠIĆ A DISSERTATION SUBMITTED FOR THE DEGREE OF DOCTOR OF PHILOSOPHY DEPARTMENT OF CLASSICS AND PHILOSOPHY ROYAL HOLLOWAY UNIVERSITY OF LONDON JANUARY 2013 1 DECLARATION OF AUTORSHIP I, Blanka Mišić, hereby declare that this thesis and the work presented in it is entirely my own. Signed: ______________________ Dated: _______________________ 2 For my dearest parents. 3 ABSTRACT This work is a detailed examination of pagan cults and deities in three settlements along the Pannonian section of the Drava river (Aquae Iasae – modern Varaždinske Toplice; Iovia- Botivo – modern Ludbreg; and Mursa – modern Osijek) situated within the present-day territory of Croatia. The evidence examined consists primarily of inscribed votive dedications in stone, dating from the Roman conquest of Pannonia to the late third century A.D. Evidence is examined within the theoretical framework of cultural change, taking into account recent theoretical developments in the concepts of “Romanisation”, acculturation, identity- expression and syncretisation in order to determine the extent of cultural and religious integration along the Drava. A thorough examination of evidence reveals the emergence of differing and flexible religious identities specific to each settlement although united by the larger prevailing trend of nature-divinity worship. Our Drava evidence also reveals that economic, social, political and geographic factors all produced an impact on the process and extent of cultural and religious integration, thus helping to form local, regional, provincial and imperial expressions of identity(ies). 4 TABLE OF CONTENTS 1. LIST OF ILLUSTRATIONS AND MAPS………………………………………......07 2.