Eine Empirische Untersuchung Im Val Lumnezia
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

Pretsch Fr. 1.90 21
Pretsch Fr. 1.90 21. annada, numer 62 GA 7007 Cuira Mesemna, ils 29 da mars 2017 Per plaschair, dentant Rudolf Nuolf ha fatg betg senza ambiziuns tut ils maratons 150 persunas èn sa participadas al Rudolf Nuolf ha sbsolvì dacurt ses segund Sport Beat Fun Banket 49avel Maraton da skis da l’En- Slalom a Breil. 6 giadina. 9 Redacziun: Via Sommerau 32, 7007 Cuira, tel. 081 255 57 10, [email protected] Bien onn per la Raiffeisen Tumpiv Lidl venda per romontsch (anr/hh) L’associaziun dalla liuns francs ed il success da fa Banca Raiffeisen Tumpiv sa mirar tschenta 170500 francs. Ils cuosts Il grossist tudestg risguarda il romontsch per sias inscripziuns anavos sin in bien onn da fa da fatschenta ein carschi mo leva tschenta 2016. Sco quei ch’ils re mein sin 880000 francs. La Ban DAD ANDREAS CADONAU sponsabels per la banca constate ca Raiffeisen Tumpiv che cum schan el rapport annual ha ella sa peglia igl inteschess dallas vi Ella filiala dil grossist tudestg viu repeter il success dils onns schnauncas da Breil e Vuorz salva Lidl a Schluein ei il romontsch avon. Cun rodund 42000 francs sia radunonza generala l’autra fetg presents. Il grossist ha instal ei il gudogn annual mo levamein jamna. lau ella filiala sursilvana inscrip sut quel digl onn precedent. Il gu ziuns romontschas per localisar dogn brut munta ad 1,17 mil ¾PAGINA 5 las partiziuns dils products. In no vum per ina stizun pli gronda en Surselva. En autras parts linguisti cas dalla Svizra eis ei normalitad. -

Brass Bands of the World a Historical Directory
Brass Bands of the World a historical directory Kurow Haka Brass Band, New Zealand, 1901 Gavin Holman January 2019 Introduction Contents Introduction ........................................................................................................................ 6 Angola................................................................................................................................ 12 Australia – Australian Capital Territory ......................................................................... 13 Australia – New South Wales .......................................................................................... 14 Australia – Northern Territory ....................................................................................... 42 Australia – Queensland ................................................................................................... 43 Australia – South Australia ............................................................................................. 58 Australia – Tasmania ....................................................................................................... 68 Australia – Victoria .......................................................................................................... 73 Australia – Western Australia ....................................................................................... 101 Australia – other ............................................................................................................. 105 Austria ............................................................................................................................ -

Graubünden for Mountain Enthusiasts
Graubünden for mountain enthusiasts The Alpine Summer Switzerland’s No. 1 holiday destination. Welcome, Allegra, Benvenuti to Graubünden © Andrea Badrutt “Lake Flix”, above Savognin 2 Welcome, Allegra, Benvenuti to Graubünden 1000 peaks, 150 valleys and 615 lakes. Graubünden is a place where anyone can enjoy a summer holiday in pure and undisturbed harmony – “padschiifik” is the Romansh word we Bündner locals use – it means “peaceful”. Hiking access is made easy with a free cable car. Long distance bikers can take advantage of luggage transport facilities. Language lovers can enjoy the beautiful Romansh heard in the announcements on the Rhaetian Railway. With a total of 7,106 square kilometres, Graubünden is the biggest alpine playground in the world. Welcome, Allegra, Benvenuti to Graubünden. CCNR· 261110 3 With hiking and walking for all grades Hikers near the SAC lodge Tuoi © Andrea Badrutt 4 With hiking and walking for all grades www.graubunden.com/hiking 5 Heidi and Peter in Maienfeld, © Gaudenz Danuser Bündner Herrschaft 6 Heidi’s home www.graubunden.com 7 Bikers nears Brigels 8 Exhilarating mountain bike trails www.graubunden.com/biking 9 Host to the whole world © peterdonatsch.ch Cattle in the Prättigau. 10 Host to the whole world More about tradition in Graubünden www.graubunden.com/tradition 11 Rhaetian Railway on the Bernina Pass © Andrea Badrutt 12 Nature showcase www.graubunden.com/train-travel 13 Recommended for all ages © Engadin Scuol Tourismus www.graubunden.com/family 14 Scuol – a typical village of the Engadin 15 Graubünden Tourism Alexanderstrasse 24 CH-7001 Chur Tel. +41 (0)81 254 24 24 [email protected] www.graubunden.com Gross Furgga Discover Graubünden by train and bus. -

Fundaziun Da Cultura Lumnezia Jahresbericht 2016
CULTURA EN LUMNEZIA – Fundaziun da cultura Lumnezia Jahresbericht 2016 www.culturalumnezia.ch - [email protected] Fundaziun da cultura Lumnezia – Casa d' Angel – Dado Baselgia 116 – CH-7148 Lumbrein 1 CULTURA EN LUMNEZIA Inhalt 2016 im Überblick 3 Jahresbericht 2016 4 Anhang A: Jahresrechnung 2016 9 Anhang B: cultura en Lumnezia - Jahresprogramm 11 Anhang C: guids da cultura Lumnezia 13 Anhang D: passadis – über alle Berge 14 2 CULTURA EN LUMNEZIA 2016 im Überblick Das Jahr 2016 war vor allem von der ersten in eigener Regie gestaltete Ausstellung in der Casa d'Angel geprägt. Doch auch die anderen Projekte der Fundaziun da cultura Lumnezia (FCL) fangen an sich zu entfalten. Doch auch die Verlängerung des Leistungsvertrages mit der Gemeinde Lumnezia war eine wichtige Anerkennung der bisherigen Leistung. Casa d'Angel : Die kulturhistorische Ausstellung Passadis – über alle Berge von Gastkurator Beat Gugger kam sehr gut bei den Besuchern an, und insgesamt konnten mehr Besucher verzeichnet werden als im Eröffnungsjahr 2015. Ein grosses Veranstaltungsprogramm liess die Nachbarn aus Vals, Hinterrhein, Safien, Obersaxen und Sumvitg in die Casa d'Angel kommen, um von den alten Verbindungen über die Berge hinweg zu erzählen. Cultura en Lumnezia : Die Veranstaltungsreihe der FCL knüpft dieses Jahr eng an die Ausstellung in der Casa d'Angel an. Weitere kleinere Veranstaltungen finden im Winter rund um den Kristall statt oder aber in Café romontsch-Regie. Café romontsch : Im Februar 2016 wurde das Konzept Café romontsch für Romanischlernende und ihre Sprachgottis lanciert. Bis Ende Jahr hat sich eine feste Gruppe von etwa 10 Personen herauskristallisiert, andere kommen hinzu, wenn es ihnen die Zeit erlaubt. -

Surselva Tourismus AG Geschäftsbericht 1
Surselva Tourismus AG Geschäftsbericht 1. Januar 2016 - 31. Dezember 2016 5. Geschäftsjahr Jahresbericht 2016 des Präsidenten Jahresbericht des Präsidenten Seit der Gründung der Surselva Tourismus AG im Jahre 2010 beschäftigten uns immer wieder Struk- turfragen. Dadurch wurden ein Teil der Ressourcen für solche Fragen gebunden, diese Ressourcen fehlten für unsere eigentliche Kernaufgabe. Anders präsentierte sich die Situation im Jahr 2016. Die Strukturfragen sind vorderhand geklärt und die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Surselva Touris- mus konnten sich voll und ganz auf die Kernaufgabe fokussieren. Im Fokus des vergangenen Jahres stand der Relaunch der Webseite www.surselva.info, die Erhöhung der bewirtschafteten Wohnungen in unserer Destination, die Steigerung der Bekanntheit der Destina- tion Surselva um dadurch mehr Logiernächte zu generieren, die Fokussierung unserer Aktivitäten und damit die Fokussierung auf unsere Neigungsgruppen. Die aus dem Jahr 2010 stammende Webseite war unübersichtlich, nicht responsive (keine Darstellung für Tablets und Mobile Phones) und entsprach nicht den heutigen Bedürfnissen. Der Relaunch dieser Seite stellte eine grosse Herausforderung dar und beanspruchte die Mitarbeiter/innen der STAG sehr intensiv über einige Monate. Kurz vor dem Jahreswechsel konnte die neue Webseite live geschaltet werden. Insgesamt darf der Relaunch als gelungen betrachtet werden, wenn es auch am Anfang noch einige Fehler auszubessern gab. Dank intensiven Bemühungen konnte die Anzahl über das Reservationssystem angebotene Woh- nungen im Jahr 2016 erhöht werden. Für die Destination nicht unwesentlich, können damit den Gästen mehr verfügbare Betten angeboten werden. Das Ziel, der im Jahr 2016 lancierten Charme-Offensive, ist die Bekanntheit der Destination Sursel- va zu erhöhen. Der erste Event mit der Einladung von Passanten der Bahnhofstrasse in Zürich auf das Schiff war ein voller Erfolg. -

1 Hoch Über Der Vallumnezia 2 Von Der Neuzeit Zurück In
Einleitung 8 Wissenswertes: Romanische Namen in Landschaft und Natur 20 Nützliche Hinweise 26 1 HOCH ÜBER DER VALLUMNEZIA Lumbrein-Alp Nova-Piz Sezner-Stein-Triel-Vella 32 Allianz in den Alpen - austauschen, anpacken, umsetzen 40 2 VON DER NEUZEIT ZURÜCK IN DIE BRONZEZEIT Vella-Degen—Vignogn-Lumbrein-Silgin—Surin-Vrin 44 Sakrale und weltliche Baukultur 54 3 AUF DEN PIZ TG KETSCH EN Vrin-Puzzatsch-Alp Ramosa-Fuorda Cotschna-Piz Tgietschen-Fuorda Cotschna-Pass Diesrut-Puzzatsch-Vriri 58 Cul zuffel e l'aura dado 66 4 RUNDUM DIE GREINA Vrin-Greina-Pizzo Coröi-Capanna Motterascio- Passo della Greina-Camona da Terri-Vrin 70 Viva la Greina! 80 5 KEINE MENSCHENSEELE WEIT UND BREDT Vrin-Vanescha-Alp Scharboda-Fuorcla da Puozas- Fruntstafel-Zervreila 84 Parc Adula - wann kommt der zweite Schweizer Nationalpark? 92 6 DREI-SEEN-WANDERUNG Zervreila-Guraletschsee-Ampervreilsee-Selvasee- Peil-Vals Platz 96 Valser Wasserwelten 106 7 AUFPOLENWEGEM INS SAFIENTAL Vals Post-Schindlabüdemli-Alp Tomül-Tomülpass- Piz Tomül-Tomülpass-Turrahus 110 Wie die Polen ins Safiental kamen 118 Safier Ställe als kulturelles Erbe 120 8 VOM GUTEN FESS ZUR RHEINSCHLUCHT Tenna-Piz Fess-Tenna-Tenner Chrüz-Valendas-Sagogn Station 122 9 AUF WENIG BEGANGENEN PFADEN Pitasch-Signina-Riein-Giera-Valendas Dorf- Valendas-Sagogn Station 132 Sursilvan-die Sprache derSurselva 142 10 RUINAULTA-GRAND CANYON DER SCHWEIZ Valendas-Sagogn Station-Versam-Safien Station-Conn- Lag la Cauma-Flims Waldhaus 146 Naturschutzgebiet Versamer Auenwald 154 6 http://d-nb.info/1045788880 11 VON MENHIREN -

Finsternis Im Tal Des Lichts?
Kantonsschule Heerbrugg Schuljahr 2015/2016 Fachgruppe Geschichte Maturaarbeit Dr. Walther Baumgartner 27. November 2015 Finsternis im Tal des Lichts? Das Val Lumnezia - gestern, heute, morgen Simon Alig, 4Wa Wachtstrasse 16b 9425 Thal Das Val Lumnezia: gestern, heute, morgen Inhaltsverzeichnis Einleitung .............................................................................................................................................. 3 Teil I: Porträt des Tals ......................................................................................................................... 4 1.1 Schlaglichter auf die Geschichte ......................................................................................... 5 1.2 Sprache und Konfession ...................................................................................................... 9 1.3 Bevölkerungsentwicklung................................................................................................. 11 1.4 Politische Gliederung ......................................................................................................... 13 1.5 Wirtschaft ............................................................................................................................ 14 Teil II: Probleme ................................................................................................................................ 17 2.1 Abwanderung und Überalterung .................................................................................... 18 2.2 Einseitige, schwache -

Das Gästemagazin Aus Der Tourismusregion Surselva
pura.Das Gästemagazin surselva. aus der Tourismusregion Surselva Eine unserer überfülltesten Pisten. Weniger Leute ist mehr. Jetzt Winterferien in Brigels und Obersaxen buchen: www.surselva.info PURA. SURSELVA. Eine unserer überfülltesten Pisten. Erlebbar machen, wie es früher war Lieber Jules, wie ist es dazu gekommen, dass die «Tegia Rasuz», diese nostalgische Alphütte, mitten in Brigels steht und zum Museum geworden ist?* JULES: Ich und mein Cousin Maurus lieben Gegenstände aus alten Zeiten. Wir sammeln solche seit 40 Jahren mit Leidenschaft. Die Gegenstände wurden immer grösser und irgendwann gehörte auch diese Maiensässhütte dazu. Vor einiger Zeit haben wir sie auf dem Maiensäss abgebaut, im Dorf wieder aufgebaut und zum «lebendigen» Museum aus früheren Zeiten gemacht. Machst Du auch die Erfahrung, dass die Leute vermehrt Interesse an vergangenen Zeiten und alten Kulturen haben? Ich sehe in verschiedenen Bereichen, dass sich die Leute wieder an früher orientieren. Wenn ich sehe, wie unsere Vorfahren Kleider hergestellt haben … sie haben sich von Grund auf bei der Natur bedient. Heute weiss man ja nicht, woher die Textilien kommen. Darum legen die Leute wieder Weniger Leute ist mehr. Wert darauf, mehr über die Herkunft der Produkte zu wis- sen. Man will nicht nur gute Qualität, sondern auch Nach- haltigkeit. Ich habe gerade letzte Woche einem Nach- wuchskoch aus dem Dorf ein tolles altes Rezept gezeigt, wie man damals Ravioli machte … Wie sich dieser Trend widerspiegelt, siehe Fortsetzung des Interviews mit Jetzt Winterferien in Brigels und Jules Cathomas auf Seite 18. Obersaxen buchen: www.surselva.info * mit Jules Cathomas sprach Silvan Gabriel von der Surselva Tourismus AG 3 PURA. -
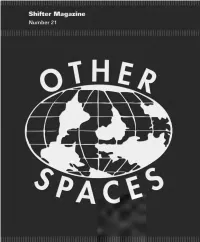
Other Spaces Spreads03.Pdf
9 8 9 7 8 6 7 5 6 4 5 3 4 2 3 1 2 INCH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 SHIFTER® 14 9 1 Shifter Magazine INCH Number 21: Other Spaces ® 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 SHIFTER 14 8 Editors’ Note . 5. Luis Camnitzer . *6. Sean Raspet . 7. 7 Joanne Greenbaum . .*18 Blithe Riley . 20. Tyler Coburn . 31. Sheela Gowda . 39. Blank Noise . 42. Lise Soskolne . 55. 6 Mariam Suhail . 77. Julia Fish . *89. Dan Levenson . 90. Beate Geissler / Oliver Sann . .102 Alison O’Daniel . .110 Greg Sholette / Agata Craftlove . 115. Jacolby Satterwhite . .126 5 Josh Tonsfeldt . 130. Jeremy Bolen . .138 Kitty Kraus . 140. Tehching Hsieh . .143 * Work by these artists is dispersed throughout the issue . The page number marks the first 4 occurrence of their work . Publisher . SHIFTER Editor . .Sreshta Rit Premnath 3 Editor . .Matthew Metzger Designer . Dan Levenson SHIFTER, Number 21, September, 2013 Shifter is a topical magazine that aims to illuminate and broaden our understanding of the inter- sections between contemporary art, politics and philosophy .The magazine remains malleable and 2 responsive in its form and activities, and represents a diversity of positions and backgrounds in its contributors . shifter-magazine .com shiftermail@gmail .com This issue of SHIFTER was funded by a grant from the Graham Foundation © 2013 SHIFTER 1 INCH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 SHIFTER® 14 9 Other Spaces A city square is occupied by hundreds of shouting voices, and transformed 8 by hundreds of sleeping bodies building together a polis for action as well as a home for repose . -
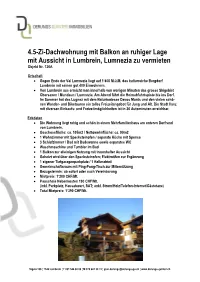
Val Lumnezia Liegt Auf 1‘400 M.Ü.M
4.5-Zi-Dachwohnung mit Balkon an ruhiger Lage mit Aussicht in Lumbrein, Lumnezia zu vermieten Objekt Nr. 136A Ortschaft • Gegen Ende der Val Lumnezia liegt auf 1‘400 M.ü.M. das kulturreiche Bergdorf Lumbrein mit seinen gut 400 Einwohnern. • Von Lumbrein aus erreicht man innerhalb von wenigen Minuten das grosse Skigebiet Obersaxen / Mundaun / Lumnezia. Am Abend führt die Heimabfahrtspiste bis ins Dorf. Im Sommer hat das Lugnez mit dem Naturbadesee Davos Munts und den vielen schö- nen Wander- und Biketouren ein tolles Freizeitangebot für Jung und Alt. Die Stadt Ilanz mit diversen Einkaufs- und Freizeitmöglichkeiten ist in 30 Autominuten erreichbar. Eckdaten • Die Wohnung liegt ruhig und schön in einem Mehrfamilienhaus am unteren Dorfrand von Lumbrein. • Geschossfläche: ca. 105m2 / Nettowohnfläche: ca. 90m2 • 1 Wohnzimmer mit Specksteinofen / separate Küche mit Spensa • 3 Schlafzimmer / Bad mit Badewanne sowie separates WC • Waschmaschine und Tumbler im Bad • 1 Balkon zur alleinigen Nutzung mit traumhafter Aussicht • Geheizt wird über den Specksteinofen; Elektroöfen zur Ergänzung • 1 eigener Tiefgaragenparkplatz / 1 Kellerabteil • Gemeinschaftsraum mit Ping-Pong-Tisch zur Mitbenützung • Bezugstermin: ab sofort oder nach Vereinbarung • Mietpreis: 1‘200 CHF/Mt. • Pauschale Nebenkosten 190 CHF/Mt. (inkl. Parkplatz, Hausabwart, SAT; exkl. Strom/Holz/Telefon-Internet/Gästetaxe) • Total Mietpreis: 1‘390 CHF/Mt. Vigela 108 ¦ 7148 Lumbrein ¦ T 081 544 80 00 ¦ M 079 641 30 72 ¦ [email protected] ¦ www.derungs-quinter.ch Val Lumnezia – das -

Rangliste Bike Marathon Lumnezia-Obersaxen Vom 30.07.2017
Rangliste Bike Marathon lumnezia-obersaxen vom 30.07.2017 Damen open Rang Nr Name Jg Ort Team 1 2 3 4 Gesamt 1. 92 Müggler Eliane 1994 Thal bischibikes / 02:40:32.7 kopierpapier.ch / RV Altenrhein 2. 90 Soler Carla 1980 Lumbrein VC SURSELVA 02:42:25.9 3. 130 Leugger Seraina 1998 Arlesheim Goldwurst Power 02:46:23.9 4. 14 Schneider Martina 1999 Arbon RV Arbon 02:55:08.8 5. 274 Bandel Vanessa 1998 Lüchingen bskGraf MTB Team / RV 02:56:16.5 Altenrhein 6. 73 Stieger Nadine 1997 Altstätten Pink Gili Swiss / VC 02:59:14.9 Altstätten 7. 373 Fässler Nadja 1996 Weissbad Vesto.ch/RMC Appenzell 03:03:08.6 8. 89 Schweizer Manuela 1973 Obersaxen VC Surselva 03:12:09.4 9. 372 Jenny Manuela 1983 Horw 03:12:30.9 10. 278 Hoppe Jeanette 1975 Maienfeld 03:38:29.2 11. 371 Roman Andia 1980 Chur 03:46:31.9 Herren Lizenz Rang Nr Name Jg Ort Team 1 2 3 4 Gesamt 1. 173 Burki Nick 1998 Derendingen Biketeamsolothurn 02:00:29.6 2. 142 Spescha Ursin 1998 Sevgein Bike Team Solothurn / VC 02:00:49.2 Surselva 3. 146 Beeli Andrin 1995 Sagogn SCOTT development 02:02:10.0 MTB Team 4. 165 Bucher Lukas 1988 Derendingen Tropical Solothurn 02:02:14.1 5. 293 Spiess Robin 1998 Kriessern Ostschweiz Druck 02:02:39.8 Stevens Bike Team 6. 285 Widmer Daniel 1992 Mühlrüti Motorama Holenstein 02:02:49.0 Race Team 7. 136 Rüegg Timon 1996 Oberweningen Scott development MTB 02:04:05.3 Team / VC Steinmaur 8. -

Räumliches Entwicklungskonzept
LUMNEZIA Räumliches Entwicklungskonzept © Plan-Idee, 24. Mai 2019 2/55 INHALTSVERZEICHNIS Das Dorf guter Nachbarschaften ............................................................................................ 4 1. Einleitung ........................................................................................................................ 6 1.1 Ausgangslage .......................................................................................................... 6 1.2 Ziel und Inhalt des KRL ........................................................................................... 6 2. Beteiligte Akteure ............................................................................................................ 7 2.1 Arbeitsgruppe Leitbild .............................................................................................. 7 2.2 Partizipation der Bevölkerung .................................................................................. 7 2.3 Denkwerkstatt .......................................................................................................... 8 3. Die Gemeinde Lumnezia ................................................................................................ 8 4. Leitsätze und Massnahmen ............................................................................................ 9 4.1 Allgemein ................................................................................................................. 9 4.2 Kultur ....................................................................................................................