WB Berlinerausgabe 06.Pdf
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

Local Expellee Monuments and the Contestation of German Postwar Memory
To Our Dead: Local Expellee Monuments and the Contestation of German Postwar Memory by Jeffrey P. Luppes A dissertation submitted in partial fulfillment of the requirements for the degree of Doctor of Philosophy (Germanic Languages and Literatures) in The University of Michigan 2010 Doctoral Committee: Professor Andrei S. Markovits, Chair Professor Geoff Eley Associate Professor Julia C. Hell Associate Professor Johannes von Moltke © Jeffrey P. Luppes 2010 To My Parents ii ACKNOWLEDGMENTS Writing a dissertation is a long, arduous, and often lonely exercise. Fortunately, I have had unbelievable support from many people. First and foremost, I would like to thank my advisor and dissertation committee chair, Andrei S. Markovits. Andy has played the largest role in my development as a scholar. In fact, his seminal works on German politics, German history, collective memory, anti-Americanism, and sports influenced me intellectually even before I arrived in Ann Arbor. The opportunity to learn from and work with him was the main reason I wanted to attend the University of Michigan. The decision to come here has paid off immeasurably. Andy has always pushed me to do my best and has been a huge inspiration—both professionally and personally—from the start. His motivational skills and dedication to his students are unmatched. Twice, he gave me the opportunity to assist in the teaching of his very popular undergraduate course on sports and society. He was also always quick to provide recommendation letters and signatures for my many fellowship applications. Most importantly, Andy helped me rethink, re-work, and revise this dissertation at a crucial point. -

Central Europe
Central Europe West Germany FOREIGN POLICY AND STATUS OF BERLIN OUBJECTS discussed during British Premier Harold Wilson's offi- cial visit to Bonn from March 7 to 9 included the maintenance of the British Rhine Army in Germany, the continuation of German currency aid for the United Kingdom, and a new approach to German reunification. When East German authorities tried to interfere with the meeting of the Bundestag in Berlin on April 7 by disrupting traffic to and from the former capital, the Western Allies protested sharply. In his opening speech Eugen Gerstenmaier, president of the Bundestag, emphasized the right of the Fed- eral parliament to meet in West Berlin and denied that the session was an act of provocation. During the Easter holidays 300,000 West Berliners were permitted to visit relatives in the Eastern zone of the divided city. About a million Berliners crossed the Berlin Wall and spent Christmas with their relatives, after the renewal of an agreement in November. Queen Elizabeth II of England and her consort the Duke of Edinburgh made an official visit to West Germany and West Berlin in May, and were cheered by the population. Attempts by Foreign Minister Gerhard Schroder to bring about an improvement in relations with the United Kingdom during this visit were viewed skeptically by Franz-Josef Strauss, chairman of the Christian Social Union (CSU), representing the pro-French wing of the coalition. French President Charles de Gaulle's talks with Chancellor Ludwig Erhard in Bonn in June were described as "positive," but did not lead to an agree- ment on a conference to discuss the reorganization of the Common Market and other matters pertaining to the European community. -

Contrasalon Jürgen Wahl ☼ Mein Politischer Privatbrief No 1 – 15.1
ContraSalon Jürgen Wahl ☼ Mein politischer Privatbrief No 1 – 15.1. 2010 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- elmar-brok-interview: dialog - start zwischen parlament und lady ashton + eu -präsident rompuy bekennt sich zu schumans vorbild maritain ++ stein- bach-debatte konkret ++ neuer cicero-chef ++ malcolm harbour als realist TIME-Gold für Merkel – und Unionszwerge mäkeln weiter Berliner Kanzlerin wurde „Mann“ des Jahres 2009 des großen US-Magazins. „Frau Europa“ habe „mehr Macht als alle Leader des (alten) Kontinents“ Catherine Mayer, für TIME an der Spree, hält die deutsche Regierungschefin für machtpolitisch nicht mehr bedroht, doch für früher „immer wieder unterschätzt“, heute jedoch „nur low profile“ praktizierend. Das übliche fade Einordnen, auch in den USA beliebte journalistische Fingerübung, fällt Mayer schwer: Ist die Kanzlerin „sozialliberal“, „jenseits vom Christdemokrati- schen“ oder „bloß vorsichtig“? Jedenfalls, seufzt sie, fänden 70% der Deutschen sie sympathisch. Nach ihrem Leben und Erleben in der DDR sei Angela Merkel hilfsbereit bis nach Af-ghanistan. Mit Obama teile sie die Ansicht, Führung müsse auf ein Zuviel an Macht verzichten. Und in Brüssel zwinge sie auch Widerstrebende zu der Einsicht, dass man mit national- - “souveränen“ Taktiken auf der Welt scheitern müsse. Es sei zwar wahr, dass niemand genau sagen könne, was diese Deutsche mit ihrer Macht künftig anstellen wolle, doch seit dem Fall der Mauer habe sie immer wieder mit Argumenten überzeugt. Was kann Europa denn mehr wollen als solche Testate ? Und nun geht unser Blick nach Berlin... Am Sonntag vor der CDU-Vorstandsklausur richteten vier Provinz-Mandatare der Partei ihre Blasrohre gegen die Kanzlerin und wiederholten in der FAZ sorgfältig, also scheinbar von Sorgen gefaltet, was nicht nur FAZ und WELT basso ostinato seit der Bundestagswahl immer neu wiederholen. -

Antwort Der Bundesregierung
Deutscher Bundestag Drucksache 12/5591 12. Wahlperiode 26. 08. 93 Antwort der Bundesregierung - auf die Kleine Anfrage der Abgeordneten Ulla Jelpke und der Gruppe der PDS/Linke Liste — Drucksache 12/5515 — Deutschlandtreffen der Schlesier 1993 in Nürnberg Unter dem Motto „Unsere Heimat heißt Schlesien" fand am 10. und 11. Juli 1993 das Deutschlandtreffen der Schlesier statt. „Daß nach einem Abstand von 20 Jahren wiederum Nürnberg als Veranstaltungs- ort gewählt wurde", war nach Angaben des „Schlesier" vom 9. Juli 1993 „allein dem besonderen Entgegenkommen der Bayerischen Staatsregie- rung" zu verdanken. In der gleichen Ausgabe der Zeitung „Der Schlesier" begrüßt der NPD- Bezirksverband Mittelfranken in einer Anzeige „die schlesischen Landsleute zum Deutschlandtreffen in Nürnberg!". Aber auch Bundeskanzler Dr. Helmut Kohl hat seine Verbundenheit mit den Schlesiern durch ein Grußwort zum Ausdruck gebracht und darin u. a. betont, daß „die 700jährige Geschichte und Kultur des deutschen Ostens ein Bestandteil des Erbes der ganzen deutschen Nation" und „ein Gebot historischer Wahrhaftigkeit" sei. Weiter führt er aus: „Mir persönlich liegt viel daran, dieses große Erbe zu bewahren und zu pfle- gen. Es ist ein Erbe, das lebendig bleibt, weil es ein unverlierbarer • Bestandteil unserer Geschichte ist." Einige Bundestagsabgeordnete wurden auf dem Deutschlandtreffen vom stellvertretenden Bundesvorsitzenden der Landsmannschaft Schle- sien, Heinz Lorenz, begrüßt. Die CDU-Abgeordnete E rika Steinbach Hermann z. B. hielt ein Kurzreferat mit dem Thema „Wir Vertriebenen können Vorbild sein". Der fraktionslose Abgeordnete Ortwin Lowack leitete die Deutschlandkundgebung in der Frankenhalle. Der CSU-Abgeordnete Michael Glos hielt eine Rede auf dieser Kund- gebung. Während dieser Rede kam es zu Tumulten, als Mitglieder der NPD-Jugend (Junge Nationaldemokraten, JN) Transparente entrollten, auf denen zu lesen war: „Verzicht ist Verrat" oder „Auf Kohl verzichten wir, auf Schlesien nicht". -

Jakob Kaiser Gewerkschafter Und Patriot
Jakob Kaiser Gewerkschafter und Patriot Eine Werkauswahl Herausgegeben und eingeleitet von Tilman Mayer Bund-Verlag Inhalt Abkürzungsverzeichnis 11 Vorwort 13 A. Einfuhrung: Jakob Kaiser - Die soziale und nationale Herausforderung . 17 I. Der junge Jakob Kaiser . .... 19 A Christlicher Gewerkschafter 19 Das Sozialprogramm der christlichen Gewerkschaften . 21 Das Ende des ersten parlamentarischen Systems in Deutschland 23 Einheitsgewerkschaft 25 Wilhelm Leuschner 33 II. 1933-1944: »Der Aufstand des Gewissens« 36 Im antifaschistischen Widerstand 36 Der Widerstandsbegriff . 37 »Auseinandersetzung mit der DAF« 38 Widerstandszirkel 39 Ludwig Reichholds Gewerkschaftskonzept 42 Nationale Gewerkschaft und neue Partei 44 Jakob Kaisers Verhältnis zu Österreich 46 Gesamtwürdigung: Der Sinn des Widerstandes 49 Die Frage nach dem Motiv 53 III. Für den eigenen deutschen Weg 1945-1947 55 CDUD 57 Deutschland zwischen Ost und West . 62 Die sozialistische Aufgabe 69 Nationale Repräsentation der Deutschen 75 IV. 1948/1949 79 Mandat in Essen 81 Gustav Heinemann 82 V. Der Minister 1950-1957 85 1. Die Institutionalisierung gesamtdeutscher Politik . 85 Das Ministerium 85 Exil-CDU - Kuratorium Unteilbares Deutschland . 90 2. Der Saarkonflikt 92 Die Wiedervereinigung im Westen 94 »Wahlen an der Saar« 98 3. Die Stalin-Noten vom Frühjahr 1952 107 Die Stalin-Note vom 10. März 1952 108 Kaiser zur Stalin-Note 109 Bilanz 114 4. Die Sozialausschüsse 115 Gegen eine Mauer zwischen Ost und West 117 Nationale und soziale Verpflichtung im deutschen Kernstaat 118 Eine Kette von Provokationen 122 VI. Jakob Kaiser: Gewerkschafter, Widerstandskämpfer, Patriot 129 B. Dokumentation 135 Brief an Lorenz Sedlmayr vom 15. Oktober 1923 137 Rede vor der christlichen Arbeiterschaft im Mai 1928 140 Rede auf dem Reichsjugendtag am 11. -

Verzeichnis Der Briefe
Verzeichnis der Briefe Nr. Datum Adressat/Dokument 573 17.7.1947 Ministerpräsident Karl Arnold, Düsseldorf 574 17.7.1947 Dr. Paul Silverberg, Lugano 575 18.7.1947 Oberpräsident a. D. Dr. Robert Lehr, Düsseldorf 576 19.7.1947 Oberbürgermeister Josef Gockeln, Düsseldorf 577 20.7.1947 Vorstand der CDU Remscheid 578 20.7.1947 Dannie N. Heineman, Brüssel 579 20.7.1947 Max Reuel, Erlangen 580 20.7.1947 Gerhard Schiche, Nienburg/Weser 580A 20.7.1947 Bescheinigung für Gerhard Schiche, Nienburg/Weser 581 23.7.1947 Dr. Helmut E. Müller, Solingen-Ohligs 582 23.7.1947 Österreichischer Gesandter Clemens Wildner, Ankara 583 25.7.1947 Tagungsbüro der Arbeitsgemeinschaft Deutscher Föderalisten, Koblenz 584 25.7.1947 Außenstelle Düsseldorf der Deutschen Nachrichten Agentur 585 25.7.1947 Dr. Paul Silverberg, Lugano 586 30.7.1947 Generalkonsul Pierre Arnal, Düsseldorf-Benrath 587 30.7.1947 Dr. Hans Schlange-Schöningen, Stuttgart und Dr. Johannes Semler, München 588 30.7.1947 Dr. Carl Spiecker, Essen 588A 22.8.1947 Aktennotiz über ein Gespräch mit Dr. Carl Spiecker 589 4.8.1947 Schriftleiter des Verlags Europa-Archiv, Wilhelm Cornides, Oberursel/Taunus 590 4.8.1947 Landrat Dr. August Dresbach, Gummersbach 591 4.8.1947 Dr. Paul Otto, Osnabrück 592 8.8.1947 Dr. Otto von der Gablentz, Berlin 593 10.8.1947 Generalkonsul Maurice W. Altaffer, Bremen 594 10.8.1947 Dr. Ernst Schwering, Köln 595 16.8.1947 Ministerpräsident Karl Arnold, Düsseldorf 596 16.8.1947 Dr. Friedrich Holzapfel, Herford 597 16.8.1947 Generaldirektor Dr. Wilhelm Roelen, Duisburg-Hamborn 598 18.8.1947 Dr. -

UID Jg. 22 1968 Nr. 43, Union in Deutschland
iristlich Demokratische eutschla Bonn Nr. 43/68 ^Oktober Z 8398: C • 22. Jahrgang i • Thema der Woche Berlin steht im Blickpunkt HEUTE Seite Die Ausschüsse und Fraktionen des Bundestages tagten in die Fraktion noch einmal klar, daß dieser Woche wie seit längerem vorgesehen wieder in Berlin. mit der Wahl eines neuen Bundes- präsidenten keine koalitionspoli- Bundesrepublik Auch diesmal wurde von Ostberliner und Moskauer Seite tischen Entscheidungen vorwegge- soll unter Druck gegen diese Veranstaltungen des Bundestages scharf prote- nommen werden dürften. Zur Frage gesetzt werden 3 stiert und polemisiert. des Ortes der Bundesversamm- lung vertritt die CDU CSU-Fraktion Zweiter die Auffassung, daß der Bundes- Vertriebenen- und Fraktionsvorsitzender Dr. Barzel ebensowenig eine Provokation dar, tagspräsident dies pflichtgemäß zu stellte dazu vor dem Vorstand und wie die Sitzungen der Fraktionen entscheiden habe; Selbstverständ- Flüchtlingskongreß 4 der Gesamtfraktion der CDU/CSU und Ausschüsse des Bundestages lich nach vorheriger Konsultation fest, es sei das Selbstverständ- in der deutschen Hauptstadt. der Alliierten, der Bundesregierung 1967 ein Jahr des lichste von der Welt, daß „wir und der Bundestagsfraktionen. Haushaltsausgleichs 5 Deutschen hier in Berlin sind und In den Beratungen der CDU/ unter dem Schutz der Alliierten CSU-Bundestagsfraktion in Berlin O Die Fraktion beschäftigt sich arbeiten". Dr. Barzel verwies dar- spielten 3 Themen eine besondere auch eingehend mit dem Spionage- auf, daß die Bundesregierung in Rolle. verdacht und Selbstmordfällen der einer Note vom 1. März 1968 an letzten Wochen. Dabei vertrat die die Sowjetregierung betont habe, # Vorstand und Fraktion brach- CDU/CSU-Fraktion folgende Auf- sie wünsche keine Verschärfung ten noch einmal den Wunsch zum fassung: soweit tragbare Tatbe- und keine Komplikationen in den Ausdruck, daß die Nominierung stände in Frage kommen, ist für Ein erstes Ergebnis des Verhältnissen der beiden Länder. -

Yale University Library Digital Repository Contact Information
Yale University Library Digital Repository Collection Name: Henry A. Kissinger papers, part II Series Title: Series I. Early Career and Harvard University Box: 294 Folder: 9 Folder Title: Unknown author, Europa-Archiv Persistent URL: http://yul-fi-prd1.library.yale.internal/catalog/digcoll:561074 Repository: Manuscripts and Archives, Yale University Library Contact Information Phone: (203) 432-1735 Email: [email protected] Mail: Manuscripts and Archives Sterling Memorial Library Sterling Memorial Library P.O. Box 208240 New Haven, CT 06520 Your use of Yale University Library Digital Repository indicates your acceptance of the Terms & Conditions of Use http://guides.library.yale.edu/about/policies/copyright Find additional works at: http://yul-fi-prd1.library.yale.internal ELROFA ARCH IV ilerausgegeben von Wilhelm Corn¡d Postverlagsort Frankfurt/Main • 24 Folgen jährlich HALBNIONALSSCHRIFF DER DEUISCHEN GESELLSCHAFF FUR AUS \V AR i IC,E POLIFIK [1.c.] DEUTSCHE GESELLSCHAFT FOR AUSWÄRTIGE POLITIK e. V. Präsidium Die Deutsche Gesellschaft für Auswär- DR, GÜNTER HENLE, Preitide1St tige Politik wurde im März 1955 in Bonn FRITZ ERLER, als eine unabhängige und überparteiliche Stellvertretender Präsident Vereinigung, gegründet. Ihr wurde das FRITZ BERG, Stellvertretender Präsident Institut für Europäische Politik und Wirt- THEODOR STELTZER, schaft in Frankfurt am Main eingeglie- Geschäftsführender Präsident dert, das seither den Namen Forschungs- DR. GOTTHARD FREIHERR VON institut der Deutschen Gesellschaft für FALK E N HAU S EN, Schatzmeister Auswärtige Politik trägt. Veröffent- PROP. DR. ARNOLD BERGSTRÄSSER, lichungsorgan Direktor des Forschungsinstituts der Gesellschaft und ihres WILHELM CORNIDES, Forschungsinstitutes ist die Zeitschrift Herausgeber des „Europa-Archie EUROPA-ARCHIV, deren Verlagsredite DR. MARION GRÄFIN Dt$NITOFF die Gesellschaft übernommen hat. -

Quellen Und Literatur
QUELLEN UND LITERATUR ZEITZEUGENGESPRÄCHE Hans Willgerodt, Universitätsprofessor, Neffe von Wilhelm Röpke; Interview v. 31. Januar 2006 Geert Müller-Gerbes, Journalist, ehemaliger Pressereferent des Bundespräsidenten; Interview v. 8. Februar 2006. Peter Heinemann, Notar, Sohn von Gustav Heinemann; Interview v. 24. Februar 2006. Barbara und Manfred Wichelhaus, Tochter und Schwiegersohn von Gustav Heinemann; Interview v. 22. März 2006. Jürgen Schmude, Jurist, Bundesminister a.D., Interview v. 15. November 2006. Erhard Eppler, Lehrer, Bundesminister a.D.; Interview v. 10. Januar 2007. UNGEDRUCKTE QUELLEN Archiv der sozialen Demokratie der Friedrich-Ebert-Stiftung, Bonn Nachlaß Gustav Heinemann, Teil I Nachlaß Gustav Heinemann, Teil II Nachlaß Erich Ollenhauer Nachlaß Kurt Schumacher Nachlaß Helene Wessel Nachlaß Adolf Scheu Nachlaß Fritz Erler Bestand Erhard Eppler Protokolle des SPD-Parteivorstandes Sammlung Organisationen des SPD-Parteivorstandes: GVP Sammlung Willems Stiftung Bundeskanzler-Adenauer-Haus, Bad Honnef/Rhöndorf Nachlaß Konrad Adenauer Archiv für Christlich-Demokratische Politik der Konrad-Adenauer-Stiftung, Sankt Augustin Nachlaß Gerhard Schröder Nachlaß Paul Bausch Nachlaß Ernst Lemmer Bestand der Ost-CDU Bestand der Exil-CDU Bestand des Kreisverbandes der CDU Essen Archiv der Bundesbeauftragten für die Unterlagen des Staatssicherheitsdienstes der ehemaligen Deutschen Demokratischen Republik, Berlin Bestand MfS-ZAIG: Zentrale Auswertungs- und Informationsgruppe Bestand MfS-HA: Hauptabteilung Quellen und Literatur 337 Bestand -

Germany and Berlin, 1969–1972 961 The
1325_A42-A47.qxd 11/30/07 1:22 PM Page 961 310-567/B428-S/11005 Germany and Berlin, 1969–1972 961 the Soviets might change their position. Chancellor Brandt stated that he was not sure; he thought so but that, in any event, he looked for ratification of the treaty sometime in May and hoped that there would be improved transit to East Berlin by Eastertime, so that the reverse linkage problem may ultimately be finessed. Foreign Minister Scheel stated that the Soviets had not been particularly intelligent about this issue. He had raised it with Gromyko in Moscow12 and Gromyko had informed him that Brezhnev had his reputation intertwined with the Moscow treaty and, therefore, they had to be secure with respect to its ratification. Secretary Rogers stated that the problem was that they had moved from a position of no linkage to reverse linkage and that, in ef- fect, this helped us. The group bade farewell and President Nixon issued instructions for the departure ceremony and the movement of the Chancellor and his party by helicopter back to Sarasota.13 12 Scheel was in Moscow November 25–30 for meetings with Brezhnev, Kosygin, and Gromyko. For the text of an announcement on the visit, issued by the West German Foreign Office on December 2, see Texte zur Deutschlandpolitik, Vol. 9, pp. 241–244. 13 For the text of remarks exchanged between Nixon and Brandt at the end of the meeting on December 29, as well as the text of the joint statement issued on the same day, see Department of State Bulletin, January 24, 1972, pp. -
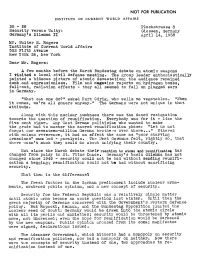
Security Versus Unity: Germany's Dilemma II
NOT FOR PUBLICATION INSTITUTE OF CURRENT VORLD AFFAIRS DB- 8 Plockstrasse 8 Security versus Unity: Gie ssen, Germany Germany' s Dilemma II April l, 19G8 Mr. Walter S. Rogers Institute of Current World Affairs 522 Fifth Avenue ew York 36, Eew York Dear Mr. Rogers: A few months before the -arch Bundestag debate on atomic weapons I Islted a local civil defense meeting. The group leader enthusiastically painted a hideous picture of atomic devastation; the audience remained dumb arid expressionless. Film and magazine reports on hydrogen bombs, fall-out, radiation effects they all seeme to fall on plugged ears in Germany. "at can one do?"'asked Kurt Odrig, who sells me vegetables. "Yhen it comes, we're all goers anyway." The Germans were not uique in that attitude. Along with this nuclear numbness there was the dazed resignation towards the question of reunification. Everybody was for it like the fiv cent clgar. Any West German politlclan who wanted to make the rade had to master the sacred roeunification phase: "Let us not forget our seventeen-million German brothe.,,_s over there..." Uttered ith solen reverence, it had an effect tho same as ,'poor starving rmenlans" ,once had paralysis. The Test Germans felt, rightly so, that there ,sn't much they could do about uifying their country. But since the arch debate their ,reaction to atoms and reunificatoa has changed from palsy to St. Vitus Dance. Germany's basic dilemma has not changed since 1949 security could not be had without sending reunifi- cation a begging; reunification could not be had without sacrificing security. -

Diss Gradschool Submission
OUTPOST OF FREEDOM: A GERMAN-AMERICAN NETWORK’S CAMPAIGN TO BRING COLD WAR DEMOCRACY TO WEST BERLIN, 1933-72 Scott H. Krause A dissertation submitted to the faculty at the University of North Carolina at Chapel Hill in partial fulfillment of the requirements for the degree of Doctor of Philosophy in the Department of History. Chapel Hill 2015 Approved by: Konrad H. Jarausch Christopher R. Browning Klaus W. Larres Susan Dabney Pennybacker Donald M. Reid Benjamin Waterhouse © 2015 Scott H. Krause ALL RIGHTS RESERVED ii ABSTRACT Scott H. Krause: Outpost of Freedom: A German-American Network’s Campaign to bring Cold War Democracy to West Berlin, 1933-66 (under the direction of Konrad H. Jarausch) This study explores Berlin’s sudden transformation from the capital of Nazi Germany to bastion of democracy in the Cold War. This project has unearthed how this remarkable development resulted from a transatlantic campaign by liberal American occupation officials, and returned émigrés, or remigrés, of the Marxist Social Democratic Party (SPD). This informal network derived from members of “Neu Beginnen” in American exile. Concentrated in wartime Manhattan, their identity as German socialists remained remarkably durable despite the Nazi persecution they faced and their often-Jewish background. Through their experiences in New Deal America, these self-professed “revolutionary socialists” came to emphasize “anti- totalitarianism,” making them suspicious of Stalinism. Serving in the OSS, leftists such as Hans Hirschfeld forged friendships with American left-wing liberals. These experiences connected a wider network of remigrés and occupiers by forming an epistemic community in postwar Berlin. They recast Berlin’s ruins as “Outpost of Freedom” in the Cold War.